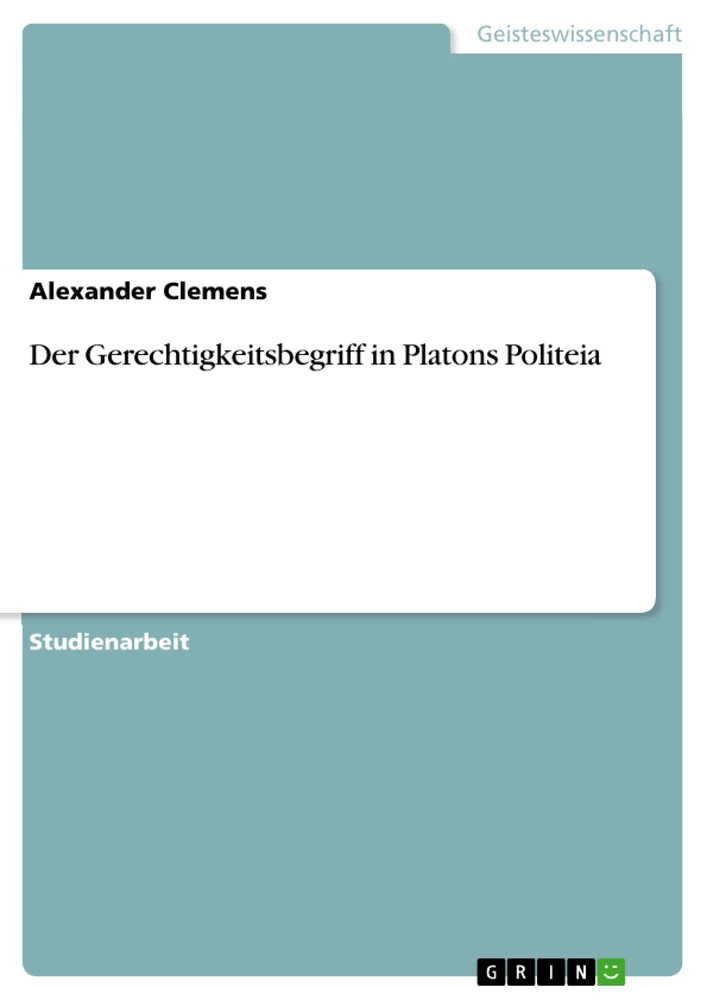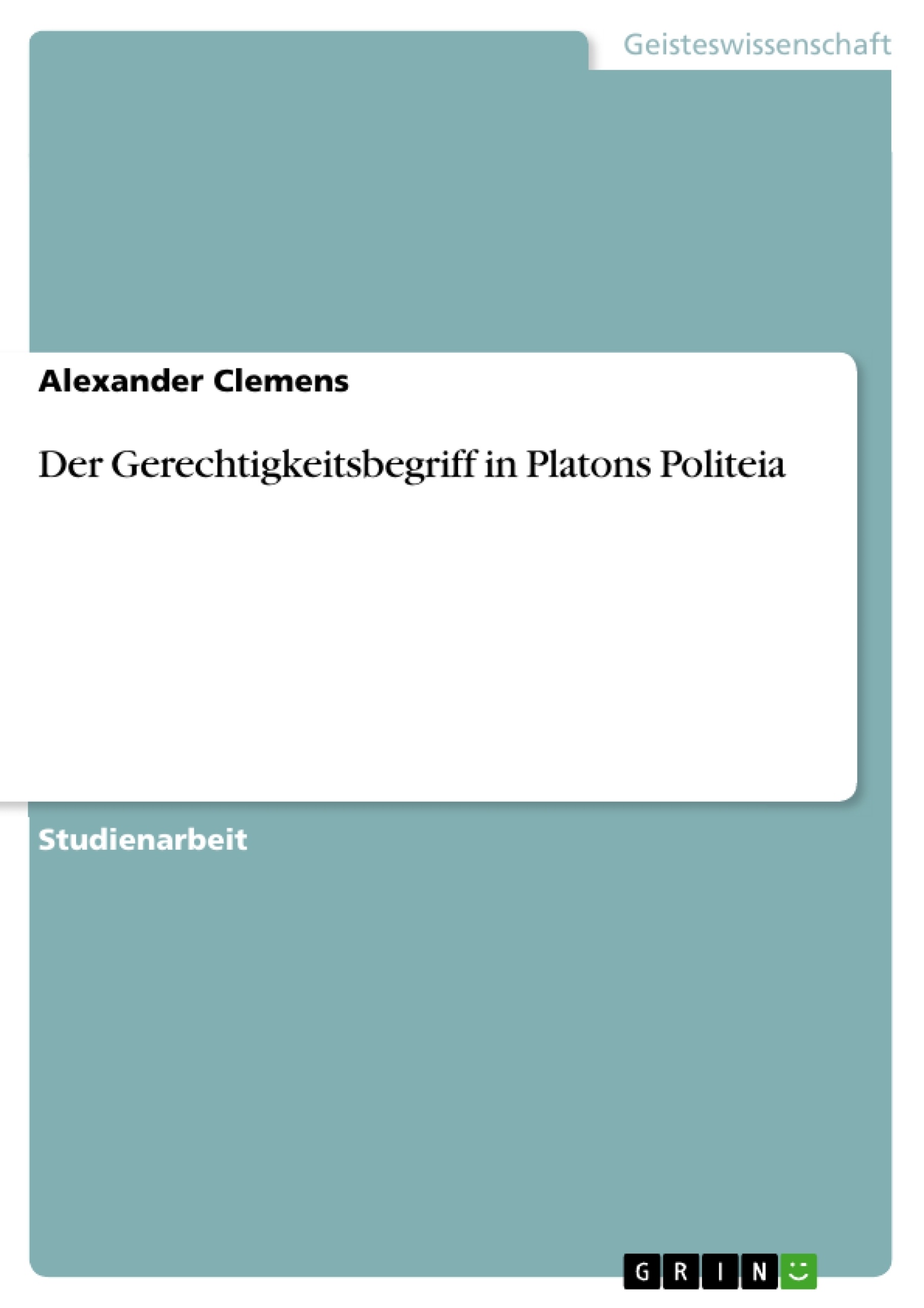Platons Politeia gilt als sein philosophisches Hauptwerk und stellt bis heute eines der einflussreichsten Werke der politischen Philosophie dar. Neben ihrer philosophiegeschichtlichen Bedeutung sucht die Bandbreite der in der Politeia behandelten Themen ihresgleichen: neben Kunst und Musik, Erziehung und Bildung, den Rechten der Frau, Ökonomie und Arbeitsteilung, dem glücklichen Leben, sowie dem Verhältnis von Gut und Böse, steht vor allem die Gerechtigkeit im Mittelpunkt der Überlegungen Platons. Platons erklärtes Ziel ist es, das Wesen der Gerechtigkeit zu bestimmen und herauszufinden, „ob die Gerechten […] besser leben als die Ungerechten und glücklicher sind“ – schließlich gehe es dabei „nicht um irgendeine belanglose Frage, sondern darum, wie man leben soll.“
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die durch Sokrates forcierte Entwicklung des Gerechtigkeitsbegriffes in der Politeia nachzuvollziehen. Dazu sollen die zur Formulierung des platonischen Gerechtigkeitsbegriffes im vierten Buch der Politeia führenden Argumente des Sokrates und seiner Gesprächspartner systematisch dargestellt und kritisch Stellung zu deren Folgerichtigkeit und Bedeutung für die Gesamtargumentation bezogen werden.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Vorbetrachtungen zum Wesen der Gerechtigkeit
- 2.1 Dialoge mit Kephalos und Polemarchos
- 2.2 Die Gegenargumentation des Thrasymachos
- 3. Das Lob der Ungerechtigkeit
- 3.1 Glück und Gerechtigkeit
- 3.2 Der Nutzen der Gerechtigkeit
- 4. Herleitung des Gerechtigkeitsbegriffes
- 4.1 Die Entwicklung des Idealstaates
- 4.2 Der platonische Idealstaat
- 4.3 Die Beschaffenheit der Seele
- 4.4 Der Analogieschluss
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Entwicklung des Gerechtigkeitsbegriffes in Platons Politeia zu analysieren. Dazu wird die Argumentation von Sokrates und seinen Gesprächspartnern im vierten Buch der Politeia untersucht, um die Entstehung des platonischen Gerechtigkeitsbegriffes nachzuvollziehen.
- Der platonische Gerechtigkeitsbegriff im Kontext der Politeia
- Analyse der Argumente von Sokrates und seinen Gesprächspartnern
- Die Rolle der Gerechtigkeit in Platons idealem Staat
- Die Verbindung zwischen Gerechtigkeit und der Beschaffenheit der Seele
- Die philosophischen Implikationen des platonischen Gerechtigkeitsbegriffes
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel der Arbeit befasst sich mit der Einleitung und stellt die Relevanz von Platons Politeia für die politische Philosophie sowie die zentrale Rolle der Gerechtigkeit in diesem Werk dar. Kapitel zwei analysiert die konventionellen Vorstellungen von Gerechtigkeit, die im ersten Buch der Politeia von Kephalos, Polemarchos und Thrasymachos präsentiert werden. Sokrates widerlegt diese Auffassungen systematisch und bereitet so den Boden für die Entwicklung seines eigenen Gerechtigkeitsbegriffes.
Kapitel drei beschäftigt sich mit dem Lob der Ungerechtigkeit, das von Thrasymachos vorgebracht wird. Dieser behauptet, dass Gerechtigkeit nichts anderes sei als der Vorteil des Stärkeren und dass Ungerechtigkeit dem Einzelnen letztlich mehr Nutzen bringt. Sokrates widerlegt auch diese Behauptung und stellt die Vorteile der Gerechtigkeit heraus.
Im vierten Kapitel wird die Herleitung des platonischen Gerechtigkeitsbegriffes anhand der Entwicklung des Idealstaates in der Politeia erläutert. Sokrates zeigt, wie sich die verschiedenen Stände im Idealstaat zusammenfügen und wie Gerechtigkeit in diesem Zusammenhang als Grundlage für ein gutes und glückliches Leben für den Einzelnen und die Gesellschaft verstanden werden kann.
Schlüsselwörter (Keywords)
Platon, Politeia, Gerechtigkeit, Idealstaat, Seele, Tugend, Dialog, Sokrates, Thrasymachos, Kephalos, Polemarchos, Ungerechtigkeit, Freundschaft, Feind, Schaden, Nutzen, Gesetz, Politik, Philosophie.
- Arbeit zitieren
- Alexander Clemens (Autor:in), 2015, Der Gerechtigkeitsbegriff in Platons Politeia, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/313578