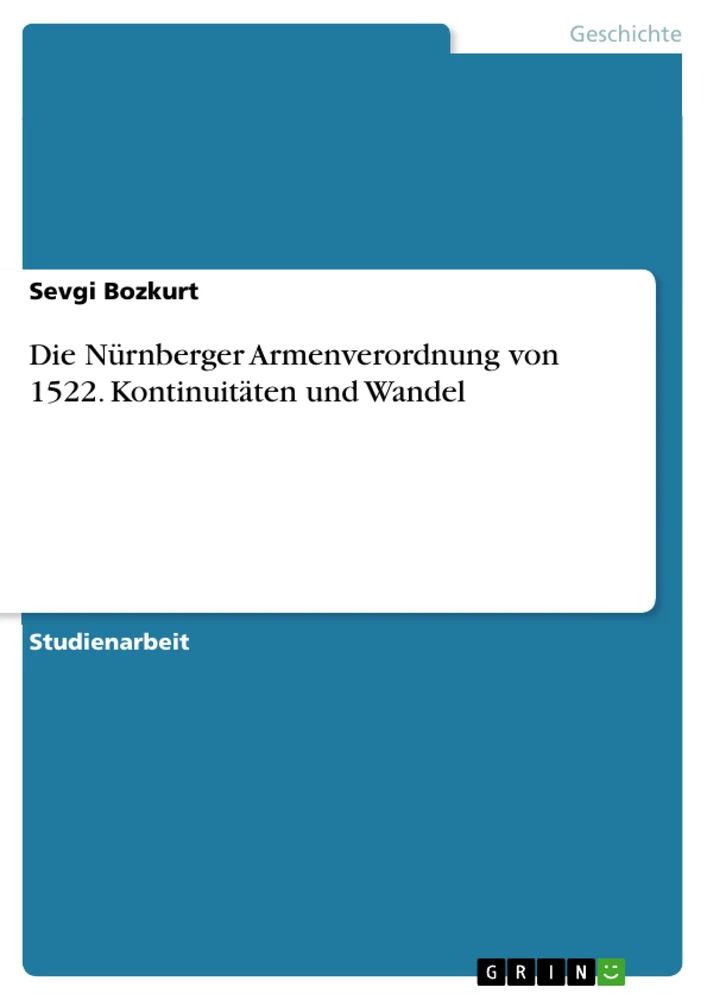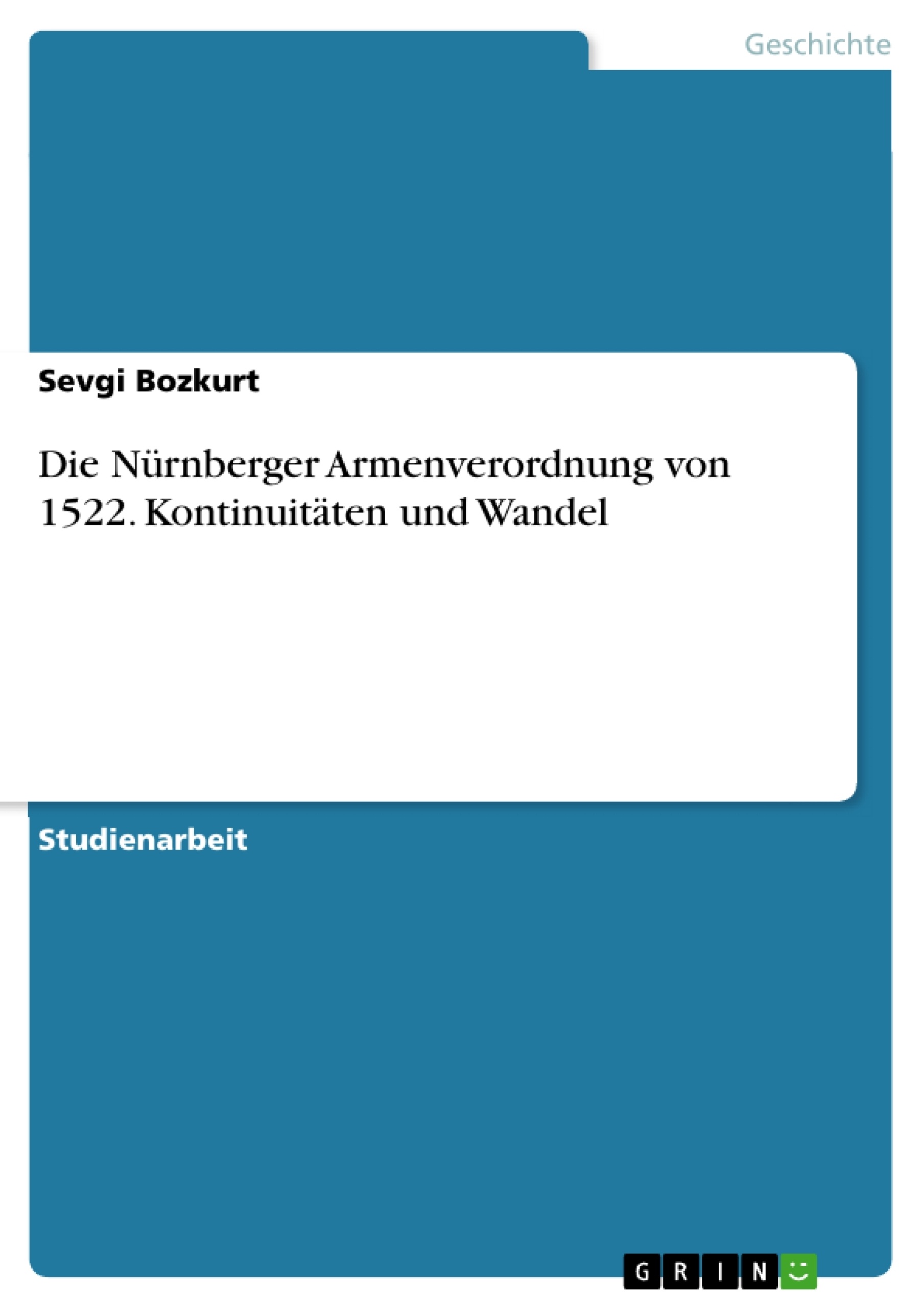Die Armut ist ein Begriff, mit dem jeder Mensch im Laufe seines Lebens konfrontiert wird. Im Laufe der Menschheitsgeschichte war die Armut stets ein Problem, welches fortlaufend existierte und dies heutzutage stets noch tut. Der Blickwinkel jedoch auf diese Problematik obliegt einem kontinuierlichen Wandel, von den anfänglichen Almosenspenden im Mittelalter bis hin zu Armenverordnungen für die dafür gesehene Armenfürsorge Mitte des 16. Jahrhunderts.
Diese Arbeit soll den Wandel bzw. die Kontinuitäten der Armenfürsorge in der Stadt Nürnberg untersuchen. Auf der einen Seite soll die Entwicklung der Armenfürsorge untersucht werden, ausgehend von den aus christlicher Nächstenliebe gespendeten Almosen bis hin zu einer Armenverordnung mit einer strukturellen Organisation der Almosenvergabe, auf der anderen Seite die dabei entstandenen Fortschritte bzw. Rückgänge in der Regelung der Armutsbekämpfung bzw. der Problematik.
In dieser Arbeit sollen genannte Punkte untersucht und die Effektivität der Bewältigung der Armutsproblematik durchleuchtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Bedeutung der Armenfürsorge
- Neue Ordnungen über das Almosenwesen
- Einkünfte der Almosen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Armenfürsorge in Nürnberg vom Mittelalter bis zur Einführung der Armenverordnung von 1522. Sie beleuchtet die Kontinuitäten und Veränderungen in der Armenfürsorge, die vom christlichen Glauben und der Nächstenliebe geprägt waren. Im Mittelpunkt stehen die Herausforderungen, die das Betteln für die Stadt darstellte, und die Auswirkungen der Armenverordnung auf die Organisation und Effizienz der Armenfürsorge.
- Die Rolle des christlichen Glaubens und der Nächstenliebe in der Armenfürsorge
- Die Herausforderungen des Bettlerproblems in Nürnberg
- Die Einführung und die Inhalte der Nürnberger Armenverordnung von 1522
- Die Auswirkungen der Armenverordnung auf die Organisation der Almosenvergabe
- Die Effektivität der Armenfürsorge im Wandel
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik der Armenfürsorge ein und skizziert die Relevanz der Problematik im historischen Kontext. Sie stellt den Wandel in der Armenfürsorge vom Mittelalter bis zum 16. Jahrhundert dar und erläutert die Zielsetzung der Arbeit.
- Die Bedeutung der Armenfürsorge: Dieser Abschnitt beleuchtet die zentrale Rolle des christlichen Glaubens und der Nächstenliebe in der Armenfürsorge. Er analysiert die Beziehung zwischen dem Glauben, der Nächstenliebe und den guten Werken sowie deren Auswirkungen auf die Gesellschaft.
- Neue Ordnungen über das Almosenwesen: Dieses Kapitel behandelt die Herausforderungen, die das Betteln in Nürnberg darstellte, und analysiert die Ursachen für die steigende Anzahl von Bedürftigen. Es beleuchtet die problematischen Aspekte des Almosenwesens und die Notwendigkeit einer neuen Ordnung.
- Einkünfte der Almosen: Dieser Abschnitt befasst sich mit den Einkünften der Almosen, die durch die Armenverordnung von 1522 geregelt wurden. Er analysiert die verschiedenen Einnahmequellen und die Organisation der Almosenvergabe im neuen System.
Schlüsselwörter
Armenfürsorge, Nürnberger Armenverordnung, Almosenwesen, Nächstenliebe, Betteln, Glaube, christliche Gemeinde, Kontinuitäten, Wandel, mittelalterliche Gesellschaft, strukturelle Organisation, Effektivität.
- Quote paper
- Sevgi Bozkurt (Author), 2011, Die Nürnberger Armenverordnung von 1522. Kontinuitäten und Wandel, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/313551