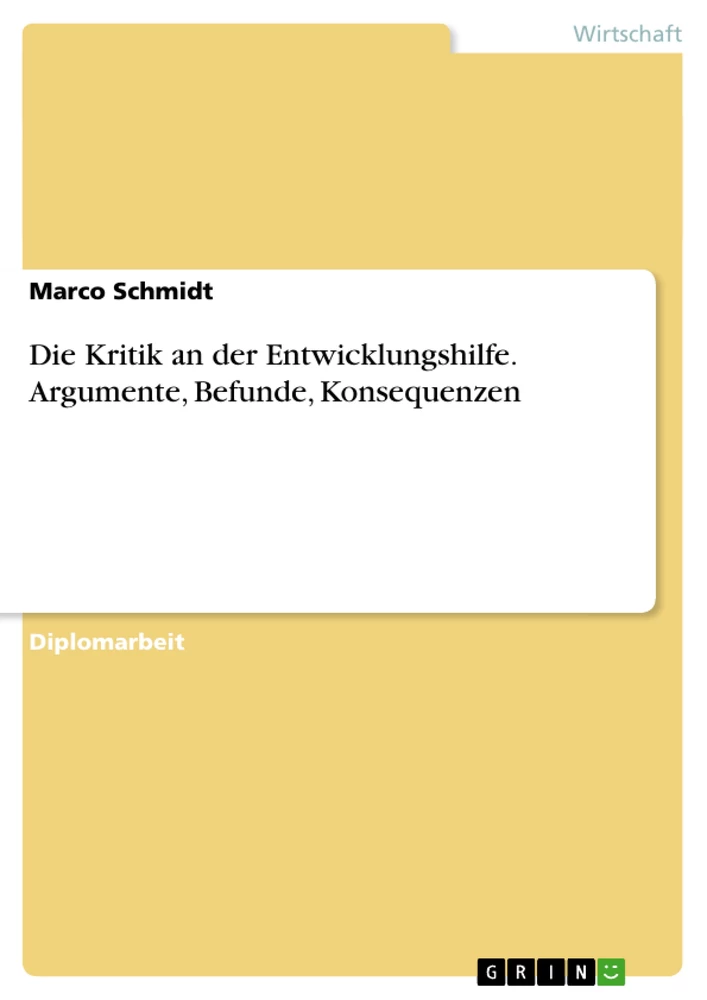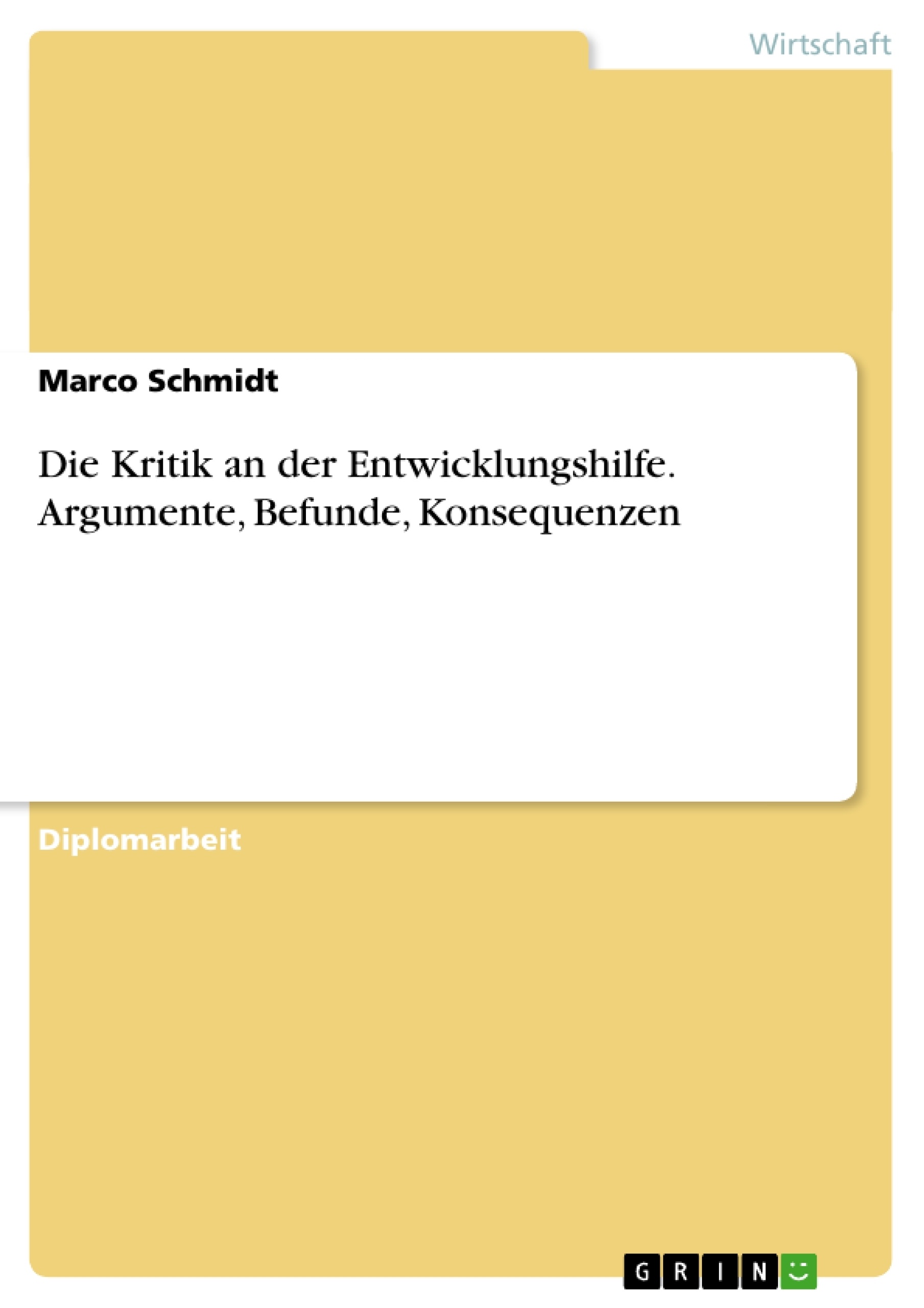Es sind jedoch gerade diese angeblichen positiven Effekte der Entwicklungshilfe und der Fortschritt in der entwicklungspolitischen Bekämpfung der Armut, die von einer Vielzahl von Kritikern zumindest angezweifelt wenn nicht sogar aufs Schärfste zurückgewiesen werden. So konstatiert beispielsweise Peter Bauer: „Man unterschätzt die Völker der Dritten Welt, wenn man behauptet, sie könnten im Gegensatz zum Westen materiellen Fortschritt nicht ohne Almosen von außen erlangen [...]. In Wirklichkeit haben sich große Teile der Dritten Welt rapide entwickelt, lange bevor sie Entwicklungshilfe erhielten [...]. Kurzum, ausschlaggebend für wirtschaftlichen Erfolg ist die Haltung der Menschen [...]. Hilfe von außen war noch zu keiner Zeit und nirgendwo für die Entwicklung eines Landes notwendig.“1
Gleichzeitig wird auch die uneigennützige Motivationslage in Frage gestellt und stattdessen nationale Interessen der Geberländer als die treibende Kraft in der Entwicklungspolitik unterstellt.2 Auch entwicklungspolitische Verfehlungen der Nehmerländer bleiben den Kritikern nicht verborgen. Gerade im Hinblick auf die nach wie vor desolate Lage in Afrika wird immer häufiger auf die Verantwortung der Entwicklungshilfenehmer hingewiesen. „Um Afrika südlich der Sahara war es [trotz Entwicklungshilfe] wohl noch nie so schlecht bestellt wie heute.“3 Dabei weist selbst der ghanaische UN-Generalsekretär darauf hin, „[...] dass Afrika längst nicht mehr Opfer, sondern Täter sei und in den mittlerweile fast fünf Dekaden seit Beginn der Unabhängigkeit praktisch nichts zur eigenen Entwicklung beigetragen habe.“4
Vor diesem Hintergrund stellt sich nun die Frage, inwieweit die traditionelle Entwicklungshilfe, wie sie seit 50 Jahren Anwendung findet, überhaupt noch gerechtfertigt werden kann. Kann und sollte die internationale Entwicklungszusammenarbeit so fortgeführt werden wie bisher? Welche Empfehlungen und Verbesserungsvorschläge können auf Basis der gemachten Erfahrungen und jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnisse ausgesprochen werden? Die Betrachtung dieser Fragen ist Gegenstand der vorliegenden Arbeit.
[1 Bauer (1982), S.9. 2 Vgl. Wagner (1993), S.12f.; Mosley (1987), S.32. 3 Drechsler (2004), S.9. 4 Drechsler (2004), S.9.]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Relevanz und Aktualität der Thematik - Zielsetzung der vorliegenden Arbeit
- 1.2 Aufbau und Vorgehensweise
- 2 Grundlagen der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit
- 2.1 Definition und Indikatoren von Entwicklung – Implikationen für die Beurteilung der Entwicklungshilfe
- 2.2 Ursprung der Entwicklungshilfe – Annahmen und ihre Auswirkungen
- 3 Die Entwicklungshilfe in der Diskussion
- 3.1 Beobachtungen, Ansichten und Forderungen der Kritiker
- 3.1.1 Geber im Spannungsfeld von Altruismus und Eigennutz
- 3.1.2 Kapazitäten und Leistungsfähigkeiten der Nehmerländer und ihr Einfluss auf den Erfolg der Entwicklungszusammenarbeit
- 3.1.3 Zusammenarbeit und Koordination
- 3.1.3.1 Koordination zwischen verschiedenen Gebern
- 3.1.3.2 Koordination zwischen Gebern und Nehmern
- 3.1.4 Volatilität und Fungibilität der Entwicklungshilfezahlungen
- 3.1.5 Die ,,Holländische Krankheit”
- 3.1.6 Wirkung der Entwicklungshilfe auf die inländische Ersparnis
- 3.2 Schlussfolgerungen - Beendigung der Entwicklungszusammenarbeit?
- 4 Weltbank und die Verbesserung der Entwicklungszusammenarbeit
- 4.1 Weltbank und entwicklungspolitische Forschung
- 4.2 Voraussetzungen einer erfolgreichen Entwicklungszusammenarbeit
- 4.2.1 ,,Gute Politiken“ und Institutionen in den Nehmerländern
- 4.2.2 Wohlstandsniveau in den Empfängerländern
- 4.2.3 Anpassungsempfehlungen
- 5 Perspektiven und Konzepte für die Entwicklungshilfe im 21. Jahrhundert - Resümee, Ergänzungen, Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich kritisch mit der Entwicklungshilfe und analysiert deren Wirksamkeit und Relevanz im Kontext der internationalen Zusammenarbeit. Sie untersucht die Argumente der Kritiker, beleuchtet die Auswirkungen der Entwicklungshilfe auf die Empfängerländer und diskutiert die Notwendigkeit einer Weiterentwicklung der bestehenden Konzepte.
- Kritik an der Entwicklungshilfe
- Wirksamkeit und Effizienz der Entwicklungshilfe
- Die Rolle der Weltbank in der Entwicklungszusammenarbeit
- Perspektiven und Herausforderungen der Entwicklungshilfe im 21. Jahrhundert
- Die Bedeutung guter Regierungsführung und nachhaltiger Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung Dieses Kapitel führt in die Thematik der Entwicklungshilfe ein und erläutert die Relevanz und Aktualität des Themas. Es wird die Zielsetzung der Arbeit vorgestellt und der Aufbau und die Vorgehensweise des Textes beschrieben.
Kapitel 2: Grundlagen der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit Dieses Kapitel beleuchtet die grundlegenden Konzepte der Entwicklungshilfe, definiert die Begriffe „Entwicklung“ und „Entwicklungshilfe“ und analysiert die historischen Wurzeln der internationalen Zusammenarbeit. Es werden die Annahmen und Auswirkungen der Entwicklungshilfe auf die Empfängerländer diskutiert.
Kapitel 3: Die Entwicklungshilfe in der Diskussion Dieses Kapitel präsentiert verschiedene kritische Perspektiven auf die Entwicklungshilfe und analysiert die Argumente der Kritiker. Es werden Themen wie die Volatilität und Fungibilität der Entwicklungshilfezahlungen, die „Holländische Krankheit“ und die Auswirkungen der Entwicklungshilfe auf die inländische Ersparnis diskutiert.
Kapitel 4: Weltbank und die Verbesserung der Entwicklungszusammenarbeit Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle der Weltbank in der Entwicklungszusammenarbeit und untersucht die Voraussetzungen einer erfolgreichen Entwicklungshilfe. Es werden wichtige Faktoren wie „gute Politiken“ und Institutionen in den Empfängerländern, das Wohlstandsniveau und Anpassungsempfehlungen analysiert.
Kapitel 5: Perspektiven und Konzepte für die Entwicklungshilfe im 21. Jahrhundert - Resümee, Ergänzungen, Schlussfolgerungen Dieses Kapitel fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen, präsentiert neue Perspektiven und Konzepte für die Entwicklungshilfe im 21. Jahrhundert und leitet aus den gewonnenen Erkenntnissen Schlussfolgerungen ab.
Schlüsselwörter
Entwicklungshilfe, Kritik, Wirksamkeit, Effizienz, Weltbank, Entwicklungszusammenarbeit, Good Governance, nachhaltige Entwicklung, Armutsbekämpfung, Entwicklungsländer, Geberländer, Nehmerländer, Kapazitätsaufbau, Institutionelle Reformen, Fungibilität, Volatilität, Holländische Krankheit.
- Arbeit zitieren
- Marco Schmidt (Autor:in), 2004, Die Kritik an der Entwicklungshilfe. Argumente, Befunde, Konsequenzen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/31347