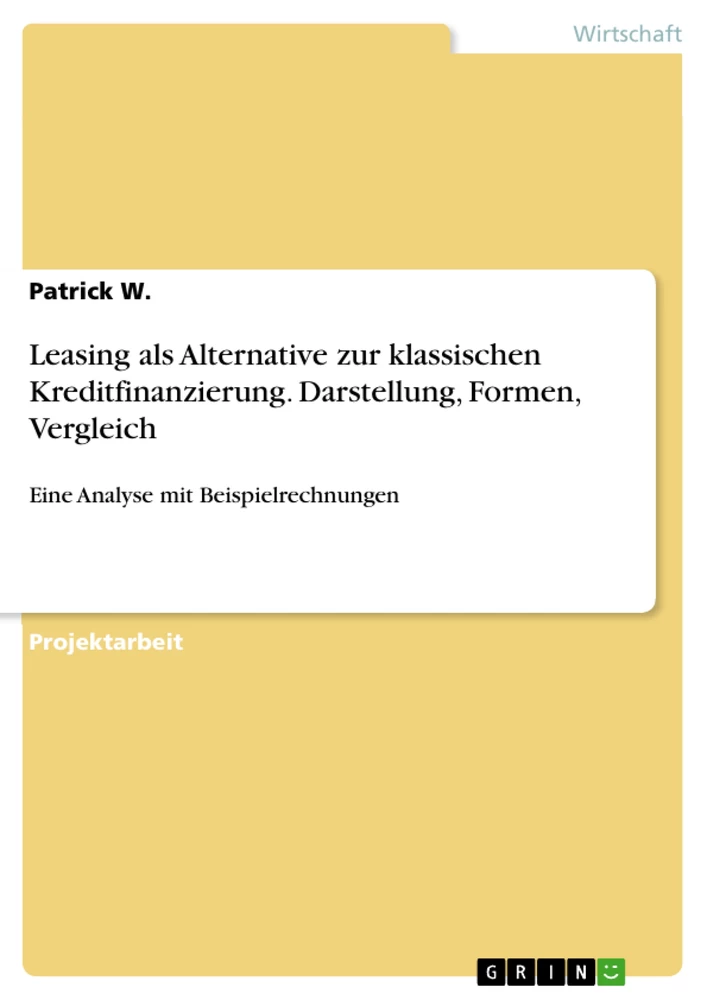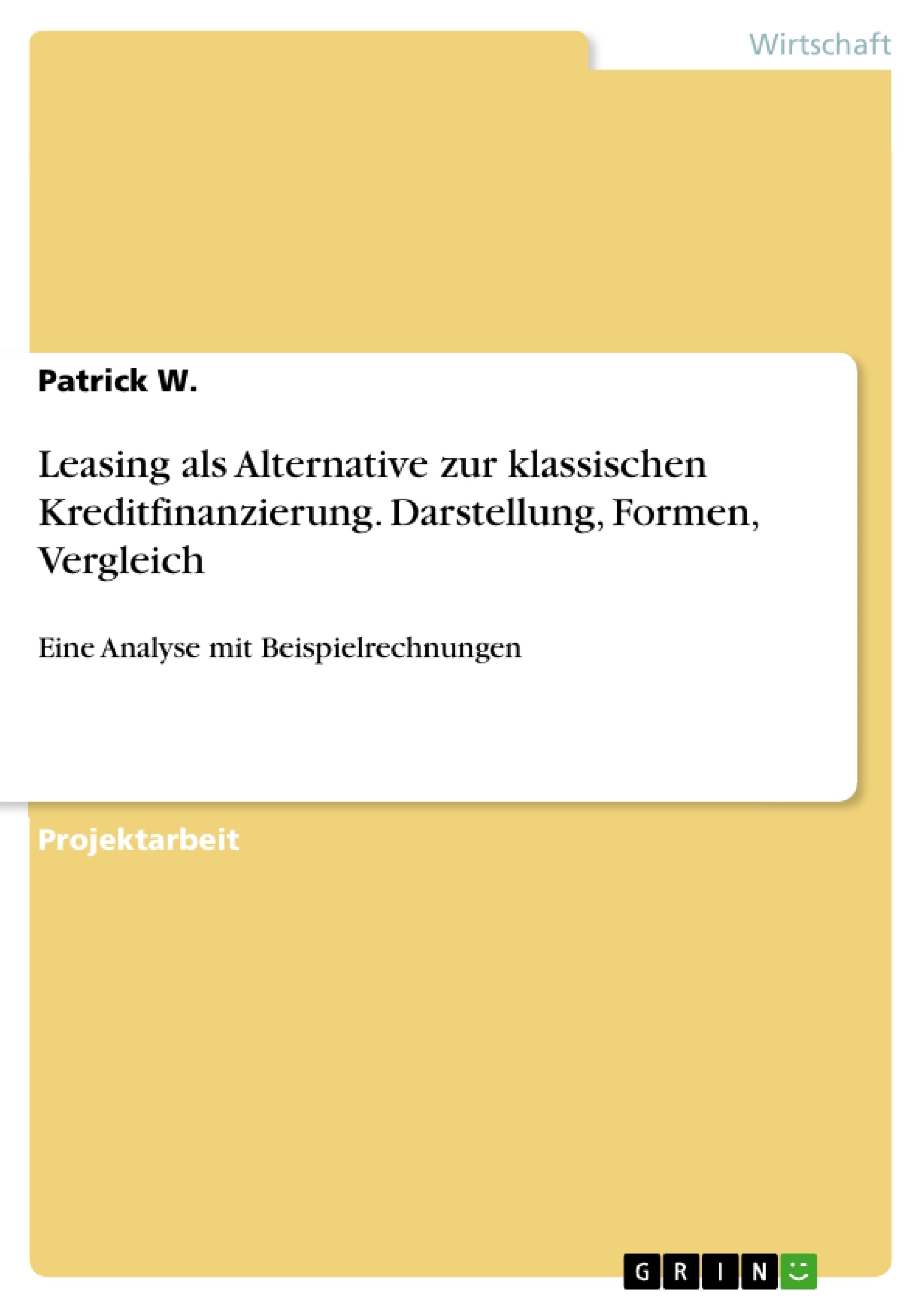Im Zeitalter des 21. Jahrhunderts stehen den Unternehmen als auch den privaten Haushalten vielseitige Möglichkeiten der Finanzierung zur Verfügung. Durch stetige Erneuerungen und dem permanent steigenden Fortschritt in allen Bereichen der Technik werden die Betriebe gezwungen, sich dem Wandel der Zeit durch Innovationen und andauernden Investitionen anzupassen.
Als Grundlage dienen die klassischen Instrumente der Finanzierung. Sei es nun eine Eigen- oder eine Fremdkapitalfinanzierung, es gilt stets das Ziel zu verfolgen, eine noch bessere Alternative innerhalb dieses gewaltigen Spektrums zu finden. Dabei stehen oft unterschiedliche Gesichtspunkte im Vordergrund und es ist nur schwer abzuwägen, welche Alternative die bessere Variante darstellt, da einige Kriterien in einem Zielkonflikt stehen. Unter anderem wird ein besonderes Augenmerk auf die Finanzierungskosten, bilanzielle Auswirkungen und Haftungsbegrenzungen gelegt. Jegliche Entscheidungen haben finanzielle Auswirkungen.
Im Jahr 2012 wurden allein in Deutschland 313,9 Mrd. € für Investitionen benötigt. Ein Rückgang dieser Zahl ist bisher nicht abzusehen.
Erfahrungsgemäß sind die betrieblichen und privaten Eigenmittel begrenzt, sodass auf fremde Kapitalgeber zurückgegriffen werden muss. Doch um eine überhöhte Fremdkapitalquote zu verhindern, sind viele Investoren auf alternative Finanzierungsmöglichkeiten angewiesen. Daraus entstand auch der Grund-gedanke des Leasings „mieten statt kaufen“.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, Leasing als alternative Finanzierungsform im Vergleich zur klassischen Kreditfinanzierung zu erläutern, die Vorzüge aufzuzeigen, aber auch die einhergehenden Nachteile zu betrachten. Dabei werden sowohl quantitative als auch qualitative Faktoren analysiert. Dazu gliedert sich die Projektarbeit in sechs Kapitel.
Zur Hinführung dieses Themengebietes wird mit einer Darstellung des Leasings begonnen. Hier werden die grundlegenden Merkmale beleuchtet. In Kapitel drei werden die verschiedensten Formen des Leasings genauer betrachtet und erklärt. Der Hauptteil dieser Arbeit folgt in Kapitel vier. Dort wird explizit auf den Vergleich zwischen Leasing und der klassischen Kreditfinanzierung eingegangen und verschiedenste Rechnungen berücksichtigt. Im abschließenden Kapitel fünf wird eine Zusammenfassung gegeben und Schlussfolgerungen gezogen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Problemstellung
- Aufbau der Arbeit und Zielsetzung
- Abgrenzung des Themas
- Darstellung von Leasing
- Begriff Leasing
- Unterscheidung Leasing – Miete
- Bilanzierung
- Formen des Leasings
- Einteilung nach Vertragslaufzeit und Kündbarkeit
- Finanzierungsleasing
- Operate Leasing
- Einteilung nach Art des Leasingobjektes
- Mobilien Leasing
- Immobilien Leasing
- Einteilung nach den Leasingvertragsmodellen
- Vollamortisationsleasing
- Teilamortisationsleasing
- Einteilung nach Stellung des Leasinggebers
- Direktes Leasing
- Indirektes Leasing
- Sonderform Sale-and-Lease-Back
- Leasing im Vergleich zur Kreditfinanzierung
- Abgrenzung Kreditfinanzierung - Leasing
- Betriebswirtschaftliche Aspekte
- Bilanzielle Aspekte
- Steuerliche Aspekte
- Quantitativer Vergleich anhand einer Barwertmethode
- Einbeziehung qualitativer Aspekte anhand einer Nutzwertanalyse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Projektarbeit untersucht Leasing als alternative Finanzierungsform im Vergleich zur klassischen Kreditfinanzierung und beleuchtet die Vor- und Nachteile beider Modelle. Die Arbeit analysiert sowohl quantitative als auch qualitative Faktoren, um ein umfassendes Bild der beiden Finanzierungsformen zu zeichnen.
- Vergleich der Vor- und Nachteile von Leasing und Kreditfinanzierung
- Analyse der betriebswirtschaftlichen, bilanziellen und steuerlichen Auswirkungen
- Anwendung von quantitativen Methoden zur Bewertung (Barwertmethode)
- Einbezug qualitativer Aspekte (Nutzwertanalyse)
- Abschließende Bewertung der beiden Finanzierungsformen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einleitung: Diese Einführung erläutert die Problemstellung, die Zielsetzung der Arbeit und grenzt das Thema ab. Sie stellt die Relevanz der Finanzierungsalternative Leasing im Kontext von Unternehmensinvestitionen dar.
- Darstellung von Leasing: Dieses Kapitel beleuchtet die Definition von Leasing, unterscheidet es von der klassischen Miete und erklärt die bilanzielle Behandlung von Leasingobjekten.
- Formen des Leasings: Dieser Abschnitt betrachtet die verschiedenen Formen von Leasingverträgen, die sich nach Kriterien wie Vertragslaufzeit, Leasingobjekt, Vertragsmodell und Stellung des Leasinggebers unterscheiden.
- Leasing im Vergleich zur Kreditfinanzierung: Dieser Hauptteil der Arbeit geht ausführlich auf die Unterschiede zwischen Leasing und Kreditfinanzierung ein. Er beleuchtet betriebswirtschaftliche, bilanzielle und steuerliche Aspekte, vergleicht die Finanzierungsformen mit Hilfe der Barwertmethode und berücksichtigt qualitative Faktoren durch eine Nutzwertanalyse.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Leasing, Kreditfinanzierung, Finanzierungsalternativen, betriebswirtschaftliche Aspekte, Bilanzierung, Steuerliche Aspekte, Barwertmethode, Nutzwertanalyse, Vergleich, Analyse.
- Arbeit zitieren
- Patrick W. (Autor:in), 2013, Leasing als Alternative zur klassischen Kreditfinanzierung. Darstellung, Formen, Vergleich, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/313396