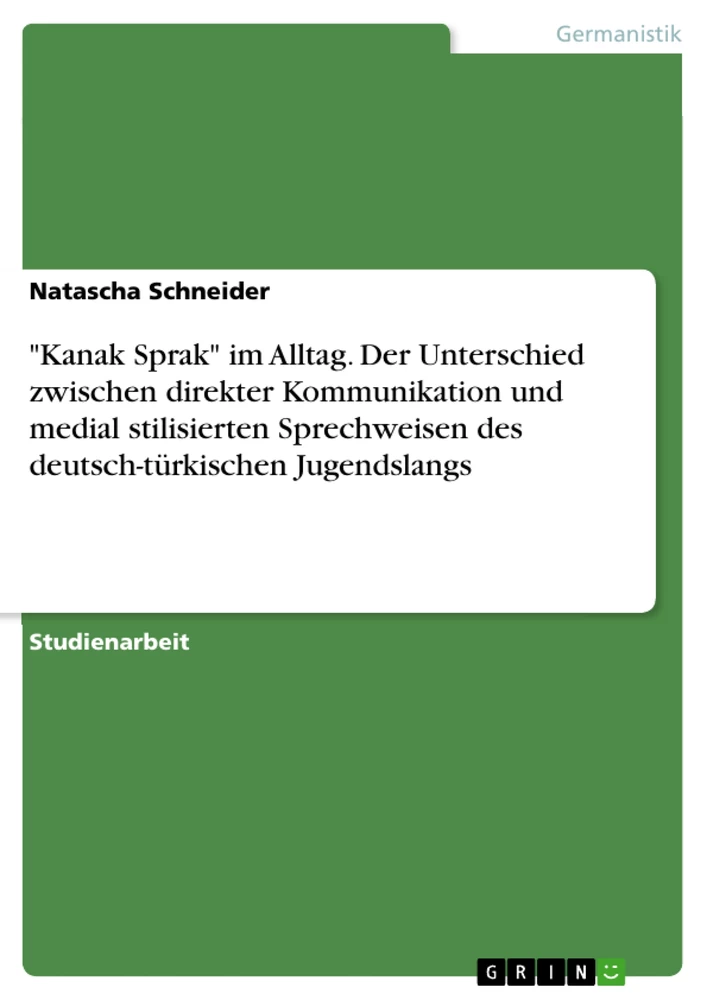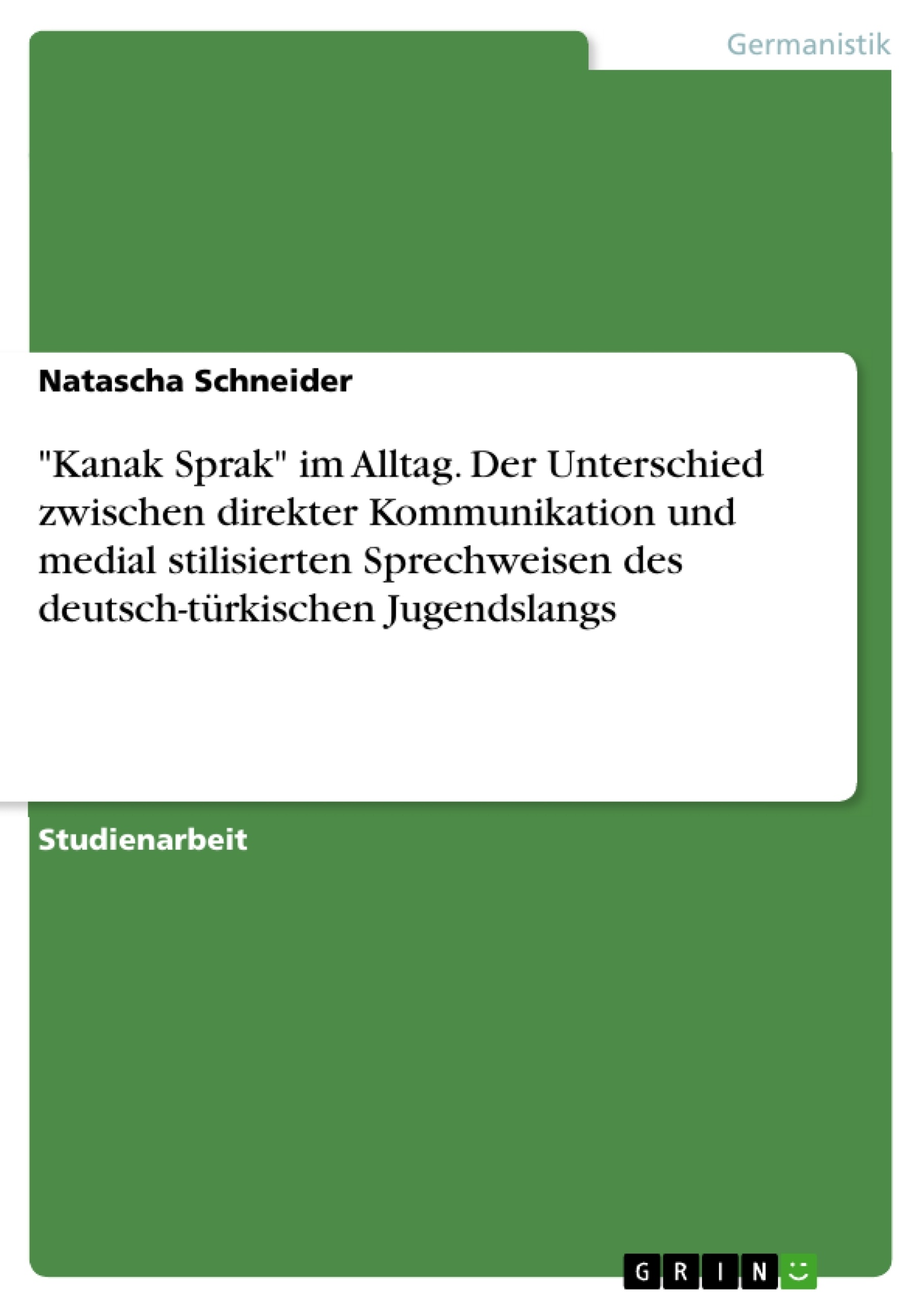Durch deutsch-türkische Kontaktvarietäten gerät nicht nur das Sprachverhalten von Migrantennachkommen in das Blickfeld der Forschung, sondern auch der Einfluss dieses Sprachverhaltens auf die Sprachpraxis der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Besonders im Sprachgebrauch der Jugendlichen entstehen Mischungsprozesse. Neben der Jugendsprache wird von den Jugendlichen zunehmend eine neue ethnolektale Varietät des Deutschen gesprochen.
In der Literatur ist dabei von Kanak Sprak oder Türkenslang die Rede. Vor allem die Mediatisierung führt zur Popularität dieser Sprechweise. Durch die Verbreitung in den verschiedenen Mediengattungen seit Mitte der 90er Jahre geraten die sprachlichen Veränderungen zunehmend in das Blickfeld der Öffentlichkeit. In den Medien, vor allem aber im Bereich der Comedy, werden Charaktere geschaffen, die ein überspitztes Bild der Realität darstellen. Diese Themen werden mit einer Stilisierung der ethnolektalen Sprechweise verbunden, die von der Sprachwirklichkeit jedoch abweicht.
Gegenstand meiner Arbeit ist die Herausarbeitung der Grundelemente des ethnolektalen Sprechstils des „Ghettos“ und ihrer Erscheinungsform in der Comedy. Dadurch wird der Unterschied der beiden Erscheinungsformen deutlich. Hierbei möchte ich auch auf die Aneignung von Türkendeutsch im Alltag eingehen. Dieser Aspekt ist besonders interessant, weil den ethnolektalen Sprechstil sowohl türkischstämmige Jugendliche, als auch Jugendliche nicht-türkischer Herkunft verwenden. Anschließend werden die Merkmale des „Medienethnolekts“ nochmals in einer selbstständigen Analyse herausgearbeitet.
Zunächst soll jedoch geklärt werden, was Kanak Sprak überhaupt ist. Im Anschluss daran möchte ich auf Peter Auers Modell eingehen. Dies erachte ich als sinnvoll im Hinblick auf die Unterscheidung zwischen der direkten Kommunikation und der medialen Stilisierung des Ethnolekts. Peter Auer gliedert den Ethnolekt in seinem Modell in drei verschiedene Teile, wodurch diese klarer voneinander abgrenzbar sind. Außerdem stellt Auer in diesem Modell die These auf, dass der Ethnolekt zu einem Soziolekt des Deutschen wird. Inwiefern diese These aufrechterhalten werden kann, möchte ich in einer abschließenden Diskussion erörtern. Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei dieser Arbeit um einen Teilbereich einer Gruppenarbeit zum Thema „Kanak Sprak zwischen Alltag und Medien“ handelt, welche im Rahmen des Hauptseminars Medienlinguistik entstand.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Was ist Kanak Sprak?
- 3. Die Erscheinungsformen des Ethnolekts
- 4. „The Streets“: Der Straßenethnolekt
- 4.1 Die Entwicklung im Ghetto
- 4.2 Sprachliche Merkmale des Straßenethnolekts
- 4.3 Aneignung des Straßenethnolekts
- 4.4 Motive und Kontext der Verwendung
- 5. „The Screens“: Der Mediale Ethnolekt
- 5.1 Sprachliche Merkmale des medialen Ethnolekts
- 5.2 Aneignung des medialen Ethnolekts
- 5.3 Motive und Kontext der Verwendung
- 6. Analyse: „ Hänsel und Gretel auf Türkisch“
- 7. Diskussion und Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und Erscheinungsformen des Ethnolekts „Kanak Sprak“, insbesondere den Unterschied zwischen seiner Verwendung im „Ghetto“ und seiner medialen Stilisierung. Ein zentrales Anliegen ist die Analyse der Aneignung dieses Sprechstils sowohl durch Jugendliche mit türkischem als auch nicht-türkischem Hintergrund. Die Arbeit beleuchtet auch den Einfluss der Mediatisierung auf die Verbreitung und Entwicklung von Kanak Sprak.
- Entwicklung und Definition von Kanak Sprak
- Unterschiede zwischen Straßenethnolekt und Medialem Ethnolekt
- Aneignung von Kanak Sprak durch verschiedene Jugendgruppen
- Der Einfluss der Medien auf die Verbreitung von Kanak Sprak
- Analyse der stilistischen Mittel in der medialen Darstellung von Kanak Sprak
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den gesellschaftlichen Wandel durch Migration und Globalisierung und deren Auswirkungen auf den Sprachgebrauch, insbesondere in deutschen Großstädten mit hohem Migrantenanteil. Sie führt den Begriff „Kanak Sprak“ ein und hebt die Bedeutung der Mediatisierung und deren stilisierende Darstellung in der Comedy hervor, die oft von der sprachlichen Realität abweicht. Die Arbeit fokussiert auf die Grundelemente des ethnolektalen Sprechstils im „Ghetto“ und dessen Erscheinungsform in der Comedy, sowie auf die Aneignung von Türkendeutsch im Alltag.
2. Was ist Kanak Sprak?: Dieses Kapitel definiert Kanak Sprak als eine durch gesellschaftlichen Wandel entstandene Sprachform, die von Standarddeutsch abweicht. Es werden die Migration, Globalisierung und Mediatisierung als wichtige Einflussfaktoren genannt. Charakteristische Merkmale wie gerollte /r/, Koronalisierung des Ich-Lauts, grammatische Vereinfachungen, fehlerhafte Genus- und Verbformen, einfache Satzkonstruktionen, typische Anredeformen und die gehäufte Verwendung von Verstärkungspartikeln werden detailliert beschrieben. Der Kapitel betont die zunehmende Verwendung von Kanak Sprak auch unter Jugendlichen ohne Migrationshintergrund aufgrund sozialer Kontakte und medialer Präsenz.
3. Die Erscheinungsformen des Ethnolekts: Dieses Kapitel untersucht die Entstehung des Ethnolekts Kanak Sprak aus dem Sprachkontakt zwischen Türkisch und Deutsch, im Kontext der Einwanderung von Arbeitsmigranten. Es differenziert zwischen Gastarbeiterdeutsch und Kanak Sprak, obwohl Gemeinsamkeiten bestehen. Auers Modell des Ethnolekts (primärer, sekundärer und tertiärer Ethnolekt) wird eingeführt und erklärt, um die unterschiedlichen Erscheinungsformen und den Prozess der medialen Stilisierung und Rückwirkung auf den alltäglichen Sprachgebrauch zu verdeutlichen. Der Kreislauf „from the streets to the screens and back again“ wird als zentrales Konzept präsentiert.
4. „The Streets“: Der Straßenethnolekt: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entwicklung des Ethnolekts in sozialen Brennpunkten, beleuchtet die sprachliche Entwicklung von Jugendlichen in diesem Kontext und wird im weiteren Verlauf detailliert auf die sprachlichen Merkmale des Straßenethnolekts eingehen, dessen Aneignung und die dahinterliegenden Motive und den Kontext seiner Verwendung. Es legt den Fokus auf den primären Ethnolekt, seine Merkmale und seinen Einfluss auf die Entstehung des sekundären und tertiären Ethnolekts.
Schlüsselwörter
Kanak Sprak, Türkendeutsch, Türkenslang, Ethnolekt, Soziolekt, Migration, Globalisierung, Mediatisierung, Sprachkontakt, Sprachwandel, Jugendsprache, Comedy, „The Streets“, „The Screens“, primärer Ethnolekt, sekundärer Ethnolekt, tertiärer Ethnolekt, Gastarbeiterdeutsch.
Häufig gestellte Fragen zu "Kanak Sprak"
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Ethnolekt "Kanak Sprak", seine Entstehung, Erscheinungsformen und Verbreitung. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Unterschied zwischen dem Straßenethnolekt ("The Streets") und dem medialen Ethnolekt ("The Screens") sowie der Aneignung dieses Sprechstils durch Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund.
Was ist "Kanak Sprak"?
"Kanak Sprak" wird als eine durch gesellschaftlichen Wandel (Migration, Globalisierung, Mediatisierung) entstandene Sprachform definiert, die vom Standarddeutschen abweicht. Sie zeichnet sich durch charakteristische Merkmale wie gerollte /r/, Koronalisierung des Ich-Lauts, grammatische Vereinfachungen und die häufige Verwendung von Verstärkungspartikeln aus.
Welche Erscheinungsformen von "Kanak Sprak" werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen dem Straßenethnolekt ("The Streets"), der in sozialen Brennpunkten entsteht, und dem medialen Ethnolekt ("The Screens"), der durch mediale Darstellung (z.B. Comedy) geprägt ist. Es wird das Auersche Modell des Ethnolekts (primärer, sekundärer und tertiärer Ethnolekt) herangezogen, um die unterschiedlichen Erscheinungsformen und den Kreislauf "from the streets to the screens and back again" zu erklären.
Wie wird "Kanak Sprak" angeeignet?
Die Aneignung von "Kanak Sprak" geschieht sowohl durch Jugendliche mit türkischem als auch nicht-türkischem Hintergrund. Soziale Kontakte und die mediale Präsenz spielen dabei eine entscheidende Rolle. Die Arbeit analysiert die Motive und den Kontext der Verwendung in beiden Kontexten.
Welche Rolle spielen die Medien?
Die Medien spielen eine zentrale Rolle bei der Verbreitung und Entwicklung von "Kanak Sprak". Die mediale Stilisierung, oft in Comedy-Formaten, weicht jedoch häufig von der sprachlichen Realität ab. Die Arbeit analysiert den Einfluss der Mediatisierung auf die Verbreitung und Entwicklung von Kanak Sprak und die stilistischen Mittel in der medialen Darstellung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Definition von "Kanak Sprak", Erscheinungsformen des Ethnolekts, "The Streets" (Straßenethnolekt), "The Screens" (Medialer Ethnolekt), Analyse eines Beispiels ("Hänsel und Gretel auf Türkisch") und Diskussion/Schlussfolgerung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Kanak Sprak, Türkendeutsch, Türkenslang, Ethnolekt, Soziolekt, Migration, Globalisierung, Mediatisierung, Sprachkontakt, Sprachwandel, Jugendsprache, Comedy, "The Streets", "The Screens", primärer Ethnolekt, sekundärer Ethnolekt, tertiärer Ethnolekt, Gastarbeiterdeutsch.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Entstehung und Erscheinungsformen von "Kanak Sprak" zu untersuchen, die Unterschiede zwischen dem Straßenethnolekt und dem medialen Ethnolekt herauszuarbeiten und die Aneignung dieses Sprechstils durch verschiedene Jugendgruppen zu analysieren. Der Einfluss der Mediatisierung auf die Verbreitung und Entwicklung von "Kanak Sprak" wird ebenfalls beleuchtet.
- Quote paper
- Natascha Schneider (Author), 2008, "Kanak Sprak" im Alltag. Der Unterschied zwischen direkter Kommunikation und medial stilisierten Sprechweisen des deutsch-türkischen Jugendslangs, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/312500