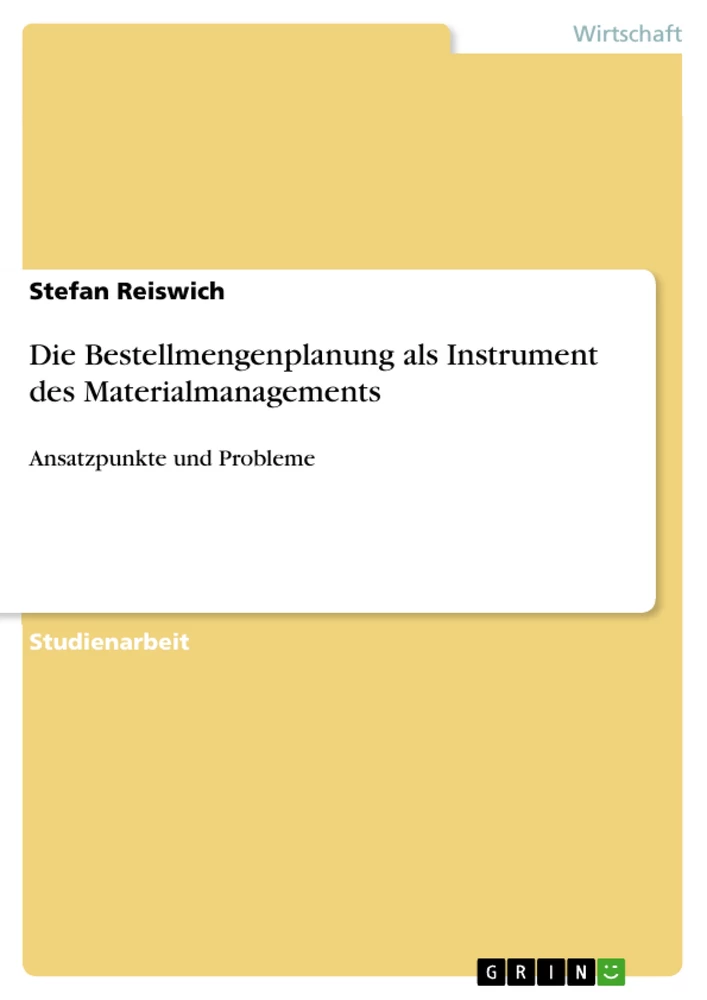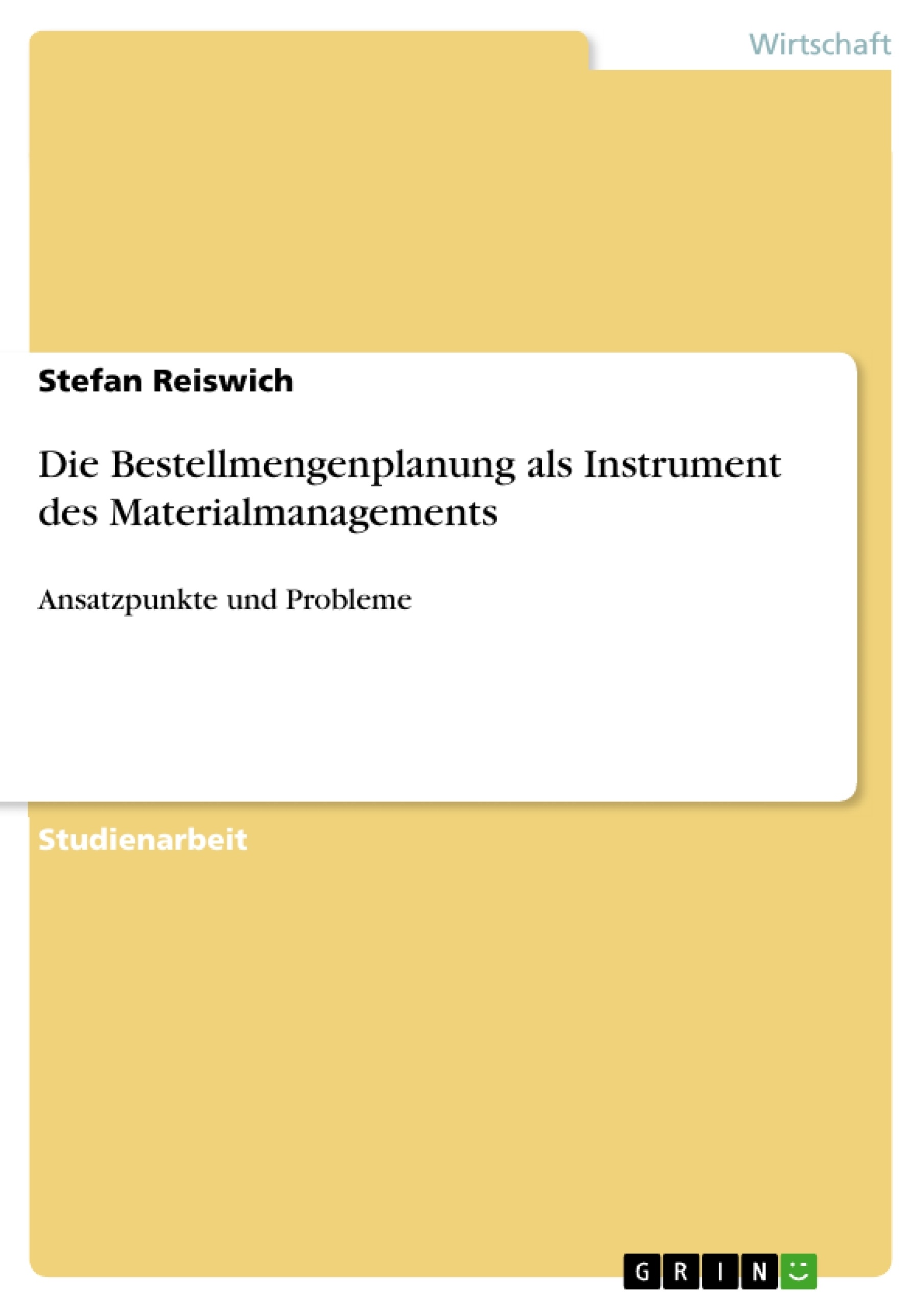Für ein produzierendes Unternehmen, welches für sein zu erzeugendes Endprodukt Materialien von anderen Herstellern benötigt, ist die Bestellmengenplanung ein wichtiges Mittel zur idealen Produktion. Mitarbeiter eines Unternehmens bestellen Materialien, die daraufhin geliefert und weiterverarbeitet werden.
Im Folgenden wird die Bestellmengenplanung als Instrument des Materialmanagements beschrieben. Diese ist von verschiedenen Faktoren wie beispielsweise dem Bedarf, der Höhe des investierbaren Kapitals und den Möglichkeiten der Lagerhaltung abhängig. Die Planung der richtigen Bestellmenge dient überwiegend dazu, Kosten einzusparen, was mithilfe von bestimmten Verfahren möglich ist. Dennoch birgt die Berechnung der optimalen Bestellmenge einige Herausforderungen, auf die im weiteren Verlauf eingegangen wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlagen zur Planung der optimalen Bestellmenge
- 2.1 Bedarfsplanung
- 2.2 Bestandsführung
- 2.3 Materialbeschaffung
- 3 Verfahren zur Bestellmengenplanung
- 4 Probleme
- 5 Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bestellmengenplanung als Instrument des Materialmanagements in produzierenden Unternehmen. Ziel ist es, die Grundlagen der optimalen Bestellmengenplanung zu erläutern und die damit verbundenen Herausforderungen zu beleuchten.
- Grundlagen der Bedarfsplanung
- Optimale Bestandsführung
- Verschiedene Verfahren der Materialbeschaffung (Einzel-, Vorrats- und Fertigungssynchrone Beschaffung)
- Verfahren zur Bestellmengenplanung
- Herausforderungen und Probleme der Bestellmengenplanung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Bestellmengenplanung im Materialmanagement ein und hebt deren Bedeutung für produzierende Unternehmen hervor. Sie betont die Kostenersparnis als Hauptziel und deutet auf die Herausforderungen bei der Berechnung der optimalen Bestellmenge hin.
2 Grundlagen zur Planung der optimalen Bestellmenge: Dieses Kapitel beschreibt die wichtigen vorbereitenden Schritte für die Verfahren der Bestellmengenplanung. Es werden die Bedarfsplanung (programmorientiert und verbrauchsgesteuert), die Bestandsführung (Sicherheitsbestand, Meldebestand, Höchstbestand) und die verschiedenen Arten der Materialbeschaffung (Einzelbeschaffung, Vorratsbeschaffung, fertigungssynchrone Beschaffung) detailliert erläutert. Die jeweiligen Vor- und Nachteile der verschiedenen Beschaffungsmethoden werden gegenübergestellt und deren Einfluss auf die Kostenstruktur des Unternehmens beleuchtet. Der Zusammenhang zwischen Lieferzeiten, Bestandsmanagement und der Wahl des Beschaffungsprinzips wird hervorgehoben.
3 Verfahren zur Bestellmengenplanung: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Verfahren zur Bestimmung der optimalen Bestellmenge und des optimalen Bestellzeitpunktes. Es betont den notwendigen Ausgleich zwischen Bestellkosten und Lagerhaltungskosten und die Aufgabe des Materialmanagements, diesen optimal zu gestalten. Obwohl die konkreten Verfahren nicht im Detail beschrieben werden, wird die Notwendigkeit der Kostenoptimierung im Kontext von Bestellhäufigkeit und Lagerbeständen herausgestellt.
Schlüsselwörter
Bestellmengenplanung, Materialmanagement, Bedarfsplanung, Bestandsführung, Materialbeschaffung, Einzelbeschaffung, Vorratsbeschaffung, Fertigungssynchrone Beschaffung, Kostenoptimierung, Lagerhaltungskosten, Bestellkosten.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Bestellmengenplanung
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Bestellmengenplanung im Materialmanagement. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf den Grundlagen der optimalen Bestellmengenplanung und den damit verbundenen Herausforderungen in produzierenden Unternehmen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Grundlagen der Bedarfsplanung (programmorientiert und verbrauchsgesteuert), die Bestandsführung (Sicherheitsbestand, Meldebestand, Höchstbestand) und verschiedene Arten der Materialbeschaffung (Einzel-, Vorrats- und fertigungssynchrone Beschaffung). Es werden verschiedene Verfahren zur Bestellmengenplanung angesprochen, wobei der Ausgleich zwischen Bestellkosten und Lagerhaltungskosten im Mittelpunkt steht. Die Herausforderungen und Probleme der Bestellmengenplanung werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Arten der Materialbeschaffung werden beschrieben?
Das Dokument beschreibt die Einzelbeschaffung, die Vorratsbeschaffung und die fertigungssynchrone Beschaffung. Für jede Methode werden die Vor- und Nachteile und der Einfluss auf die Kostenstruktur des Unternehmens erläutert.
Wie wird die optimale Bestellmenge bestimmt?
Das Dokument beschreibt, dass die Bestimmung der optimalen Bestellmenge und des optimalen Bestellzeitpunkts den Ausgleich zwischen Bestellkosten und Lagerhaltungskosten erfordert. Obwohl die konkreten Verfahren nicht detailliert beschrieben werden, wird die Notwendigkeit der Kostenoptimierung im Kontext von Bestellhäufigkeit und Lagerbeständen hervorgehoben.
Welche Herausforderungen werden im Zusammenhang mit der Bestellmengenplanung genannt?
Das Dokument deutet auf die Herausforderungen bei der Berechnung der optimalen Bestellmenge hin und beleuchtet die Herausforderungen und Probleme der Bestellmengenplanung explizit als einen der Themenschwerpunkte.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter umfassen: Bestellmengenplanung, Materialmanagement, Bedarfsplanung, Bestandsführung, Materialbeschaffung, Einzelbeschaffung, Vorratsbeschaffung, Fertigungssynchrone Beschaffung, Kostenoptimierung, Lagerhaltungskosten, Bestellkosten.
Was ist das Ziel des Dokuments?
Das Ziel ist es, die Grundlagen der optimalen Bestellmengenplanung zu erläutern und die damit verbundenen Herausforderungen zu beleuchten. Es soll ein Verständnis für die Bedeutung der Bestellmengenplanung im Materialmanagement produzierender Unternehmen geschaffen werden.
- Quote paper
- Stefan Reiswich (Author), 2013, Die Bestellmengenplanung als Instrument des Materialmanagements, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/312047