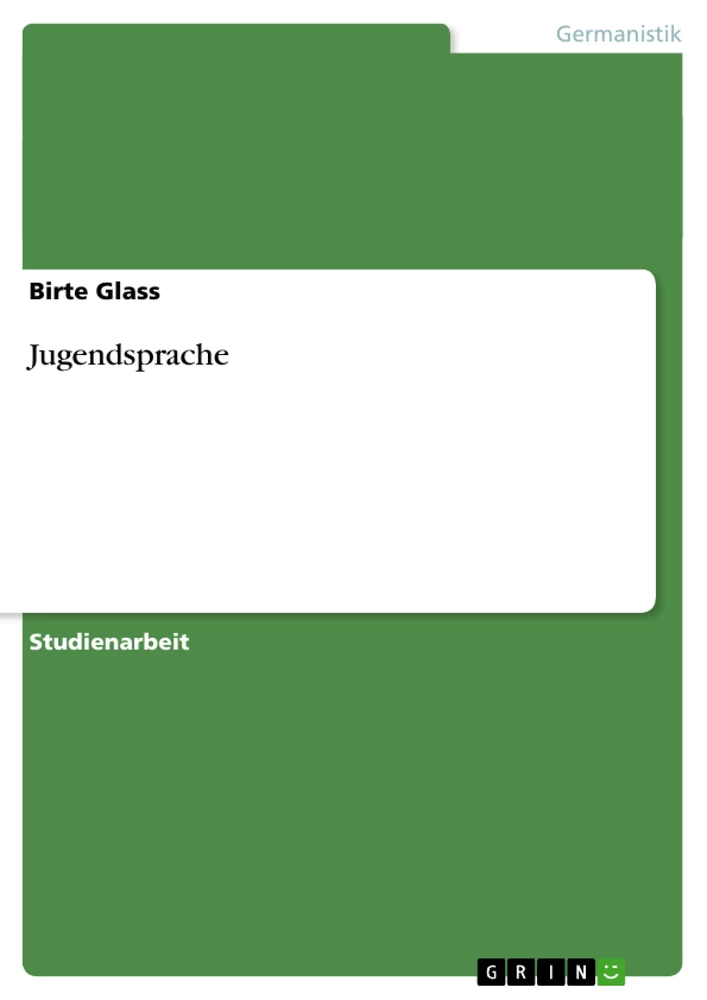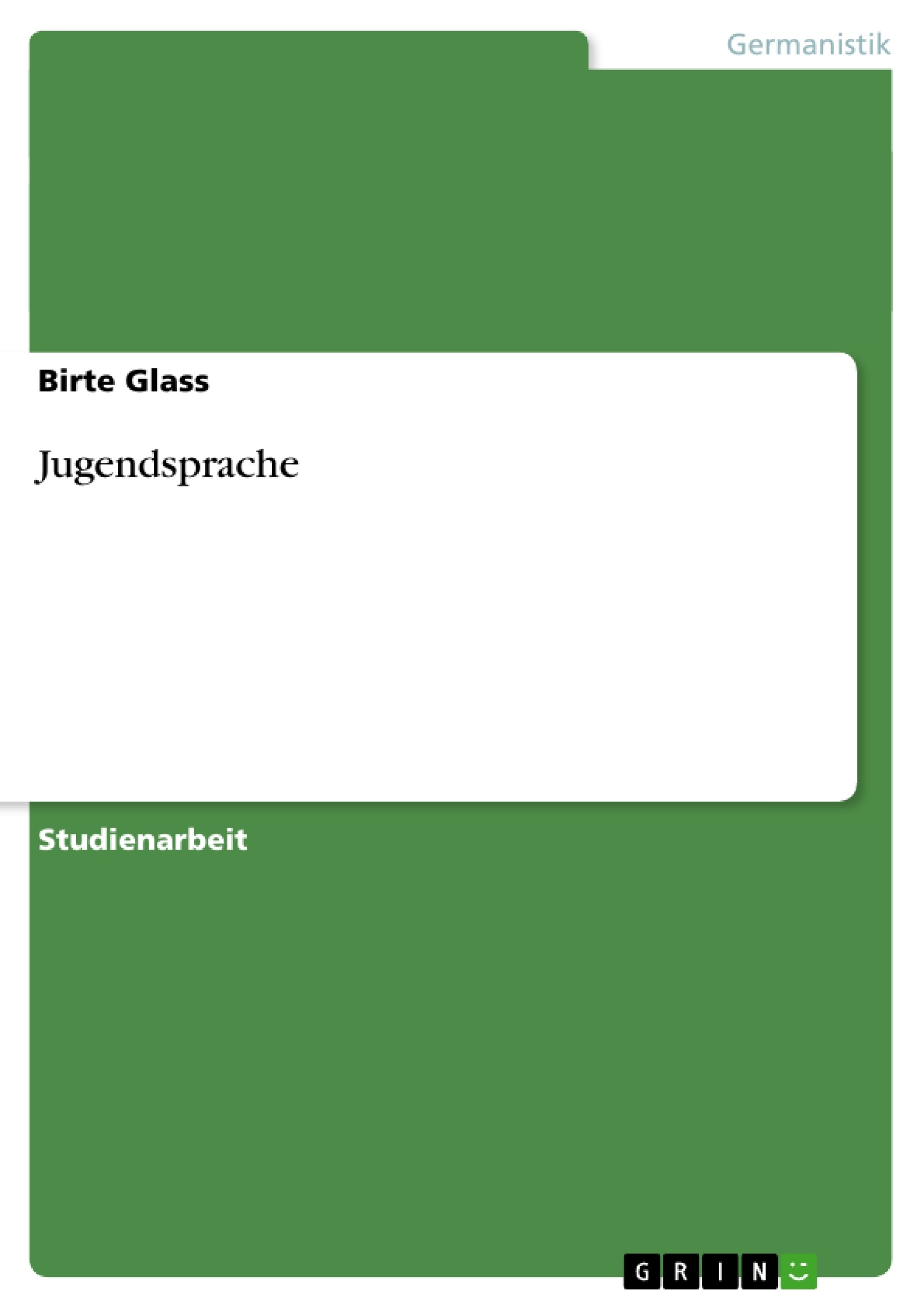‚Analhusten’, ‚Moppelkotze’ ‚Hackfresse’ und ‚Nuttenpfiffi’ – diesen und anderen Ausdrücken begegnet man in PONS „Wörterbuch der Jugendsprache“. Veröffentlichungen dieser Art sind in immer größerer Fülle erschienen mit der angeblichen Absicht Jugendsprache zu erklären. Doch können solche Publikationen herangezogen werden, wenn es darum geht eine Definition von Jugendsprache zu finden? Reicht es aus, die Sprache der Jugend auf einige besonders prägnante und oftmals (insbesondere den Erwachsenen) schockierende Ausdrücke zu reduzieren?
Angelehnt an den Artikel „Jugendsprache und Jugendkultur“ von Peter Schlobinski soll diese Frage thematisiert werden. Dabei wird deutlich, dass Jugendsprache weitaus mehr Faktoren beinhaltet als bloße Ausdrücke und Formeln. Die vorliegende Arbeit gibt Aufschluss über Forschungsansätze und Kritik an diesen, sowie über Vorurteile und Meinungen, die in den letzten Jahren, insbesondere durch die Medien publik wurden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionsversuche
- Jugendsprache als Spielzeug der Medien
- Kritik an populistischen Wörterbüchern
- Kulturverfall durch Jugendsprache?
- Neue Ansätze der Jugendsprachforschung
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den komplexen Begriff der Jugendsprache und hinterfragt gängige Definitionen und Darstellungen in Medien und populärwissenschaftlichen Publikationen. Ziel ist es, ein differenziertes Bild der Jugendsprache zu zeichnen und die Grenzen vereinfachender Interpretationen aufzuzeigen.
- Definition und Abgrenzung von Jugendsprache
- Der Einfluss der Medien auf das Verständnis von Jugendsprache
- Kritik an populistischen Wörterbüchern und deren Vereinfachungen
- Die Rolle von Jugendsprache in der Gesellschaft und die damit verbundenen Vorurteile
- Neue Forschungsansätze in der Jugendsprachforschung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Jugendsprache ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach einer adäquaten Definition in den Mittelpunkt. Ausgehend von Beispielen aus einem Jugendsprachwörterbuch wird die Problematik einer Reduktion auf einzelne, oft schockierende Ausdrücke hervorgehoben. Der Artikel von Peter Schlobinski dient als Grundlage für die weitere Auseinandersetzung mit dem Thema.
Definitionsversuche: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Definitionen von Jugendsprache, insbesondere den Ansatz von Helmut Henne, der Jugendsprache als spezifische Sprech- und Schreibweise zur Sprachprofilierung und Identitätsfindung beschreibt. Es wird jedoch auch die Komplexität des Phänomens betont, da Jugendliche je nach Kontext und Kommunikationspartner unterschiedliche Sprechweisen verwenden. Die Schwierigkeit, anhand der Sprache allein Jugendlichkeit festzumachen, wird ebenfalls thematisiert, ebenso wie der Einfluss der Medien auf das Bild von Jugendsprache.
Jugendsprache als Spielzeug der Medien: Dieses Kapitel befasst sich mit der medialen Darstellung und Funktionalisierung von Jugendsprache, insbesondere seit den 1980er Jahren. Am Beispiel von Bestsellern wie „Laß uns mal ne Schnecke angraben“ und „affengeil. Ein Lexikon der Jugendsprache“ wird die Kritik an der oft oberflächlichen und vereinfachenden Darstellung der Jugendsprache geübt. Es wird argumentiert, dass diese Werke oft auf ungeprüften Quellen basieren und die Komplexität von Jugendsprache nicht angemessen wiedergeben. Die Werbung nutzt diese Lexika, um Jugendliche gezielter anzusprechen.
Kritik an populistischen Wörterbüchern: Dieses Kapitel vertieft die Kritik an populistischen Wörterbüchern zur Jugendsprache. Der Hauptkritikpunkt liegt in der mangelnden Beteiligung der Autoren am Alltagsleben der Jugendlichen und der daraus resultierenden Unfähigkeit, die Komplexität der Sprache angemessen darzustellen. Die Bücher basieren oft auf anekdotischen Beweisen anstatt auf fundierter sprachwissenschaftlicher Forschung.
Schlüsselwörter
Jugendsprache, Sprachprofilierung, Identitätsfindung, Medien, Populärwissenschaft, Wörterbücher, Forschungsansätze, Vorurteile, Kommunikation, Jugendkultur.
Häufig gestellte Fragen zu: Jugendsprache - Eine Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den komplexen Begriff der Jugendsprache und hinterfragt gängige Definitionen und Darstellungen in Medien und populärwissenschaftlichen Publikationen. Ziel ist es, ein differenziertes Bild der Jugendsprache zu zeichnen und die Grenzen vereinfachender Interpretationen aufzuzeigen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Themen: Definition und Abgrenzung von Jugendsprache, der Einfluss der Medien auf das Verständnis von Jugendsprache, Kritik an populistischen Wörterbüchern und deren Vereinfachungen, die Rolle von Jugendsprache in der Gesellschaft und die damit verbundenen Vorurteile sowie neue Forschungsansätze in der Jugendsprachforschung.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit ist in folgende Kapitel gegliedert: Einleitung: Einführung in das Thema und die Problematik vereinfachender Darstellungen. Definitionsversuche: Analyse verschiedener Definitionen von Jugendsprache, u.a. der Ansatz von Helmut Henne. Jugendsprache als Spielzeug der Medien: Die mediale Darstellung und Funktionalisierung von Jugendsprache, Kritik an oberflächlichen Darstellungen in populären Jugendsprachwörterbüchern. Kritik an populistischen Wörterbüchern: Vertiefung der Kritik an populistischen Wörterbüchern aufgrund mangelnder wissenschaftlicher Fundierung. Resümee: Zusammenfassung der Ergebnisse.
Welche Kritikpunkte werden an populistischen Jugendsprachwörterbüchern geübt?
Die Hauptkritikpunkte an populistischen Wörterbüchern sind die mangelnde Beteiligung der Autoren am Alltagsleben der Jugendlichen und die daraus resultierende Unfähigkeit, die Komplexität der Sprache angemessen darzustellen. Die Bücher basieren oft auf anekdotischen Beweisen anstatt auf fundierter sprachwissenschaftlicher Forschung. Die Vereinfachung und oft schockierende Auswahl der Wörter verzerren das Bild der tatsächlichen Jugendsprache.
Welche Rolle spielen Medien im Zusammenhang mit Jugendsprache?
Die Medien spielen eine bedeutende Rolle bei der Darstellung und Funktionalisierung von Jugendsprache. Oftmals werden vereinfachte und oberflächliche Bilder vermittelt, die die Komplexität des Phänomens nicht angemessen widerspiegeln. Die Werbung nutzt diese vereinfachten Darstellungen, um Jugendliche gezielter anzusprechen.
Welche Schlüsselwörter kennzeichnen die Arbeit?
Die Arbeit wird durch folgende Schlüsselwörter charakterisiert: Jugendsprache, Sprachprofilierung, Identitätsfindung, Medien, Populärwissenschaft, Wörterbücher, Forschungsansätze, Vorurteile, Kommunikation, Jugendkultur.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, ein differenziertes Bild der Jugendsprache zu zeichnen und die Grenzen vereinfachender Interpretationen aufzuzeigen. Sie will gängige Definitionen und Darstellungen hinterfragen und zu einem fundierteren Verständnis von Jugendsprache beitragen.
- Quote paper
- Birte Glass (Author), 2004, Jugendsprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/31189