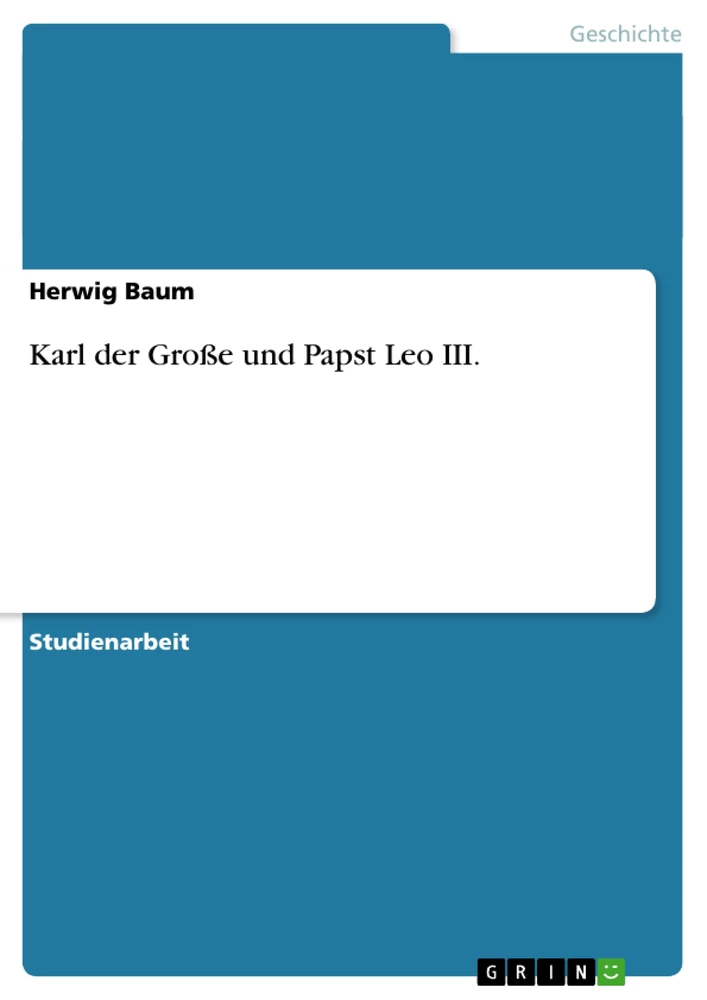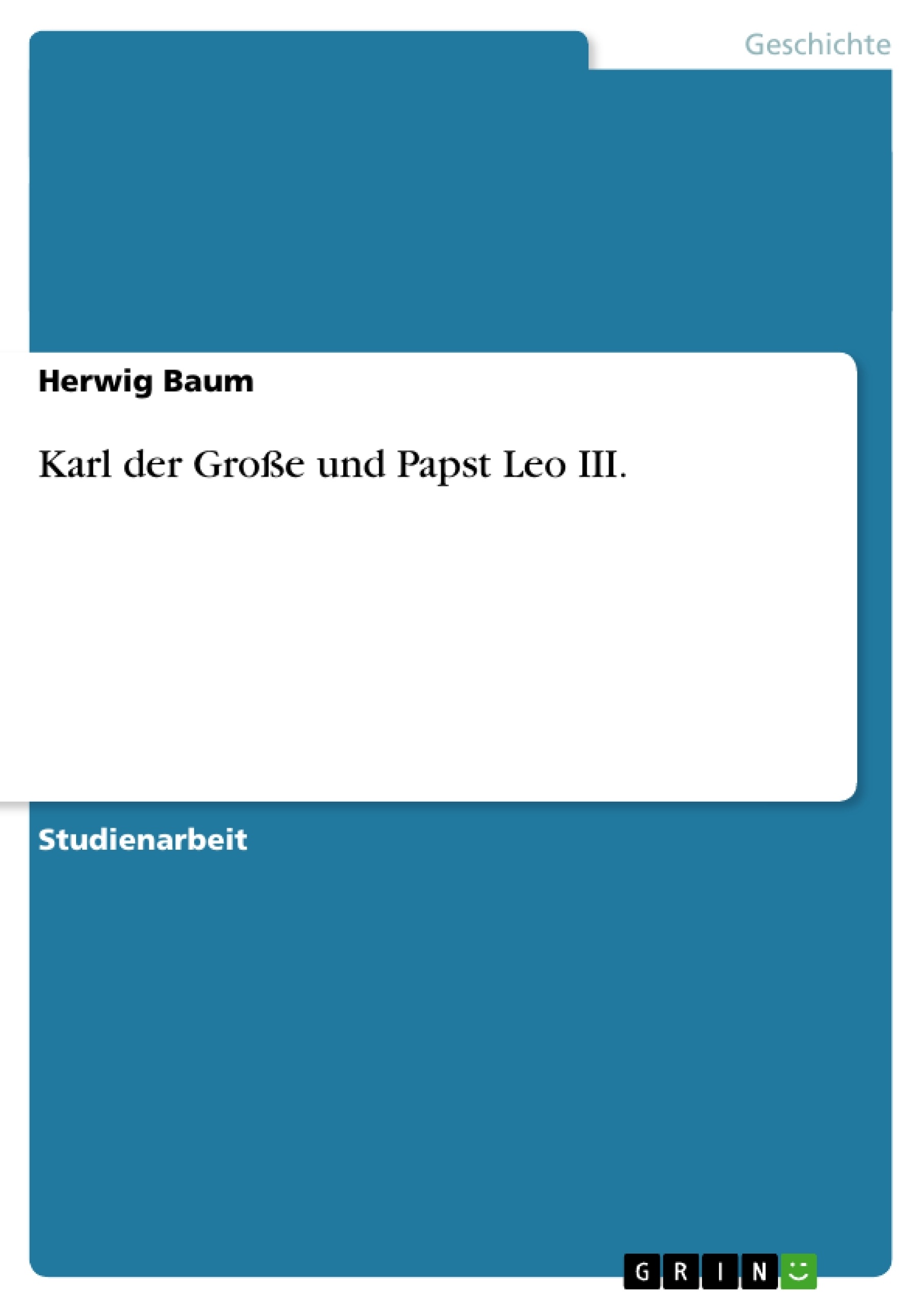Als Karl der Große am Weihnachtstag des Jahres 800 zum Kaiser gekrönt wurde, stellte dies einen Kulminationspunkt einer bereits Tradition gewordenen Allianz dar: Bereits zwei Menschenalter vorher waren zwischen den Repräsentanten des austrischen Adelshauses der Karolinger sowie den römischen Bischöfen besondere Beziehungen geknüpft worden.
Die auf dieser Basis gelieferte gegenseitige Unterstützung sollte eine enorme Rolle beim Aufstieg beider genannter Institutionen spielen. So gelang es nicht nur den Karolingern aufgrund des eingeholten Responsums des Papstes Zacharias im Jahre 751 die Merowinger vom fränkischen Königsthron zu verdrängen, auch bei der tatsächlichen Durchsetzung der karolingischen Königsgewalt, wie der Einebnung lokaler Sonderherrschaften, wie sie im zerbröckelnden Merowingerreich entstanden waren, spielte die päpstliche Hilfe eine Rolle.
Andererseits hatte auch das Papsttum von der Unterstützung durch die Franken immer wieder profitiert: Nicht nur bildete die Pippinische Schenkung des Jahres 754 die Grundlage des späteren Kirchenstaates, sondern auch hatten die Italienfeldzüge Pippins der Jahre 754 und 756 sowie die 774 durch Karl vorgenommene Eroberung des Langobardenreiches das Papsttum von einer existentiellen Bedrohung befreit.
Letztendlich erscheint die Erringung einer Machtposition, wie sie das Papsttum später innehaben sollte, ohne die Verbindung mit den Frankenherrschern (und später den deutschen Kaisern als deren Rechtsnachfolgern), als ausgeschlossen.
Wie bereits erwähnt, stellten die Ereignisse des 25.12.800 einen Höhepunkt im Zusammenwirken beider Kräfte dar.
Die Darstellung der rechtlichen Grundlagen, der Vorgeschichte sowie der unmittelbaren Folgen der Kaiserkrönung sind Thema dieser Seminararbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Erhebung Karls des Großen zum Kaiser
- Rechtliche Grundlagen des Verhältnisses zwischen Frankenkönig und Papst
- Die Vorgeschichte der Kaiserkrönung: Der Putsch in Rom
- Die Krönung
- Das Nachspiel: Der Konflikt mit Byzanz und die Anerkennung des abendländischen Kaisertums durch Ostrom
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Kaiserkrönung Karls des Großen im Jahr 800. Ziel ist es, die rechtlichen Grundlagen, die Vorgeschichte und die unmittelbaren Folgen dieses Ereignisses zu beleuchten und das komplexe Verhältnis zwischen dem Frankenkönig und dem Papsttum zu analysieren.
- Das Verhältnis zwischen Frankenkönigen und Päpsten im Frühmittelalter
- Die rechtlichen Grundlagen der Kaiserkrönung Karls des Großen
- Die politische Bedeutung der Kaiserkrönung für das Papsttum und das Frankenreich
- Der Konflikt mit Byzanz nach der Kaiserkrönung
- Die Rolle von Papst Leo III. bei der Kaiserkrönung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die langjährige Allianz zwischen den Karolingern und den römischen Bischöfen, die eine entscheidende Rolle beim Aufstieg beider Institutionen spielte. Sie erwähnt die Unterstützung des Papstes Zacharias für die Absetzung der Merowinger und die päpstliche Hilfe bei der Konsolidierung der karolingischen Herrschaft, beispielsweise Hadrians I. Ablehnung einer Vermittlung im Konflikt Karls des Großen mit dem bayerischen Herzog Tassilo III. Das Papsttum profitierte von der Unterstützung der Franken, insbesondere durch die Pippinische Schenkung und die Eroberung des Langobardenreiches durch Karl, die das Papsttum von existentiellen Bedrohungen befreite. Die Arbeit konzentriert sich auf die rechtlichen Grundlagen, die Vorgeschichte und die Folgen der Kaiserkrönung Karls des Großen.
Die Erhebung Karls des Großen zum Kaiser: Dieses Kapitel analysiert zunächst die rechtlichen Grundlagen des Verhältnisses zwischen Frankenkönig und Papst. Es beleuchtet die Wahl Leos III. zum Papst und dessen Bemühungen, das Bündnis mit Karl dem Großen zu erneuern, möglicherweise aufgrund einer angespannten Sicherheitslage in Rom. Das Kapitel diskutiert den wechselseitigen Eid zwischen Hadrian I. und Karl und die Auffassung, dass das Bündnis zwischen dem apostolischen Stuhl und den Frankenkönigen eher personal als institutionell war. Die Erneuerung dieses Bündnisses zwischen Karl und Leo wird im Detail behandelt, inklusive der Bedeutung des „foedus fidei et caritatis“. Der Rechtszustand dieser Vereinbarung wird mit anderen historischen Beispielen verglichen und von anderen, weniger personalen, Bündnissen zwischen Frankenkönigen und der römischen Kirche unterschieden. Schließlich wird die Urkunde von Quierzy aus dem Jahr 754 und die darin festgehaltenen Schutz- und Territorialversprechen König Pippins an Papst Stephan II. im Kontext der Beziehung zwischen Frankenkönigen und dem Papsttum betrachtet.
Schlüsselwörter
Karl der Große, Papst Leo III., Kaiserkrönung, 800, Frankenreich, Papsttum, Rechtliche Grundlagen, Bündnis, Byzanz, Hadrian I., Pippinische Schenkung, foedus fidei et caritatis, amicitia.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Die Kaiserkrönung Karls des Großen
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Kaiserkrönung Karls des Großen im Jahr 800. Im Fokus stehen die rechtlichen Grundlagen, die Vorgeschichte und die unmittelbaren Folgen dieses Ereignisses sowie die Analyse des komplexen Verhältnisses zwischen dem Frankenkönig und dem Papsttum.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt das Verhältnis zwischen Frankenkönigen und Päpsten im Frühmittelalter, die rechtlichen Grundlagen der Kaiserkrönung, die politische Bedeutung der Krönung für das Papsttum und das Frankenreich, den Konflikt mit Byzanz nach der Krönung und die Rolle von Papst Leo III. bei der Kaiserkrönung.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel über die Erhebung Karls des Großen zum Kaiser (einschließlich der rechtlichen Grundlagen, der Vorgeschichte mit dem Putsch in Rom und der Krönung selbst) und ein Kapitel zum Nachspiel, also dem Konflikt mit Byzanz und der Anerkennung des abendländischen Kaisertums durch Ostrom.
Was wird in der Einleitung der Seminararbeit beschrieben?
Die Einleitung beschreibt die langjährige Allianz zwischen den Karolingern und den römischen Bischöfen, deren Bedeutung für den Aufstieg beider Institutionen hervorgehoben wird. Sie erwähnt die Unterstützung des Papstes Zacharias bei der Absetzung der Merowinger und die päpstliche Hilfe bei der Konsolidierung der karolingischen Herrschaft (z.B. Hadrians I. Ablehnung einer Vermittlung im Konflikt mit Herzog Tassilo III.). Der Nutzen des Papsttums durch die Unterstützung der Franken (Pippinische Schenkung, Eroberung des Langobardenreiches) wird ebenfalls thematisiert. Der Fokus der Arbeit auf die rechtlichen Grundlagen, die Vorgeschichte und die Folgen der Kaiserkrönung wird klargestellt.
Was ist der Inhalt des Kapitels "Die Erhebung Karls des Großen zum Kaiser"?
Dieses Kapitel analysiert die rechtlichen Grundlagen des Verhältnisses zwischen Frankenkönig und Papst, die Wahl Leos III. und dessen Bemühungen um die Erneuerung des Bündnisses mit Karl dem Großen. Es beleuchtet den wechselseitigen Eid zwischen Hadrian I. und Karl, die Natur des Bündnisses (personal vs. institutionell), die Erneuerung des Bündnisses zwischen Karl und Leo, die Bedeutung des „foedus fidei et caritatis“, und vergleicht den Rechtszustand dieser Vereinbarung mit anderen historischen Beispielen. Die Urkunde von Quierzy (754) und die darin festgehaltenen Schutz- und Territorialversprechen werden im Kontext der Beziehung zwischen Frankenkönigen und dem Papsttum betrachtet.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Karl der Große, Papst Leo III., Kaiserkrönung, 800, Frankenreich, Papsttum, Rechtliche Grundlagen, Bündnis, Byzanz, Hadrian I., Pippinische Schenkung, foedus fidei et caritatis, amicitia.
Welche Quellen werden in der Seminararbeit verwendet? (Diese Frage kann nur beantwortet werden, wenn die Quellen im HTML-Code der ursprünglichen Anfrage enthalten wären)
Diese Information ist in dem bereitgestellten HTML-Code nicht enthalten.
- Quote paper
- Herwig Baum (Author), 2000, Karl der Große und Papst Leo III., Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/31073