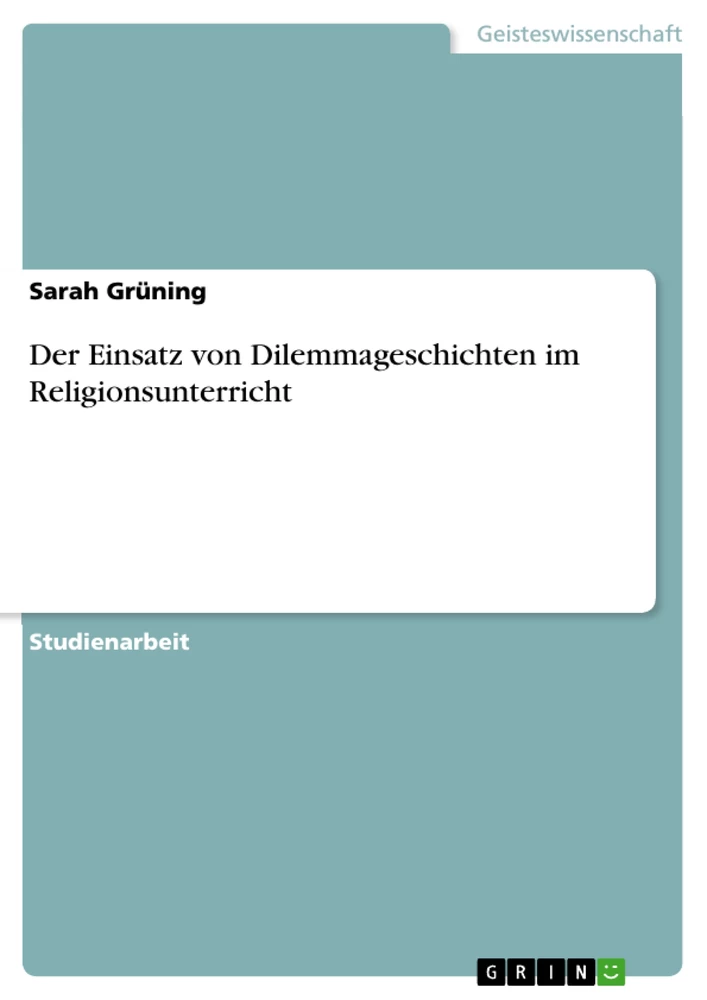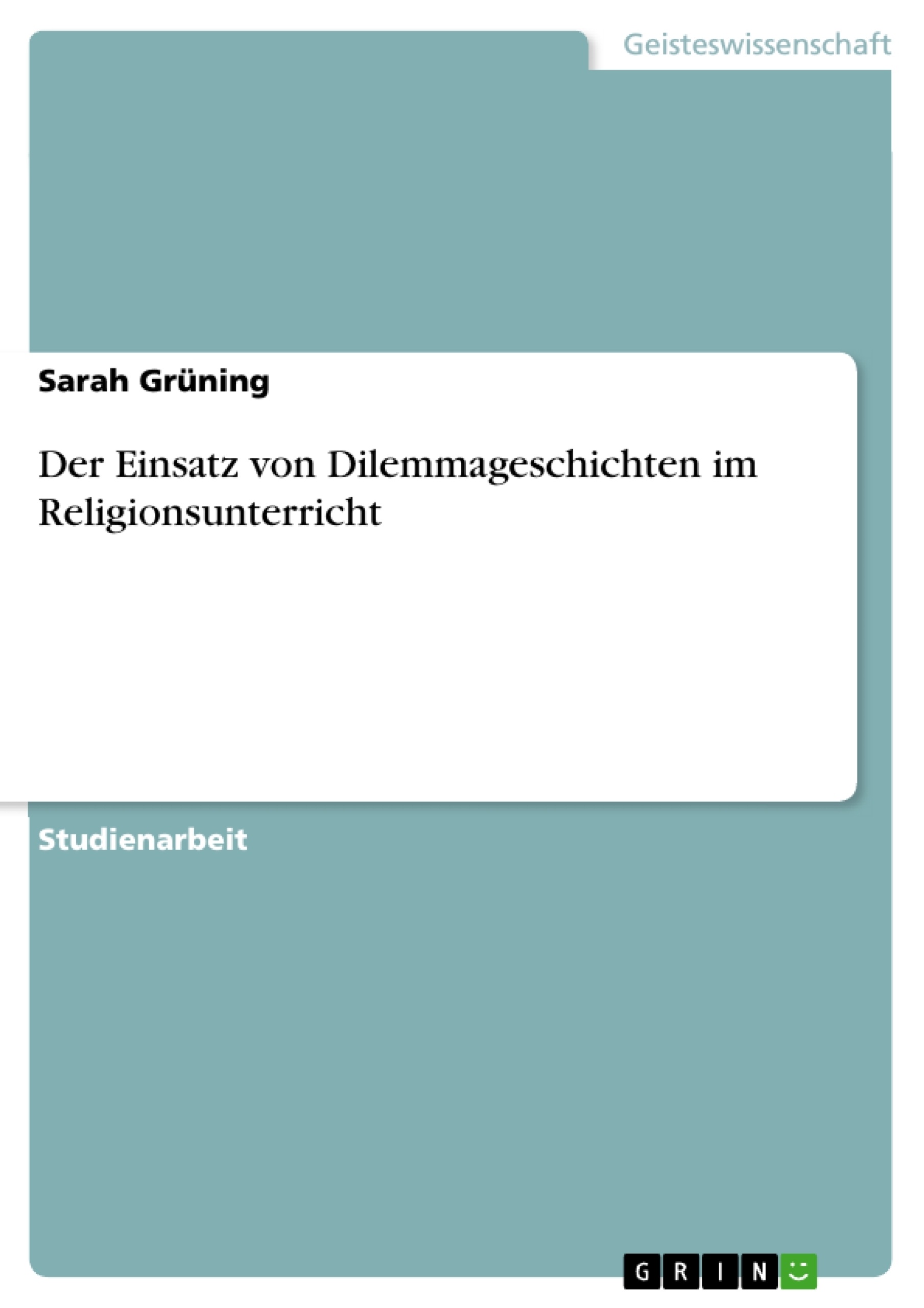Die Abhandlung behandelt die Frage, ob es sinnvoll ist, Dilemmageschichten im Religionsunterricht einzusetzen. Fast täglich muss der Mensch Entscheidungen treffen, die das Leben mehr oder minder beeinflussen. Oftmals finden wir darunter Situationen, welche als unangenehm erscheinen, in denen dennoch zwischen „Gut und Böse“, „Recht und Unrecht“ bestimmt werden muss. Gelegentlich scheint es, dass wir unsere Entscheidungen anzweifeln, den einen „richtigen“ oder „falschen“ Weg gegangen zu sein. Aus dieser schier ausweglosen Zwangslage gibt es meist keine Lösung, welche nicht Vor- oder Nachteile mit sich zieht.
Diese moralischen Zwickmühlen, auch bekannt als Dilemmata, beeinflussen uns in vielen Alltagslagen, deren Auseinandersetzung unumgänglich scheint. Es bedarf der Fähigkeit eines Umgangs mit jenen Ausweglosigkeiten, indem zwischen Werten abgewägt wird, um anschließend zu einer argumentativ begründeten Entscheidung zu gelangen. Zweifellos lassen sich regelmäßig moralische Dilemmata in der Institution Schule vorfinden. Vor allem in einer Klassengemeinschaft werden die Schülerinnen und Schüler fast täglich mit Konfliktsituationen konfrontiert, die zu bewältigen sind.
In der nachfolgenden Abhandlung soll untersucht werden, ob es sinnvoll ist Dilemmageschichten im Religionsunterricht einzusetzen, damit die moralische Urteilskraft der Kinder gesteigert und ein selbständiges Denken, Entscheiden und Handeln ermöglicht wird. Vorab wird zunächst der Begriff Dilemma erklärt. Nachfolgend wird die Dilemma-Methode aufgezeigt. Diese umfasst: wichtige Vertreter, die sechs Stufen der Moralentwicklung nach Lawrence Kohlberg, den darauf aufbauenden Bereich der religiösen Stufentheorien von Oser/Gmünder sowie den Inhalt und die Struktur einer Dilemma-Methode. Hiernach wird eine mögliche Dilemma-Stunde für den Religionsunterricht dargestellt und anschließend eine praxisbezogene Interview-Form nach Kohlberg aufgezeigt. Hierbei sollen sich drei zufällig ausgewählte Probanden zu einer Dilemmageschichte positionieren und ihren Standpunkt argumentativ (unter Berücksichtigung einer Fragestellung) darlegen . Daraufhin werden die Aussagen der Testpersonen, den Urteilsstufen der Moralentwicklung nach L. Kohlberg zugewiesen und ausgewertet. Abschließend wird in einem Fazit die Anfangsfrage aufgegriffen und mögliche Ergebnisse, die für oder gegen einen Einsatz von Dilemmageschichten im Religionsunterricht sprechen, aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Begriffserklärung – Dilemma
- Die Dilemma-Methode
- Wichtige Vertreter
- Die sechs Stufen der Moralentwicklung nach Lawrence Kohlberg
- Religiöse Stufentheorien nach Oser/Gmünder
- Inhalt und Struktur der Dilemma-Methode
- Durchführung einer Dilemma-Stunde für den Religionsunterricht
- Interview zu einer Dilemmageschichte
- Dilemmageschichte: „Großvater überfällt eine Bank für seine kranke Enkelin“
- Fragestellungen zu der Dilemmageschichte
- Interview von drei ausgewählten Probanden
- Probandin 1. Katharina P. 14 Jahre, Schülerin:
- Probandin 2. Daniela N. 24 Jahre, Studentin:
- Proband 3. Andre K. 19 Jahre, Schüler:
- Zuordnung der Probanden zu den Urteilsstufen nach Kohlberg
- Interviewauswertung/Schlussfolgerung
- Fazit
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit untersucht die Sinnhaftigkeit des Einsatzes von Dilemmageschichten im Religionsunterricht. Ziel ist es, die moralische Urteilskraft von Schülerinnen und Schülern zu fördern und ein selbstständiges Denken, Entscheiden und Handeln zu ermöglichen. Die Arbeit analysiert die Dilemma-Methode und die sechs Stufen der Moralentwicklung nach Lawrence Kohlberg, sowie deren Anwendung im Religionsunterricht.
- Moralische Urteilsbildung im Religionsunterricht
- Die Dilemma-Methode und ihre Anwendung
- Die sechs Stufen der Moralentwicklung nach Kohlberg
- Religiöse Stufentheorien nach Oser/Gmünder
- Praxisbezogene Interview-Form nach Kohlberg
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Die Einleitung stellt die Problematik des moralischen Entscheidens und die Relevanz von Dilemmata im Alltag dar. Sie führt die Fragestellung der Arbeit ein, welche die Sinnhaftigkeit des Einsatzes von Dilemmageschichten im Religionsunterricht beleuchtet.
- Das Kapitel „Begriffserklärung – Dilemma“ definiert das Konzept des Dilemmas und stellt die Besonderheiten eines moralischen Dilemmas dar.
- Das Kapitel „Die Dilemma-Methode“ präsentiert wichtige Vertreter wie Jean Piaget und Lawrence Kohlberg und deren Beiträge zur Entwicklungstheorie des moralischen Urteils. Es beschreibt die sechs Stufen der Moralentwicklung nach Kohlberg und erklärt die Funktionsweise der Dilemma-Methode.
- Das Kapitel „Durchführung einer Dilemma-Stunde für den Religionsunterricht“ skizziert eine mögliche Unterrichtsstunde mit Dilemmageschichten, um die moralische Urteilskraft der Schülerinnen und Schüler zu fördern.
- Das Kapitel „Interview zu einer Dilemmageschichte“ beschreibt eine praxisbezogene Interview-Form nach Kohlberg. Es präsentiert drei Probanden und ihre Antworten auf eine Dilemmageschichte, welche anschließend den Urteilsstufen der Moralentwicklung nach Kohlberg zugeordnet und ausgewertet werden.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Moralentwicklung, Dilemmageschichten, Religionsunterricht, Lawrence Kohlberg, moralische Urteilskraft, Entscheidungsfindung und selbstständiges Handeln. Die Arbeit befasst sich mit der Anwendung der Dilemma-Methode im Religionsunterricht und untersucht die Auswirkungen auf die moralische Entwicklung der Schülerinnen und Schüler.
- Quote paper
- Sarah Grüning (Author), 2015, Der Einsatz von Dilemmageschichten im Religionsunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/310196