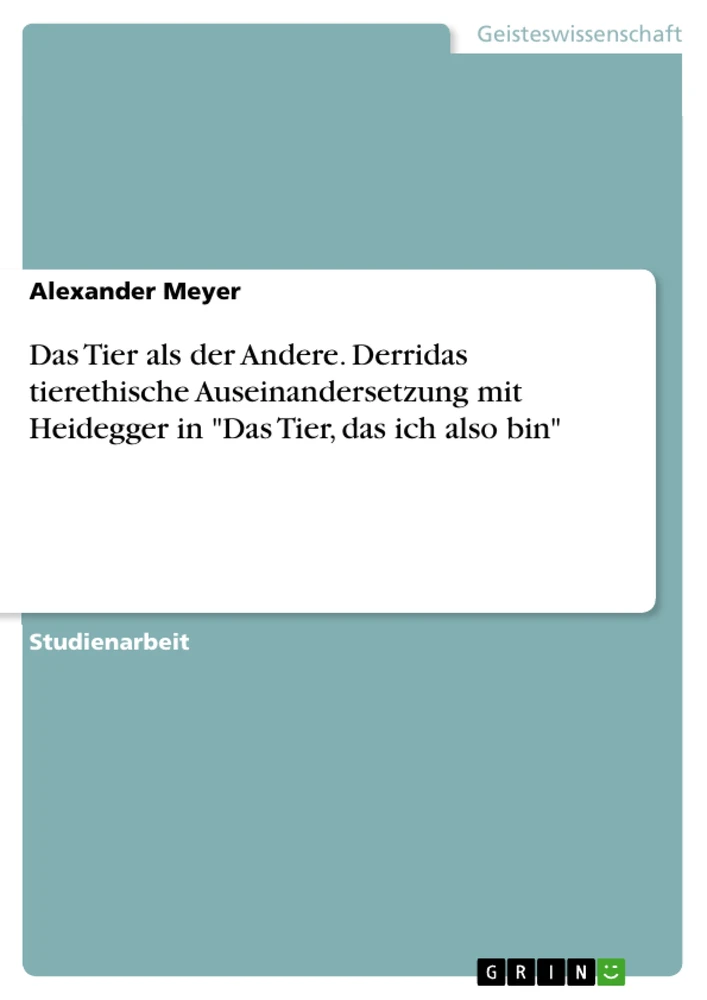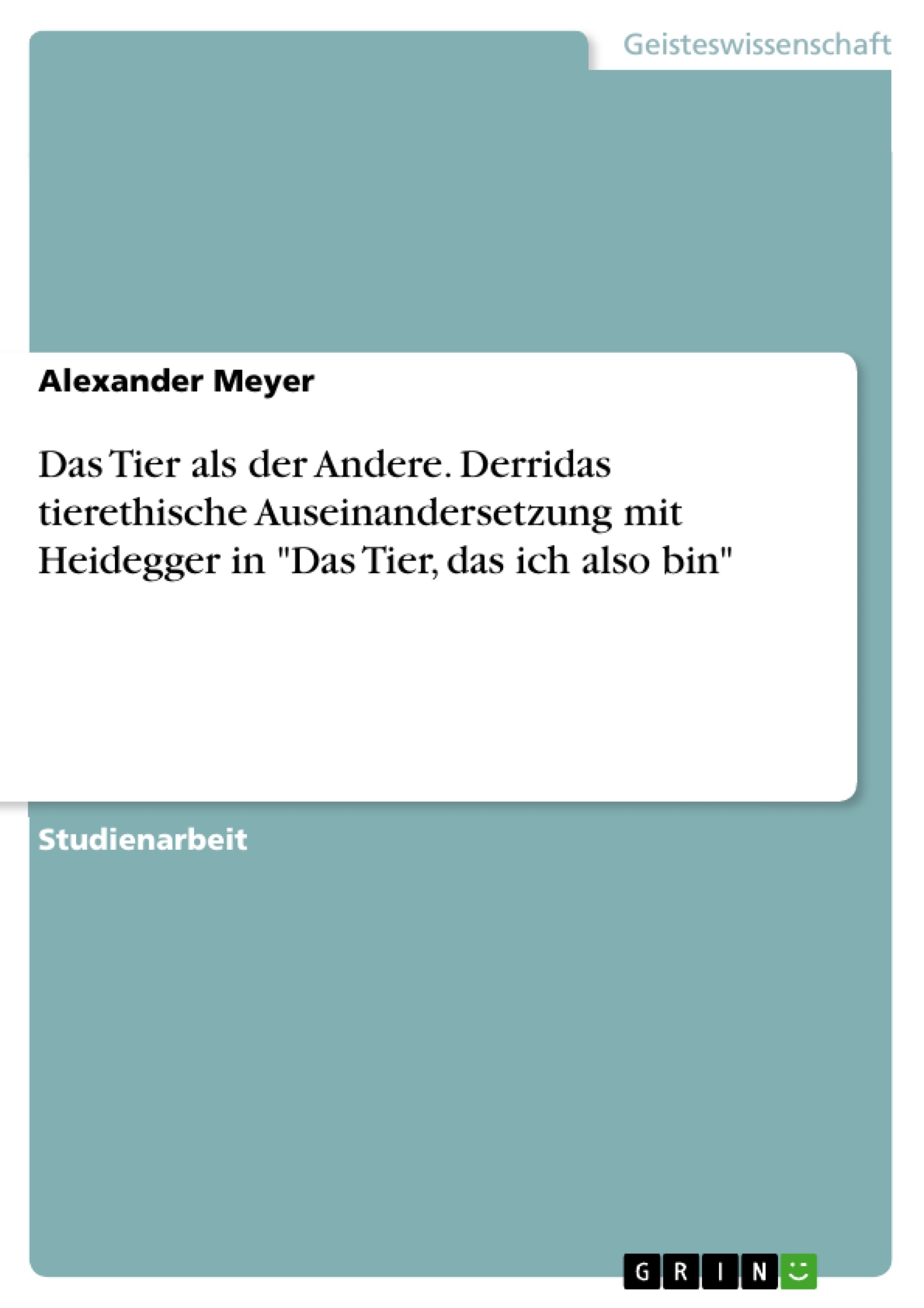Obwohl es viele offensichtliche Gemeinsamkeiten zwischen Mensch und Tier gibt, wird der Mensch in der philosophischen Tradition zumeist als etwas Anderes, als etwas Besonderes bestimmt. Er allein besitze den Logos, also den Verstand und die Sprache. Allerdings kann man sich die Frage stellen, ob der Mensch tatsächlich etwas ganz Anderes als ein Tier ist. Oder ist vielleicht das Tier der ganze Andere? Vielleicht besteht eine Fremdheit zwischen Tier und Mensch, die nicht überwunden werden kann? Die vielleicht gar nicht überwunden werden muss?
Die Tierphilosophie will Antwort auf solche und noch weitere Fragen geben, und hierbei bewegt sie sich zumeist zwischen zwei extremen Positionen. Entweder sie spricht den Tieren menschliche Eigenschaften zu, z.B. Denkvermögen und Sprachfähigkeit, oder aber sie macht die Unterschiede, die neben den vielen Gemeinsamkeiten zwischen Mensch und Tier bestehen, besonders stark.
Letztere Position wird auch von Martin Heidegger in seiner Vorlesung 1929/30 "Die Grundbegriffe der Metaphysik" eingenommen. Diese Vorlesung soll zunächst hinsichtlich der Frage nach dem Tier in einem ersten umfangreicheren Kapitel in dieser Arbeit zur Sprache kommen. In einem zweiten Kapitel soll Jacques Derridas Auseinandersetzung mit Heideggers Weltarmut des Tieres in seinem Text "Das Tier, das ich also bin" thematisiert werden. Hierdurch soll deutlich werden, dass Derrida weder der einen tierphilosophischen Position noch der anderen zuzuordnen ist. Vielmehr wird deutlich werden, dass Derrida das Tier jenseits dieser beiden Positionen verorten möchte, indem er die anthropologische Differenz selbst hinterfragt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Derridas tierethische Auseinandersetzung mit Heidegger
- Hauptteil:
- Heideggers „Welt“: Zur Weltarmut des Tieres
- Derridas Auseinandersetzung mit Heidegger in Das Tier, das ich also bin
- Schluss: Das Tier als der Andere
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit setzt sich mit der tierethischen Auseinandersetzung von Jacques Derrida mit Martin Heidegger auseinander. Sie analysiert Heideggers Konzept der „Weltarmut“ des Tieres in seiner Vorlesung „Die Grundbegriffe der Metaphysik“ und untersucht, wie Derrida in seinem Text „Das Tier, das ich also bin“ diese Position hinterfragt.
- Die Weltarmut des Tieres nach Heidegger
- Derridas Kritik an Heideggers Anthropologie
- Die Bedeutung der „Andersheit“ des Tieres
- Die tierethischen Implikationen von Derridas Analyse
- Die Frage nach der „Fremdheit“ zwischen Tier und Mensch
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Derridas tierethische Auseinandersetzung mit Heidegger
Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: Wie versteht Derrida das Verhältnis zwischen Mensch und Tier und wie setzt er sich kritisch mit Heideggers Sichtweise auseinander? Die Einleitung beleuchtet die beiden gegensätzlichen Positionen in der Tierphilosophie: die Zuschreibung menschlicher Eigenschaften an Tiere und die Betonung der Unterschiede zwischen Mensch und Tier. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit.
2. Hauptteil:
2.1. Heideggers „Welt“: Zur Weltarmut des Tieres
Dieser Abschnitt analysiert Heideggers Konzept der „Weltarmut“ des Tieres, das in seiner Vorlesung „Die Grundbegriffe der Metaphysik“ entwickelt wird. Heidegger argumentiert, dass das Tier im Gegensatz zum Menschen keinen Zugang zur „Welt“ im eigentlichen Sinne hat, sondern nur auf begrenzte Bereiche und Erfahrungen beschränkt ist. Es werden Heideggers drei Thesen (Weltlosigkeit des Steins, Weltarmut des Tieres und Weltbildung des Menschen) vorgestellt und diskutiert. Das Beispiel der Biene veranschaulicht Heideggers Vorstellung von der begrenzten Welt des Tieres.
- Quote paper
- Alexander Meyer (Author), 2014, Das Tier als der Andere. Derridas tierethische Auseinandersetzung mit Heidegger in "Das Tier, das ich also bin", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/309751