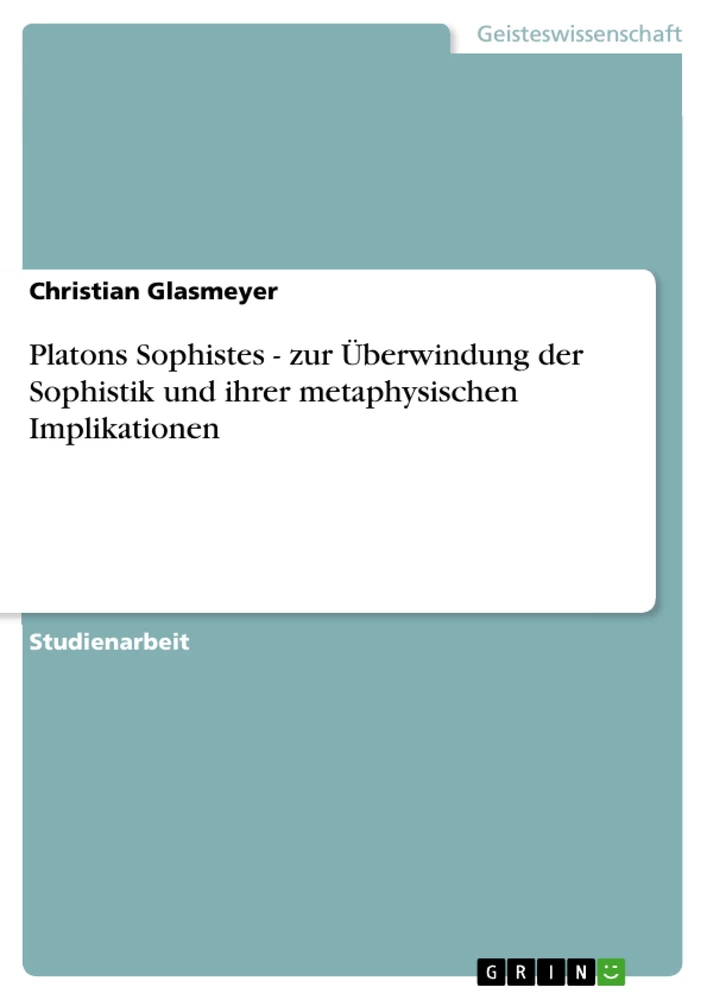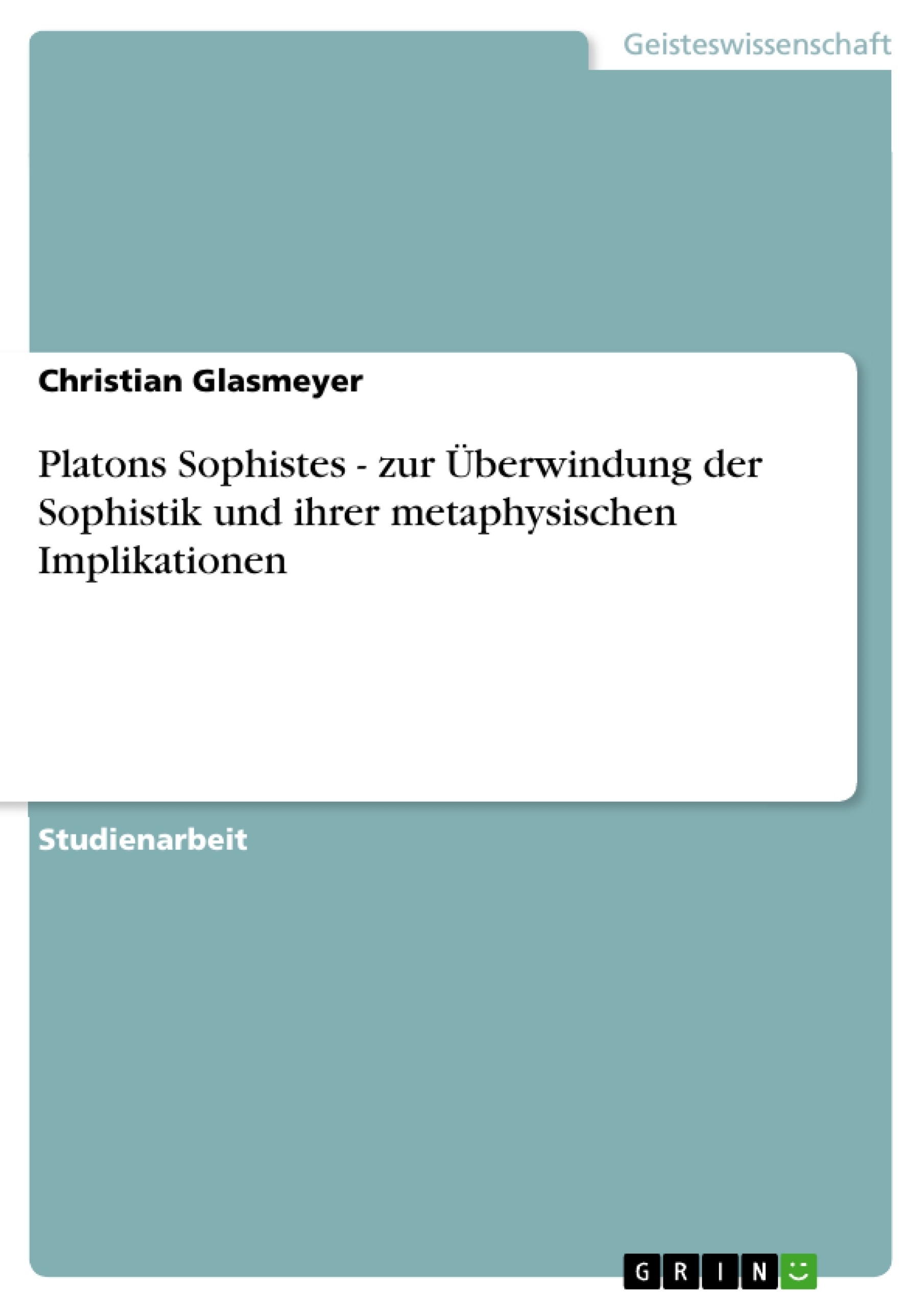Die folgende Arbeit über den „Sophistes“ unternimmt den Versuch, diesen
komplexen Dialog auch im Kontext der in ihm angesprochenen philosophischen Hintergründe zu behandeln. Das Ziel ist die Darstellung des im „Sophistes“ von Platon aufgezeigten Weges, die Sophistik endgültig zu überwinden. Jene ist fest mit den grundlegenden metaphysischen Konzepten und Problemen ihrer Zeit verquickt,
nicht zuletzt wohl dies bescherte ihr die Festigkeit und Widerstandsfähigkeit, die so oft im „Sophistes“ beschworen wird.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Kontexte des „Sophistes“: Theaitetos und Parmenides
- Der „Sophistes“: Schein und Nichtsein
- Sophistik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Platons Dialog „Sophistes“ im Kontext der philosophischen Hintergründe. Ziel ist die Darstellung von Platons Versuch, die Sophistik zu überwinden. Die Arbeit beleuchtet die Verknüpfung der Sophistik mit metaphysischen Konzepten und Problemen der Zeit.
- Die Überwindung der Sophistik durch Platon
- Die Beziehung zwischen Sein und Nichtsein
- Die Rolle des Scheins und des Irrtums
- Der Einfluss von Parmenides und Gorgias
- Die Bedeutung der Dialektik
Zusammenfassung der Kapitel
Kontexte des „Sophistes“: Theaitetos und Parmenides: Dieses Kapitel untersucht die Verbindung zwischen Platons Dialogen „Theaitetos“, „Parmenides“ und „Sophistes“. Es wird die thematische Kontinuität zwischen den Dialogen herausgestellt, insbesondere die Diskussion um Irrtum und Wissen. Der Bezug zum „Theaitetos“ wird erläutert, wobei die aporetische Schlussfolgerung des „Theaitetos“ als Ausgangspunkt für die Überlegungen im „Sophistes“ dient. Der „Parmenides“ wird als Zwischenstück gesehen, das die spätere Klärung des Problems des Nichtseienden im „Sophistes“ vorbereitet, indem er die dialektische Verbindung von Kategorien wie Verschiedenheit, Selbigkeit, Ruhe, Bewegung und Sein andeutet. Die kritische Auseinandersetzung mit Parmenides und Gorgias wird als Grundlage für die Argumentation im „Sophistes“ dargestellt, wobei Platons differenzierte Betrachtungsweise gegenüber Parmenides im Gegensatz zu seiner kritischeren Haltung gegenüber Gorgias hervorgehoben wird. Gorgias' These, dass nichts ist, oder wenn doch, es nicht erkannt oder mitgeteilt werden kann, wird als zentraler Punkt der Kritik dargestellt.
Der „Sophistes“: Schein und Nichtsein: Dieses Kapitel (angenommen, es enthält eine substantielle Diskussion über Schein und Nichtsein im Sophistes selbst) würde eine detaillierte Analyse der platonischen Argumentation im "Sophistes" bezüglich Schein und Nichtsein enthalten. Es würde die zentralen Argumente Platons erläutern und seine Strategie zur Definition des Sophisten und zur Lösung der damit verbundenen ontologischen Probleme analysieren. Die Rolle der Dialektik als Methode zur Überwindung des Scheinwissens und zur Erreichung von Wahrheit würde im Detail dargestellt werden. Die Bedeutung der Unterscheidung zwischen Sein und Nichtsein und die platonische Lösung der Paradoxien, die mit dem Nichtsein verbunden sind, würden eingehend beleuchtet. Die Verknüpfung mit den vorhergehenden Kapiteln über Theaitetos und Parmenides würde verdeutlicht werden, indem gezeigt wird, wie Platons Überlegungen im "Sophistes" auf den vorherigen Diskussionen aufbauen und sie weiterentwickeln.
Sophistik: Dieses Kapitel analysiert die platonische Darstellung der Sophistik. Es unterscheidet zwischen dem vorplatonischen und dem platonischen Verständnis von Sophistik. Der vorplatonische Begriff wird als positiv besetzt beschrieben, der platonische hingegen als negativ, assoziiert mit Scheinwissen und dem Streben nach materiellem Reichtum. Die Rolle der Rhetorik und die Kritik an der moralischen und logischen Konsistenz sophistischer Argumentation werden dargelegt. Die unterschiedliche Gewichtung der Begriffe Logos, Physis und Nomos in der sophistischen Philosophie wird im Vergleich zu anderen philosophischen Richtungen der Zeit beleuchtet, um das Verständnis der platonischen Kritik zu vertiefen.
Schlüsselwörter
Platon, Sophistes, Sophistik, Parmenides, Gorgias, Sein, Nichtsein, Schein, Irrtum, Wahrheit, Dialektik, Logos, Metaphysik, Ontologie.
Platons Sophistes: FAQ
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Platons Dialog „Sophistes“ umfassend. Sie untersucht den Dialog im Kontext der philosophischen Hintergründe, insbesondere im Verhältnis zu Platons Dialogen „Theaitetos“ und „Parmenides“. Ein Schwerpunkt liegt auf Platons Versuch, die Sophistik zu überwinden und die damit verbundenen metaphysischen Probleme zu lösen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie die Überwindung der Sophistik durch Platon, die Beziehung zwischen Sein und Nichtsein, die Rolle von Schein und Irrtum, den Einfluss von Parmenides und Gorgias, und die Bedeutung der Dialektik in Platons Philosophie. Es wird die platonische Kritik an der Sophistik im Hinblick auf Rhetorik, Moral und Logik untersucht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in drei Hauptkapitel gegliedert: „Kontexte des ‚Sophistes‘: Theaitetos und Parmenides“, „Der ‚Sophistes‘: Schein und Nichtsein“, und „Sophistik“. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der relevanten Aspekte des „Sophistes“ und seiner philosophischen Einbettung.
Was wird im Kapitel „Kontexte des ‚Sophistes‘: Theaitetos und Parmenides“ behandelt?
Dieses Kapitel untersucht die Verbindungen zwischen den Dialogen „Theaitetos“, „Parmenides“ und „Sophistes“. Es analysiert die thematische Kontinuität, insbesondere die Diskussion um Irrtum und Wissen, und beleuchtet den Einfluss von Parmenides und Gorgias auf Platons Argumentation im „Sophistes“. Die unterschiedliche Behandlung von Parmenides und Gorgias durch Platon wird hervorgehoben.
Was wird im Kapitel „Der ‚Sophistes‘: Schein und Nichtsein“ behandelt?
Dieses Kapitel analysiert Platons Argumentation im „Sophistes“ bezüglich Schein und Nichtsein. Es erläutert die zentralen Argumente, Platons Strategie zur Definition des Sophisten und die Lösung der ontologischen Probleme. Die Rolle der Dialektik als Methode zur Erreichung von Wahrheit und die Unterscheidung zwischen Sein und Nichtsein werden detailliert dargestellt.
Was wird im Kapitel „Sophistik“ behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die platonische Darstellung der Sophistik, indem es zwischen vorplatonischem und platonischem Verständnis unterscheidet. Es untersucht die Rolle der Rhetorik und kritisiert die moralische und logische Konsistenz sophistischer Argumentation. Der Vergleich der Begriffe Logos, Physis und Nomos in der sophistischen Philosophie mit anderen philosophischen Richtungen wird ebenfalls behandelt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Platon, Sophistes, Sophistik, Parmenides, Gorgias, Sein, Nichtsein, Schein, Irrtum, Wahrheit, Dialektik, Logos, Metaphysik, Ontologie.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für Leser gedacht, die sich mit Platons Philosophie und insbesondere mit dem Dialog „Sophistes“ auseinandersetzen möchten. Sie eignet sich für akademische Zwecke, z.B. im Rahmen von Studienarbeiten oder wissenschaftlichen Recherchen.
- Quote paper
- Christian Glasmeyer (Author), 2000, Platons Sophistes - zur Überwindung der Sophistik und ihrer metaphysischen Implikationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/3095