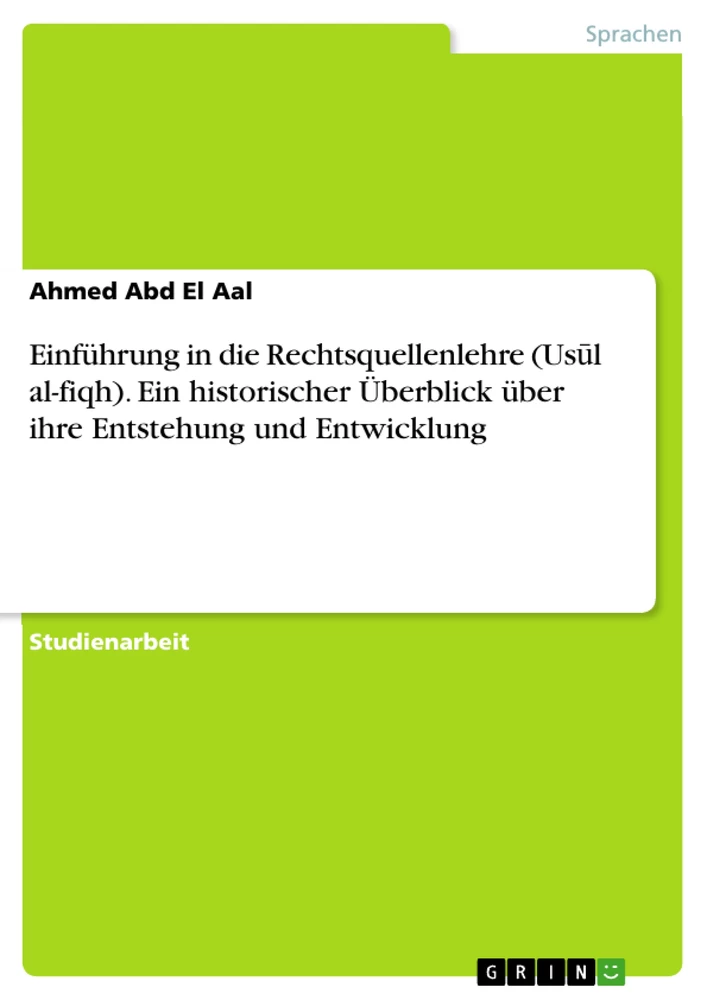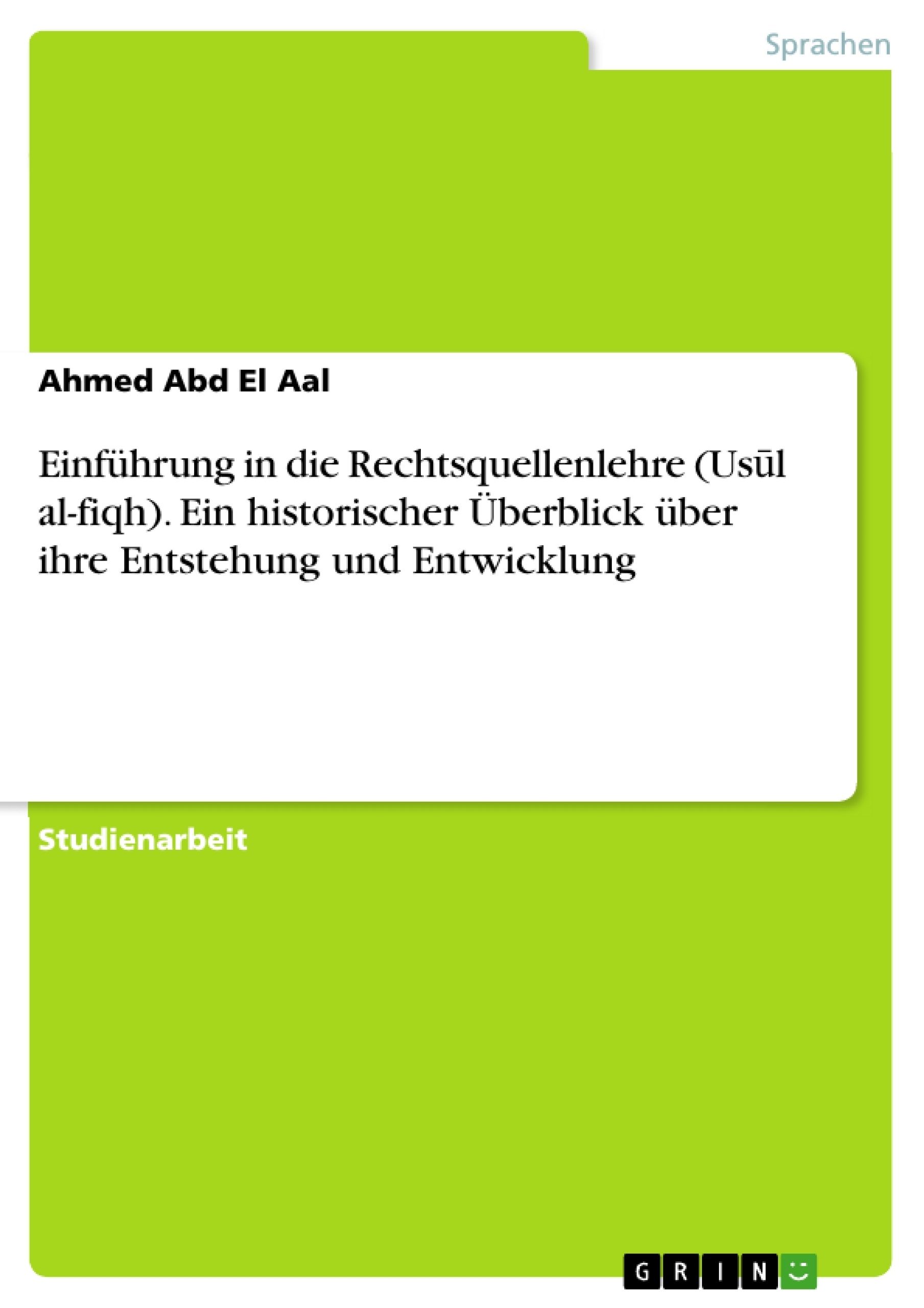Diese Arbeit behandelt die Fragen: Hat Šarī'a (das göttliche Recht) die menschlichen Bedürfnisse erfüllt? Widersprechen die Šarī'a und ihre unterschiedlichen Interpretationen nicht den menschlichen Interessen und Grundwerten? Zudem: Können Koran sowie Sunna (mit einigen Einschränkungen) allein als Hauptquellen der Gesetzgebung die menschlichen Bedürfnisse erfüllen?
Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Frage: Könnten die islamischen Gelehrten ohne gute Kenntnisse über den Usūl al-fiqh begreifen, was Šarī'a eigentlich ist? Um diese Behauptung zu beweisen, muss man den Usūl al-fiqh genauer betrachten.
Das Verständnis des Usūl al-fiqh gehört sowohl im Orient als auch im Okzident bis heute zur zentralen Diskussion der Rechtsbildung und Rechtsgelehrten. Im Rahmen der oben genannten Fragen und gestützt auf diese Ausgangsbasis werden im ersten Teil die zentralen Begriffe wie Šarī'a und Usūl al-fiqh, die immer wieder als Grundlage der islamischen Wissenschaften vorkommen, sowie Fiqh (die Normenlehre), lexikologisch und als Terminus Technicus erläutert.
Dazu sagte Imam ʿAlī (gest. 661): Der Koran, der zwischen zwei Buchdeckeln ist, spreche nicht selbst, sondern sei von Männern ausgesprochen (interpretiert) worden.
Im Fokus dieser Untersuchung steht, hauptsächlich aus sunnitischer Sicht, die Definition der renommierten klassischen Werke und der modernen Lehrbücher. Darauf aufbauend werden im zweiten Teil die wichtigsten Merkmale in der historischen Entwicklung und Periodisierung der Geschichte des Usūl al-fiqh gezeigt. Hierfür sollen wichtige Elemente zur Etablierung der Rechtsschulen und ihre Beziehung zum Usūl al-fiqh dargestellt werden. In der Arbeit wird die tatsächliche Geschichte des Usūl al-fiqh innerhalb der einzelnen Rechtsschulen grundsätzlich verfolgt. Kapitel 4 befasst sich schließlich, in Verbindung mit ihren wichtigsten Gelehrten, mit den Usūl al-fiqh in der schiitischen Rechtsschule. Auffällig ist, dass, im Gegensatz zu anderen Themen wie Theologie und islamischer Geschichte, in der Forschung über Usūl al-fiqh in deutscher Sprache wenig geschrieben wurde.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Die Definition zentraler Begriffe
1.1 Ein Überblick über den Begriff des göttlichen Rechts (Šarīʿa)
1.2 Al-Fiqh (die Normenlehre) als Terminus Technicus
1.3 Usul al-fiqh (die Rechtsquellenlehre)
1.3.1 Uṣūl al-fiqh in der Lexikologie
1.3.2 Uṣūl al-fiqh als Terminus Technicus
2. Die Periodisierung der islamischen Geschichte
3. Eine Übersicht über die Entstehung des Uṣūl al-fiqh im Rahmen der vier Rechtsschulen (al-maḏāhib al-arb‘a)
4. Zwölferschiitischer Uṣūl al-fiqh
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis
Einleitung
Diese Arbeit behandelt die Fragen: Hat Šarīʿa (das göttliche Recht) die menschlichen Bedürfnisse erfüllt? Widerspricht die Šarīʿa und ihre unterschiedlichen Interpretationen nicht den menschlichen Interessen und Grundwerten? Zudem: Können Koran sowie Sunna (mit einigen Einschränkungen) allein als Hauptquellen der Gesetzgebung die menschlichen Bedürfnisse erfüllen?
Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Frage: Könnten die islamischen Gelehrten ohne gute Kenntnisse über den Uṣūl al fiqh, begreifen, was Šarīʿa (das göttliche Recht) eigentlich ist? Um diese Behauptung zu beweisen, muss man den Uṣūl al-fiqh genauer betrachten.
Das Verständnis des Uṣūl al-fiqh gehört sowohl im Orient als auch im Okzident bis heute zur zentralen Diskussion der Rechtsbildung und Rechtsgelehrten.
Im Rahmen der oben genannten Fragen und gestützt auf diese Ausgangsbasis werden im ersten Teil die zentralen Begriffe, wie Šarīʿa (das göttliche Recht), Uṣūl al-fiqh, die immer wieder als Grundlage der islamischen Wissenschaften vorkommen und Fiqh (die Normenlehre), lexikologisch und als Terminus Technicus erläutert.
Dazu sagte Imam ʿAlī (gest. 661): Der Koran, der zwischen zwei Buchdeckeln ist, spreche nicht selbst, sondern sei von Männern ausgesprochen (interpretiert) worden.[1]
Im Fokus dieser Untersuchung steht, hauptsächlich aus sunnitischer Sicht, die Definition der renommierten klassischen Werke und der modernen Lehrbücher.
Darauf aufbauend werden im zweiten Teil die wichtigsten Merkmale in der historischen Entwicklung und Periodisierung der Geschichte des Uṣūl al-fiqh gezeigt.
Hierfür sollen wichtige Elemente zur Etablierung der Rechtsschulen und ihre Beziehung zum Uṣūl al-fiqh dargestellt werden. In der Arbeit wird die tatsächliche Geschichte des Uṣūl al-fiqh innerhalb der einzelnen Rechtsschulen grundsätzlich verfolgt.
Kapitel 4 befasst sich schließlich, in Verbindung mit ihren wichtigsten Gelehrten, mit den Uṣūl al-fiqh in der schiitischen Rechtsschule.
Auffällig ist, dass, im Gegensatz zu anderen Themen wie Theologie und islamischer Geschichte, in der Forschung über Uṣūl al-fiqh in deutscher Sprache wenig geschrieben wurde.
1. Die Definition zentraler Begriffe
Im Folgenden wird eine Darstellung für das Rechtssystem der Šarīʿa, des Fiqh und des Uṣūl al-fiqh festgelegt.[2]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1.1 Ein Überblick über den Begriff des göttlichen Rechts (Šarīʿa)
Über den Begriff Šarīʿa wird noch immer stark debattiert. Die Šarīʿa wurde von vielen Muslimen als den Weg zu Glückseligkeit sowohl im Diesseits als auch im Jenseits angesehen.
Šarīʿa ist die Auslegung des göttlichen Rechts, das im Koran und Sunna des Propheten dargestellt wurde. Trotz dieser offensichtlichen und exklusiven Beziehung zwischen Šarīʿa und göttliches Gesetz, hat das Wort Šarīʿa verwendet worden, um sowohl göttliches Recht sowie islamisches positives Recht insbesondere Fiqh zu beschreiben.[3]
Laut dieser Definition enthält die Šarīʿa unveränderliche Normen, die als Bruchteil der von Gott gegebenen Ordnung betrachtet werden.
Es wäre deutlicher, wenn man dazu die Definition von Picken hier erwähnt:
“Islamic Law remains one of the most intriguing and fascinating disciplines within the field of Islamic studies. Perhaps this is because, as its name suggests, it is a legal tradition entrenched and submerged within a religious context.”[4]
Bemerkenswert ist, dass diese Meinung die Rolle der Šarīʿa als Wissenschaft reflektiert. Mit anderen Worten, die Muslime glauben fest daran, dass ihr Leben durch göttliches Gesetz, welches etliche Aspekte des täglichen Lebens beinhaltet, regiert werden soll.[5]
Es ist möglich, dass die nächste Definition die Bedeutung des göttlichen Rechtssystems (Šarīʿa) klarer fasst:
Šarīʿa als Fachbegriff ist in einem weiten und einem engen Verständnis aufzufinden. Diese gilt es zunächst aufzuschlüsseln um Verwirrungen zu vermeiden. Die spezifisch ausgeprägten traditionellen, dem Koran entlehnten Rechtsvorschriften aus den Bereichen des Familien-, Erb- und Strafrechts gelten als ein enges Verständnis des Fachbegriffs Scharia. Dieses [...] Scharia im weiten normativen Verständnis umfasst die Gesamtheit aller religiösen und rechtlichen Normen, sowie Mechanismen zur Normfindung und Interpretation.[6]
1.2 Al-Fiqh (die Normenlehre) als Terminus Technicus
Der Terminus Fiqh wird in arabischen Wörterbüchern als Synonym für Verstehen genauer beschrieben: Das Verinnerlichen von reflexivem Wissen. Al-Fīrūzābādī (gest. 1415) definierte Fiqh in seinem umfassenden Werk (al-Qāmūs al-Muḥīṭ) als das Verstehen und das Wissen.[7]
"Die juristischen Handbücher, die von den Rechtsgelehrten verfassten wurden, bestehen aus zwei Hauptteilen: den Quellen (Uṣūl) und den Zweigen (Furūʿ). Die Rechtsquellen (Uṣūl al-fiqh) bilden für sich genommen eine eigene Disziplin."[8]
Muhammad ibn Idrīs al Šafiʿī (gest.820) hat fiqh definiert als:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten[9]
Das Wissen über die gesetzlichen praktischen Beurteilungen, die aus ihren detaillierten Beweisen gewonnen worden sind.
Im Mausūʿat Muṣṭalaḥāt Uṣūl al-fiqh ʿinda al- Muslimīn von Rafīq Al-ʿAǧam definierte al-Fiqh als:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten[10]
Die Rechtsquellen-Gelehrten (al-Uṣūliyyīn) definierten des Fiqh als: Das Wissen über die gesetzlichen praktischen Beurteilungen, die aus ihren detaillierten Beweisen gewonnen worden sind. Auf dieser Basis spezifiziert Fiqh, das Wissen über die gesetzlichen praktischen Beurteilungen. Das heisst, dass alles was von den Beurteilungen des Glaubens abhängt, wie Tawḥīd, die Botschaft der Propheten, ihre Mitteilung der Botschaft Gottes und das Wissen über den jüngsten Tag und was an diesem Tag geschehen wird. All dies klassifiziert den Begriff Fiqh nicht als Terminus Technicus.[11]
Im Mawsūʿat al-fiqh al-Islāmī, die vom Obersten Rat für Islamische Angelegenheiten (in Ägypten) herausgegeben wurde, konzentriert man sich auf die Definition des Fiqh bei den Rechtsquellen-Gelehrten (al-Uṣūliyyīn) und den Rechtsgelehrten (al-Fuqahāʾ) im Frühislam.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten[12]
Die Definition des Fiqh in der Frühzeit des Islam: Vorwiegend wurde Fiqh verwendet, um alle Beurteilungen der Religion zu begreifen und alle kanonischen Gesetze Gottes zu verstehen, die Er für seine Diener vorgeschrieben hat. Egal ob diese auf den Glauben und den Glaubenssätze bezogen sind, sowie was mit ihnen verbundenen ist.Oder wenn das auf die Bestimmungen des Erbrechts (al-Furūḍ), der Strafen (al-Ḥudūd), sowie der Befehle und Verbote, der Wahl und des Verhältnisses bezogen ist.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten[13]
Die Rechtsquellen-Gelehrten (al-Uṣūliyyīn) definierten den Fiqh als: das Wissen der rechtlichen Beurteilungen, die, gemäß al-Širāzī im al-Lamʿ, von der Īǧtīhad abgeleitet wurden.
Und das ist genau die Definition, wie auch andere Gelehrte al-Fiqh definiert haben: das Wissen, das sich mit den gesetzlichen praktischen Beurteilungen durch die Ableitungsmethode beschäftigt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten[14]
Die Fiqh ist ein Spektrum von Beurteilungen und Streitfragen[...], sie meinen damit nur das Spektrum, das die rechtlichen und praktischen Beurteilungen beinhaltet, mit denen die Offenbarung herabgesandt wurde. Ob diese kategorisch oder präsumtiv waren. Damit meinen sie auch die Ableitungen der al-Muǧtahidūn (die Gelehrten, die den Iǧtihād ausüben), trotz ihrer verschiedenen Kategorien[...].[15]
Die Wissenschaftler, die sich auf den Gegenstand des Fiqh spezialisieren, nennt man Fuqahāʾ (Plural von Faqīh). Sie werden auch als Mufti bezeichnet, wenn sie ein hervorragendes Wissensniveau erreicht haben und in der Lage sind, die Beurteilungen abzuleiten. Daher können sie auf neue komplexe Rechtsfragen eine Antwort geben.
1.3 Usul al-fiqh (die Rechtsquellenlehre)
1.3.1 Uṣūl al-fiqh in der Lexikologie
Der Terminus Uṣūl spielt in der islamischen Wissenschaft eine sehr große Rolle. Deshalb wird im Folgenden der Begriff grundsätzlich erörtert.
Abu-an-Nūr Zuhaīr, (gest. 1987) legte in seinem bekanntesten Werk (Uṣūl al-fiqh) fest, dass Uṣūl der Plural des Wortes Aṣl ist, welches in der Lexikologie verschiedene Bedeutungen hat. Die zwei zentralsten sind: Erstens die Grundlagen, auf denen etwas gebaut wird und zweitens die Herkunft der Sache.[16]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten[17]
Außerdem erklärte Imam Faḫr-ad-Dīn ar-Rāzī (gest. 1209), dass der Begriff Uṣūl al-Fiqh aus zwei verschiedenen Wörtern besteht. Al-Aṣl ist, was man zu ihr benötigt und Fiqh bezeichnet, in der Lexikologie, das Verständnis über den Zweck des Diskurses
Im umfassenden Wörterbuch Lisan al-ʿArab von Ibn Manẓūr (starb um die Jahresende 1311/1312 in Kairo) wurde der Uṣūl al-fiqh in zwei Wörter geteilt:
Zum einen ist Fiqh das Verständnis und Wissen der Sache. Sie wird als Religionswissenschaft vorgesehen, die im Vergleich mit anderen Wissenschaften als die edelste und bevorzugteste Wissenschaft betrachtet wird. Hinzu kommt, dass die Definition des Wortes Uṣūl (Lisan al-ʿArab) sich um die Herkunft oder die Wurzel einer Sache (Aṣl, Pl. Uṣūl) handelt.[18]
Zum anderen wird Fiqh anstatt der Šarīʿa angewandt. Fiqh als Fachbereich spezialisiert sich in das Wissen der Zweige. Daher wird er auch als scharfsinnig oder intelligent (Faṭin) definiert.[19]
Des Weiteren findet man in der Lexikologie noch weitere Bedeutungen für das Wort Fiqh, wie in Mausūʿat Muṣṭalaḥāt al-Fikr al-ʿArabī von Rafīq al-ʿAǧam:
Der Fiqh ist ein genaues Verständnis der Fakten, durch das die Gelehrten die Weisheit (al-Ḥikmā) und das Wissen (al-ʿIlm) erreichen können.[20]
1.3.2 Uṣūl al-fiqh als Terminus Technicus
Zuhaīr klassifizierte den Begriff Uṣūl als Terminus Technicus auf vier Kategorien:
Erstens: Al-Aṣl bi-Maʿnā ad-Dalīl, die Wurzel im Sinne vom Beweis.
Zweitens: Ar-Raǧiḥ, die Wurzel im Sinne von Vorrang.
Drittens: Al-Maqīs ʿalaihi, die Wurzel im Sinne vom Analogieschluss.
Viertens: Al-Qāʿida al Mustamirrā, die kontinuierliche Basis.[21]
In diesem Abschnitt soll zwischen der Definition des Uṣūl al-Fiqh aus der okzidentalen und orientalischen Sicht unterschieden werden.
Erstens: Die Definitionen des Orients für Uṣūl al-Fiqh ist laut Ibn ʿAqīl s (gest.1119) Buch (al-Wādiḥ fī-l-Uṣūl): „Huwa al-ʿIlm bi-l-Aḥkām aš-Šarʿīyya bi-Ṭarīq an-Naẓar wa-l-Istinbāṭ.“[22]
Al-Fiqh ist das Wissen über die gesetzlichen Beurteilungen durch die Betrachtungs- und Ableitungsmethode.
Die oben genannte Quelle definierte Uṣūl (die Rechtsquellen) als:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten[23]
Die Rechtsquellenlehre ist die Grundlage, auf welcher die fiqhīyya Beurteilungen erbaut werden, die von den verschiedenen Arten und Rängen der Beweise abgeleitet werden.
Wie das Buch (der Koran) und die Ränge seiner Beweise, [...] der Beweis und Kontext seines Diskurses, die Sunna und ihre Ränge, der Analogieschluß, die Aussprüche der Prophetengefährten, auch wenn ihre diversen Erscheinungsformen unter den Gelehrten umstritten sind, und „Präsumtion der Fortgeltung einer Rechtslage (Istiṣḥāb)“[24]. Diese sind die Grundlagen, auf denen die Beurteilungen erbaut werden.[25]
Im riesigen Werk Kitāb al-Muʿtamad fī Uṣūl al-fiqh von Abū al-Ḥussain al-Baṣrī (gest. 1058), der als Scheich der Muʿtaziliten genannt wurde, definierte Uṣūl al-fiqh als:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten[26]
Die Rechtsquellenlehre wurde in der Lexikologie definiert: Was sich vom Fiqh verzweigt, als die Grundlagen des Glauben des Islam (at-Ṭawḥīd) und der Gerechtigkeit[...]. Al-Fuqahāʾ definierten die Rechtsquellenlehre als die Betrachtung der Methode des Fiqh im Allgemeinen und wie man von dieser Methode die Beweise ableiten kann.
Zweitens: Das Verständnis des Okzidents vom Uṣūl al-fiqh stimmt nicht mit der Definition des Orients überein. Aber sie (im Okzident) betrachten die Lehre von den Rechtsquellen als Kernstück des Rechts.
Hiermit werden verschiedene Definitionen des Uṣūl al-fiqh dargestellt. Krawietz, Birgit definierte Uṣūl als:
Wenn in den arabischen Texten und im Rahmen der islamischen Jurisprudenz von den ‚Wurzeln‘ oder ‚Quellen‘ des islamischen Rechts (Uṣūl al-fiqh) gesprochen wird, so handelt es sich um eine bildliche Redeweise, mit der die Grundlagen und Prinzipien des Rechts und der Rechtswissenschaft bezeichnet werden.[27]
Bei der Auflistung dieser verschiedenen Definitionen des Begriffs lohnt es sich, auch in den Enzyklopädien nachzuschlagen.
In der Enzyklopädie des Islam von M.Th.Houtsma (gest.1943) und A.J. Wensinck (gest. 1939), die als wichtige Quelle für die islamischen Termini betrachtet wird, unterscheidet man zwischen den Begriffen Uṣūl und Uṣūl al-fiqh.
Uṣūl wird darin definiert als: „(Wurzeln, Grundlagen) pl. von Aṣl. Unter den verschiedenartigen terminologischen Gebrauchsweisen dieses Wortes heben sich drei als Bezeichnungen für islamische Wissenschaften heraus: Uṣūl al-Dīn, Uṣūl al-Ḥadīth und Uṣūl al-Fiḳh.“[28].
Die Uṣūl al-fiqh wird gewöhnlich als die Methodenlehre der islamischen Rechtswissenschaft definiert, als die Wissenschaft von den Beweisen, die zur Feststellung der gesetzlichen Normen führen, im Allgemeinen. Begründet wird ihre Existenz durch die Erwägung, dass der Mensch nicht zwecklos erschaffen und sich nicht ziellos überlassen sei, sondern alle seine Handlungen durch gesetzliche Normen geregelt seien; da es nicht für jeden Einzelfall eine besondere Norm geben könne, sei man auf ihre Ableitung durch Beweise angewiesen.[29]
Daraus ergibt sich, dass das Wort Fiqh in der vorislamischen und frühislamischen Ära nicht als Wissenschaft sondern als Verständnis verwendet wurde.
Außerdem wurde im Orient wie auch im Okzident kein Unterschied im Verständnis des Begriffs Uṣūl al-fiqh herausgefunden.
2. Die Periodisierung der islamischen Geschichte
Wer die Entstehung des islamischen Rechts und der Uṣūl al-fiqh verstehen will, soll sowohl die Charakteristika (Ḫaṣāʾiṣ) als auch die Abschnitte (Marāḥil) der gesamten Entwicklung des islamischen Rechts kennen. Die Geschichte des islamischen Rechts wurde auf die 8 Abschnitte (Marāḥil) aufgeteilt:
570-632: Das Leben des Propheten Muhammads; Gründung der frühen islamischen Gemeinschaft; erste juristische Regeln (im Koran, in der Tradition, Gemeindeordnung von Medina).
632-661: Die Phase der ersten vier Kalifen als Nachfolger des Propheten; Entwicklung der ersten Rechtsinstitutionen und rechtlichen Grundlagen.
661-750: Herrschaft der Dynastie der Umayyaden; Etablierung eines ersten Kadi-System; Entwicklung der Vorläufer der ersten Rechtsschulen.
2. Hälfte 8. Jahrhundert-2.Hälfte 9. Jahrhundert: Schaffung der Grundlagen der sunnitischen Rechtsschulen und des zwölferschiitischen Rechts.
Bis zum 12. Jahrhundert: Formative Phase der Rechtsschulen; Etablierung von Madāris als Ausbildungsinstitutionen.
12.-16. Jahrhundert: Überprüfung der Lehren und Stabilisierung der Rechtsschulen.
17.-19. Jahrhundert: Die Zerlegung in Rechtsschulen; Neubetonung des Iǧtihad; Taqlid als Feindbild.
Ab dem 19. Jahrhundert: Kolonialismus-Phase und der Untergang der islamischen Welt.
20./21. Jahrhundert: Umsetzung des nationalstaatlichen Modells mit staatlicher Gesetzgebung und Schrumpfen des islamischen Rechts.[30]
3. Eine Übersicht über die Entstehung des Uṣūl al-fiqh im Rahmen der vier Rechtsschulen (al-maḏāhib al-arb‘a)
Der Fiqh erlebte seine Blütezeit durch die Gelehrten, die als Begründer der renommierten vier Rechtsschulen bekannt geworden sind. In diesem Zusammenhang schilderte Lohlker im seinem Buch (Islamisches Recht) die Entstehung der islamischen Rechtschulen:
Am Ende der Umayyaden-Zeit habe jede Rechtsschule eine Anzahl prominenter Meister gehabt, die die Doktrin der jeweiligen Schule autoritativ zum Ausdruck bringen hätten können. Nach dem Fall der Umayyaden und dem Aufstieg der neuen Kalifendynastie der Abbasiden ab dem Jahr 750 ging diese Entwicklung weiter.[31]
Der Anfang des zehnten Jahrhunderts war der geeignete Zeitpunkt um die Vereinbarung zwischen den Rationalismus- und Traditionalismusgelehrten zu treffen, welche zur Etablierung des Uṣul al-Fiqh beigetragen hat.
Das heißt, dass Uṣūl al-Fiqh als Ergebnis dieser Entwicklung entstand und definiert wurde.[32]
Das folgende Zitat stellt die erste Phase der Entstehung der Rechtsschulen dar:
Im sunnitischen Islam erkennen sich die vier Rechtsschulen (al-maḏāhib al-arb’a) gegenseitig als gleichermaßen autoritativ an. Teilweise wird es sogar für zulässig angesehen, eine erwünschte Lösung eklektisch einer anderen anerkannten Rechtsschule zu entnehmen, die diese Lösung kennt. [...]. Zur Rechtfertigung der Unterschiede zwischen den einzelnen Rechtsschulen wird mit Hilfe eines (vermutlich apokryphen) Ḥadīt die Verschiedenheit (ikhtilāf) als gottgewollt hingestellt „ikhtilāfa ummatī raḥma“ („Meinungsverschiedenheiten in meiner Gemeinde sind Gnade“)[33]
Im Folgenden werden die abweichenden Ansichten der Rechtsschulen bezüglich des Uṣūl al-fiqh dargestellt.
Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass bei den vier Rechtsschulen der Koran und die Sunna als Primärquellen des islamischen Rechtssystems angewandt werden.
Erstens: Abu Ḥanīfa al-Nuʿmān (699-767) aus Bagdad betrachtete den Koran, die Sunna sowie den Konsens und die Dikta der Gefährten (Aqwāl aṣ-Ṣaḥāba) als Überlieferungsquellen (Maṣādir naqliyya). Er benutzte vornehmlich den Analogieschluss (Qiyās) und die Billigkeit (Iṣtiḥṣān).[34] Die hanafitische Rechtsschule existiert vor allem in Syrien, Ägypten, im Irak sowie vom Westen bis nach Zentralasien und Indien. Sie wurde zur offiziellen Schule des osmanischen Reichs.[35]
Zweitens: Mālik ibn Anas (712-795) aus Al Madīna. Die malikitische Rechtsschule verbreitete sich vorrangig in Ägypten und später über ganz Nordafrika bis nach West- und Zentralafrika. In Nordafrika ist sie noch immer die bedeutendste Rechtsschule.[36] Der Koran und die Sunna wurden hier als primäre Quellen angewandt. Bei den Malikiten wurden die Rechtspraxis der Leute von Madina (ʿAmal ahl al-Madīna), die Dikta der Gefährten (Aqwāl aṣ-Ṣaḥāba), ungeschützte Interessen (Maṣālīḥ mursala), die Schätzung (Istiḥsān) und dem Blockieren dessen, was mit oder ohne Absicht zum Bösen führen kann, (Sadd aḏ-Ḏarāʾiʿ) betont.[37]
Drittens: Mohammad ibn Idrīs Aš-Šafiʿī (767-819) aus Bagdad und später übergesiedelt nach Ägypten wurde als Begründer der islamischen Uṣūl al-fiqh angesehen.
„His name is remembered as the first architect of the science of jurisprudence”[38]
Die vier Rechtsquellen Koran, Sunna, Konsens und Iǧtihād werden bei Aš-Šafiʿī anerkannt. Diese Rechtsschule überwog bis zum Aufstieg der Osmanen in den islamischen Kerngebieten und vor allem in Unterägypten, Ostafrika, Südarabien und in Südostasien.
Viertens: Aḥmed Ibn Ḥanbal (782-855) aus Bagdad ist der Begründer der hanbalitischen Rechtsschule. Sie orientiert sich vornehmlich an Koran und Sunna. Dem Qiāys steht sie kritisch gegenüber. Diese Rechtsschule fasste zunächst in Bagdad und Damaskus Fuß und verbreitete sich dann über die sogenannte islamische Welt. Im 18. Jahrhundert erlebte sie in Gestalt des Wahabismus einen erneuten Aufschwung und ist heute offizielle Doktrin in Saudi-Arabien.[39]
Außerdem war Abu Yusuf (gest. 798), Schüler von Abu Ḥanīfa, der erste, der die verstreuten Fiqh-Bücher, die später als Uṣūl al fiqh bekannt wurden, sammelte. Aber das erste wissenschaftliche Buch über Uṣūl al fiqh wurde von Mohammad ibn Idrīs aš Šāfiʿī geschrieben. Sein hervorragendes Werk heißt Ar-Risālah, das bis heute erhältlich ist.
4. Zwölferschiitischer Uṣūl al-fiqh
Nach der Auffassung der Zwölferschiiten ist der zwölfte Imam nicht gestorben, sondern im Jahre 873 verschollen und wird am Ende des Lebens als Mahdī wiederkehren.
Ibn abi ʿAqīl (gest. 979) wird als einer der ersten Gelehrten, der Uṣūl al-fiqh bei den Zwölferschiiten formulierte, betrachtet. Ibn abi ʿAqīl folgte al-Iskafī (gest. 991).
Das Werk ʿUddat al-uṣūl von Hassan al-Tūsī (gest. 1067) wurde als Ausgangspunkt zu einer gewissen Stabilisierung des zwölferschiitischen rechtsmethodischen Wissens angesehen.[40]
Die wichtigsten zwölferschiitischen Gelehrten, die bis heute die größte Rolle bei den Uṣūl al-fiqh spielen, sind: al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (gest. 1277) und al-ʿAllāma al-Ḥillī (gest. 1325), der eine Theorie entwickelte, die den Juristen eine erkenntnisgültige Vernunft (ʿAql) zutraut.[41]
5. Fazit
Schlussfolgernd ist festzuhalten, dass Uṣūl al-fiqh die erste wichtigste Grundlage und unverzichtbar ist, um Šarīʿa (das göttlichen Normensystem), Fiqh (die Normenlehre) und Islamwissenschaft aufzufassen. Mit anderen Worten Uṣūl al-fiqh ist wie das Fundament des Gebäudes.
Als ich die historische Entwicklung der Uṣūl al-fiqh untersucht habe, entdeckte ich, dass diese Wissenschaft hauptsächlich nach menschlichen Elementen ausgerichtet wurde. Hieraus lässt sich schließen, dass die Menschen als Gesetzgeber des Satzungsgesetzes einige Elemente der göttlichen Werte ableiten und so weder auf das göttliche Recht noch auf die menschlichen Bemühungen verzichtet werden kann.
Das heißt, es ist keine antagonistische Ordnung, wenn die rationalen Menschen bestimmte Gesetze erlassen, die ihrer Tradition, Geographie und ihren Lebensbedürfnissen entsprechen. Sondern haben sie gleichzeitig die Möglichkeit die Basis der göttlichen Beurteilungen abzuleiten, die an die Satzungsgesetze angepasst werden.
Die vorliegende Untersuchung ist der erste Grundbaustein, der für meine nächsten Untersuchungen (Iǧtihād und zum Verhältnis von Vernunft und Religion) gelegt wurde.
6. Literaturverzeichnis
1. Al-Fīrūzābādī: Al-Qāmūs al-Muḥīt, Band 4, Kairo 1912.
2. Al Kurdī, Aḥmad al-Ḥiǧǧī: Buḥūṯ fi ʿIlm Uṣūl al-fiqh , Maṣādir at-Tašrīʿ al-Islāmī al-Aṣlīya wa-'t-Tabaʿīya wa-Mabāḥiṯ al-Ḥukm, Dār al-Bašāʾir al-Islāmīya, Bairūt 2004.
3. Al-ʿAǧam, Rafīq: Mausūʿat Muṣṭalaḥāt al-Fikr al-ʿArabī wa'l-Islāmī al-Ḥadīṯ wa'l-Muʿāṣir, 2 Band, Maktabat Lubnān Nāširūn, Bairūt 2002.
4. Al-Ġazzālī Abī-Ḥāmid Muḥammad: Al-Mustaṣfā min ʿIlm al-Uṣūl, 1Band, Dār al-Arqām, Bairūt 1995.
5. Aṭ-Ṭabarī, Muḥammad ibn Ǧarīr: Tāriḫ al-Rusul wa-l-Mulūk, bearb. von Ibrāhīm, Abū al-Faḍl, Dar al-Maʿārif, 5 Band, Kairo 1979.
6. Elliesie, Hatem: Binnenpluralität des Islamischen Rechts. Diversität religiöser Normativität rechtsdogmatisch und -methodisch betrachtet, SFB-Governance Working Paper Series Nr. 54, DFG Sonderforschungsbereich 700, Berlin, April 2014, (Zugang am 08.11.14).
7. Faḫr-ad-Dīn ar-Rāzī, Muḥammad Ibn-ʿUmar: Dirāsa wa-Taḥqīq Ṭāhā Ǧābir Faiyāḍ al-ʿAlwānī, Al- Maḥṣūl fī ʿIlm Uṣūl al-fiqh, Band 1, Muʾassasat ar-Risāla, Bairūt 1992.
8. Ǧumhūriyyat Misr al-ʿArabiyya, Wizārat al-Awqāf, al-Maǧlis alaʿlā liš-Šuʾūn al-Islāmiyya: Mawsūʿat al-Fiqh al-Islāmī, Teil 1, Kairo 1990.
9. Gavin N. Picken: Islamic law, 1, Origins and sources, Routledge, London [u.a.], 2011.
10. Hallaq, Wael: Sharīʿa, Theorie usw., Cambridge Press, Edinburgh 2009.
11. Hanstein, Thoralf: Islamisches Recht und nationales Recht, eine Untersuchung zum Einfluß des islamischen Rechts auf die Entwicklung des modernen Familienrechts am Beispiel Indonesiens, Lang, Frankfurt am Main [u.a.] 2002.
12. Houtsma, Martin TH. (hrsg): Enzyklopaedie des Islam: geographisches, ethnographisches und biographisches Wörterbuch der muhammedanischen Völker; Erg.Bd., Band 4, Leiden Brill 1938.
13. Krawietz, Birgit: Hierarchie der Rechtsquellen im tradierten sunnitischen Islam, Duncker & Humblot, Berlin 2002.
14. Khorchide, Mouhanad: Scharia.-.der missverstandene Gott: der Weg zu einer modernen islamischen Ethik, Herder, Freiburg im Breisgau; Basel; Wien 2013.
15. Khan, Liaquat Ali; Ramadan, Hisham M.: Contemporary Ijtihad: limits and controversies, Edinburgh University Press, Edinburgh 2011.
16. Lohlker, Rüdiger: Islamisches Recht, Facultas Verlag, Wien 2012.
17. Neumann, Andreas: Rechtsgeschichte, Rechtsfindung und Rechtsfortbildung im Islam: Enzyklopädien des islamischen Rechts unter besonderer Berücksichtigung Ägyptens und der Nasser-Enzyklopädie, Kovač, Hamburg 2012.
18. Zuhair, Muḥammad Abu-'n-Nūr: Dār al-Madār al-Islāmī, Bairūt 2001.
19. https://de.scribd.com/doc/11921423 Mohamed-Ibrahim: Was ist und wozu braucht man Uṣul al-Fiqh? (Zugang 10.12.14)
[...]
[1] Vgl. aṭ-Ṭabarī, Muḥammad ibn Ǧarīr: Tāriḫ al-Rusul wa-l-Mulūk, bearb. von Ibrāhīm, Abū al-Faḍl, Dar al-Maʿārif, 5. Band, Kairo 1979, S. 48-49.
[2] Vgl. Lohlker, Rüdiger: Islamisches Recht, Fakultas Verlag, Wien 2012, S. 17.
[3] Vgl. Khan, Liaquat Ali; Ramadan, Hisham M.: Contemporary Ijtihad: limits and controversies, Edinburgh University Press, Edinburgh 2011, S. 3.
[4] Picken, Gavin N.: Islamic law, 1, Origins and sources, Routledge, London [u.a.] 2011, S. 1.
[5] Vgl. Ebd.
[6] Elliesie, Hatem: Binnenpluralität des Islamischen Rechts. Diversität religiöser Normativität rechtsdogmatisch und -methodisch betrachtet, Berlin, April 2014, S. 7.(Zugang am 12.11.14).
[7] Vgl. al-Fīrūzābādī: al-Qāmūs al-Muḥīt, Band 4, Kairo 1912, S. 289.
[8] Elliesie, Hatem: 2014, S. 9. (Zugang am 08.11.14)
[9] Al Ġazālī, abu Ḥamīd: al Muṣṭaṣfā, B.1, Bairūt 1995, , S. 9
[10] Al-ʿAǧam, Rafīq: Mausūʿat Muṣṭalaḥāt Uṣūl al - Fiqh ʿinda al- Muslimīn, 2 Band , Maktabat Lubnān Nāširūn, Bairūt 2002, S. 1107-1113.
[11] Vgl.Ebd.
[12] Ǧumhūriyyat Misr al-ʿArabiyya, Wizārat al-awqāf, al-Maǧlis alaʿlā liš-Šuʾūn al-Islāmiyya: Mawsūʿat al-fiqh al-islāmī, Teil 1, Kairo 1990, S. 9.
[13] Ebd., S.10.
[14] Ebd., S. 12.
[15] Vgl. Ebd., S. 12.
[16] Vgl. Zuhair, Muḥammad Abu-'n-Nūr: Uṣūl al-fiqh, Dār al-Madār al-Islāmī, Bairūt 2001.S. 11.
[17] Vgl. Faḫr-ad-Dīn ar-Rāzī, Muḥammad Ibn-ʿUmar: Dirāsa wa-Taḥqīq Ṭāhā Ǧābir Faiyāḍ al-ʿAlwānī: al- Maḥṣūl fī ʿIlm Uṣūl al-fiqh, Band 1, Muʾassasat ar-Risāla, Bairūt 1992, S. 91-92.
[18] Vgl.Ibn Manẓūr: Lisān al-ʿArab, 11 Band, Dār Bairūt, Bairūt 1967, S. 16.
[19] Vgl. Ebd., S. 522-523.
[20] Vgl. Al-ʿAǧam, Rafīq: Mausūʿat muṣṭalaḥāt al-fikr al-ʿarabī wa'l-islāmī al-ḥadīṯ wa'l-muʿāṣir, 2, Maktabat Lubnān Nāširūn, Bairūt 2002, S. 802.
[21] Vgl. Ebd.
[22] Ibn ʿAqīl, A. ʿAlī: al-Wāḍiḥ fī-l-Usūl, bearb. George al-Maqdisi, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1996, S. 2.
[23] Vgl.Ebd.
[24] Krawietz, Birgit: Hierarchie der Rechtsquellen im tradierten sunnitischen Islam, Duncker & Humblot, Berlin 2002, S. 279.
[25] Vgl. Ebd.
[26] Al-Baṣrī, Abū al-Ḥusain: Kitāb al-Muʿtamad fī Uṣūl al-Fiqh, bearb. von Ḥasan Ḥanafi und Muhammad Bekir, al-Matba'a al-Kathulikiya, Bairūt 1964, S. 9.
[27] Ebd., S. 1
[28] Houtsma, Martin TH. (hrsg): Enzyklopaedie des Islam: geographisches, ethnographisches und biographisches Wörterbuch der muhammedanischen Völker; Erg.Bd., Band 4, Leiden : Brill, 1938, S. 1142.
[29] Houtsma, Martin TH. (hrsg), S. 1142.
[30] Vgl. Lohlker, Rüdiger: Islamisches Recht, Facultas Verlag, Wien 2012, S.13-14.
[31] Ebd., S. 74.
[32] Vgl. Hallaq, Wael: Sharīʿa Theorie, Cambridge Press, Edinburgh 2009, S. 59.
[33] Elliesie, Hatem: 2014, S. 15.(Zugang am 08.11.14).
[34] Vgl. Krawietz, Birgit: Hierarchie der Rechtsquellen im tradierten sunnitischen Islam, Duncker & Humblot, Berlin 2002, S. 66.
[35] Vgl. Elliesie, Hatem: 2014, S. 16.(Zugang am 11.11.14).
[36] Vgl. Ebd.
[37] Vgl. Krawietz, Birgit: Hierarchie der Rechtsquellen im tradierten sunnitischen Islam, Duncker & Humblot, Berlin 2002, S. 66.
[38] Muṣleḥ-ud-Din: Insurrance, S. 63; In Krawietz, Birgit: Hierarchie der Rechtsquellen im tradierten sunnitischen Islam, Duncker & Humblot, Berlin 2002, S. 66.
[39] Vgl. Elliesie, Hatem: 2014, S. 17.(Zugang am 11.11.14).
[40] Vgl. Lohlker, Rüdiger: Islamisches Recht, Facultas Verlag, Wien 2012, S. 93-94.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus dieser Arbeit?
Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Frage: Könnten die islamischen Gelehrten ohne gute Kenntnisse über den Uṣūl al fiqh, begreifen, was Šarīʿa (das göttliche Recht) eigentlich ist? Um diese Behauptung zu beweisen, muss man den Uṣūl al-fiqh genauer betrachten.
Welche zentralen Fragen behandelt diese Arbeit bezüglich der Šarīʿa?
Diese Arbeit behandelt die Fragen: Hat Šarīʿa (das göttliche Recht) die menschlichen Bedürfnisse erfüllt? Widerspricht die Šarīʿa und ihre unterschiedlichen Interpretationen nicht den menschlichen Interessen und Grundwerten? Zudem: Können Koran sowie Sunna (mit einigen Einschränkungen) allein als Hauptquellen der Gesetzgebung die menschlichen Bedürfnisse erfüllen?
Was wird im ersten Teil der Arbeit behandelt?
Im ersten Teil werden die zentralen Begriffe, wie Šarīʿa (das göttliche Recht), Uṣūl al-fiqh, die immer wieder als Grundlage der islamischen Wissenschaften vorkommen und Fiqh (die Normenlehre), lexikologisch und als Terminus Technicus erläutert.
Welche historischen Aspekte des Uṣūl al-fiqh werden in der Arbeit untersucht?
Im zweiten Teil werden die wichtigsten Merkmale in der historischen Entwicklung und Periodisierung der Geschichte des Uṣūl al-fiqh gezeigt.
Welche Rechtsschulen werden in Bezug auf Uṣūl al-fiqh betrachtet?
Die Arbeit gibt eine Übersicht über die Entstehung des Uṣūl al-fiqh im Rahmen der vier Rechtsschulen (al-maḏāhib al-arb‘a), hauptsächlich aus sunnitischer Sicht.
Was behandelt Kapitel 4 der Arbeit?
Kapitel 4 befasst sich, in Verbindung mit ihren wichtigsten Gelehrten, mit den Uṣūl al-fiqh in der schiitischen Rechtsschule (Zwölferschiitischer Uṣūl al-fiqh).
Wie wird der Begriff Šarīʿa in dieser Arbeit definiert?
Šarīʿa wird als die Auslegung des göttlichen Rechts, das im Koran und Sunna des Propheten dargestellt wurde, definiert. Es wird zwischen einem weiten und einem engen Verständnis unterschieden, wobei das weite Verständnis die Gesamtheit aller religiösen und rechtlichen Normen umfasst.
Was ist die Definition von Fiqh laut den arabischen Wörterbüchern?
Der Terminus Fiqh wird in arabischen Wörterbüchern als Synonym für Verstehen genauer beschrieben: Das Verinnerlichen von reflexivem Wissen.
Wie definierte Muhammad ibn Idrīs al Šafiʿī Fiqh?
Muhammad ibn Idrīs al Šafiʿī definierte Fiqh als "Das Wissen über die gesetzlichen praktischen Beurteilungen, die aus ihren detaillierten Beweisen gewonnen worden sind."
Welche Bedeutung hat der Terminus Uṣūl in der islamischen Wissenschaft?
Der Terminus Uṣūl spielt in der islamischen Wissenschaft eine sehr große Rolle und bedeutet in der Lexikologie entweder die Grundlagen, auf denen etwas gebaut wird, oder die Herkunft der Sache.
Welche Kategorien von Uṣūl als Terminus Technicus werden genannt?
Der Begriff Uṣūl als Terminus Technicus wird auf vier Kategorien klassifiziert: Al-Aṣl bi-Maʿnā ad-Dalīl (die Wurzel im Sinne vom Beweis), Ar-Raǧiḥ (die Wurzel im Sinne von Vorrang), Al-Maqīs ʿalaihi (die Wurzel im Sinne vom Analogieschluss) und Al-Qāʿida al Mustamirrā (die kontinuierliche Basis).
Wie definiert Ibn ʿAqīl Uṣūl al-Fiqh?
Ibn ʿAqīl definierte Uṣūl al-Fiqh als: „Huwa al-ʿIlm bi-l-Aḥkām aš-Šarʿīyya bi-Ṭarīq an-Naẓar wa-l-Istinbāṭ.“ (Al-Fiqh ist das Wissen über die gesetzlichen Beurteilungen durch die Betrachtungs- und Ableitungsmethode.)
Wie wird die Geschichte des islamischen Rechts periodisiert?
Die Geschichte des islamischen Rechts wird in acht Abschnitte unterteilt, von der Zeit des Propheten Muhammad bis zur Gegenwart, wobei jeder Abschnitt spezifische Entwicklungen und Ereignisse aufweist.
Welche Rolle spielt die Verschiedenheit (ikhtilāf) in den islamischen Rechtsschulen?
Zur Rechtfertigung der Unterschiede zwischen den einzelnen Rechtsschulen wird mit Hilfe eines (vermutlich apokryphen) Ḥadīt die Verschiedenheit (ikhtilāf) als gottgewollt hingestellt „ikhtilāfa ummatī raḥma“ („Meinungsverschiedenheiten in meiner Gemeinde sind Gnade“)
Welche sind die vier sunnitischen Rechtsschulen und welche Prinzipien verfolgen sie?
Die vier sunnitischen Rechtsschulen sind die hanafitische, malikitische, schafiitische und hanbalitische, die sich in der Anwendung von Koran, Sunna, Konsens und Iǧtihād sowie in der Gewichtung anderer Rechtsquellen unterscheiden.
Wer gilt als Begründer der islamischen Uṣūl al-fiqh?
Mohammad ibn Idrīs Aš-Šafiʿī wird als Begründer der islamischen Uṣūl al-fiqh angesehen.
Wer gilt als einer der ersten Gelehrten, der Uṣūl al-fiqh bei den Zwölferschiiten formulierte?
Ibn abi ʿAqīl wird als einer der ersten Gelehrten, der Uṣūl al-fiqh bei den Zwölferschiiten formulierte, betrachtet.
Was ist das Fazit der Arbeit bezüglich Uṣūl al-fiqh?
Uṣūl al-fiqh ist die erste wichtigste Grundlage und unverzichtbar, um Šarīʿa, Fiqh und Islamwissenschaft aufzufassen. Sie ist wie das Fundament des Gebäudes.
- Quote paper
- Ahmed Abd El Aal (Author), 2014, Einführung in die Rechtsquellenlehre (Usūl al-fiqh). Ein historischer Überblick über ihre Entstehung und Entwicklung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/308827