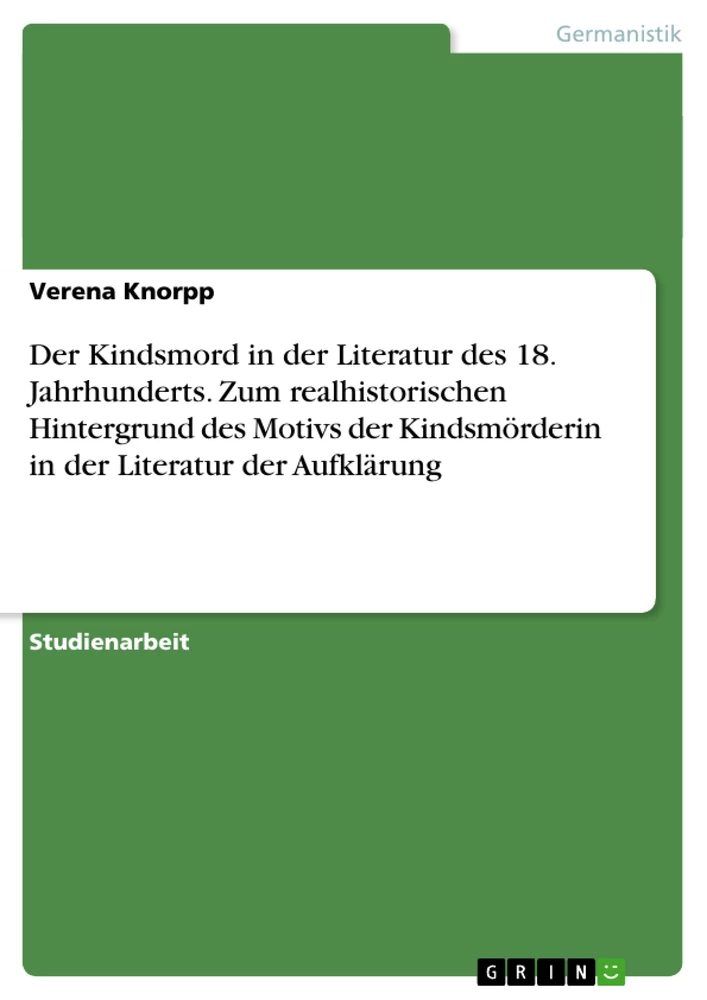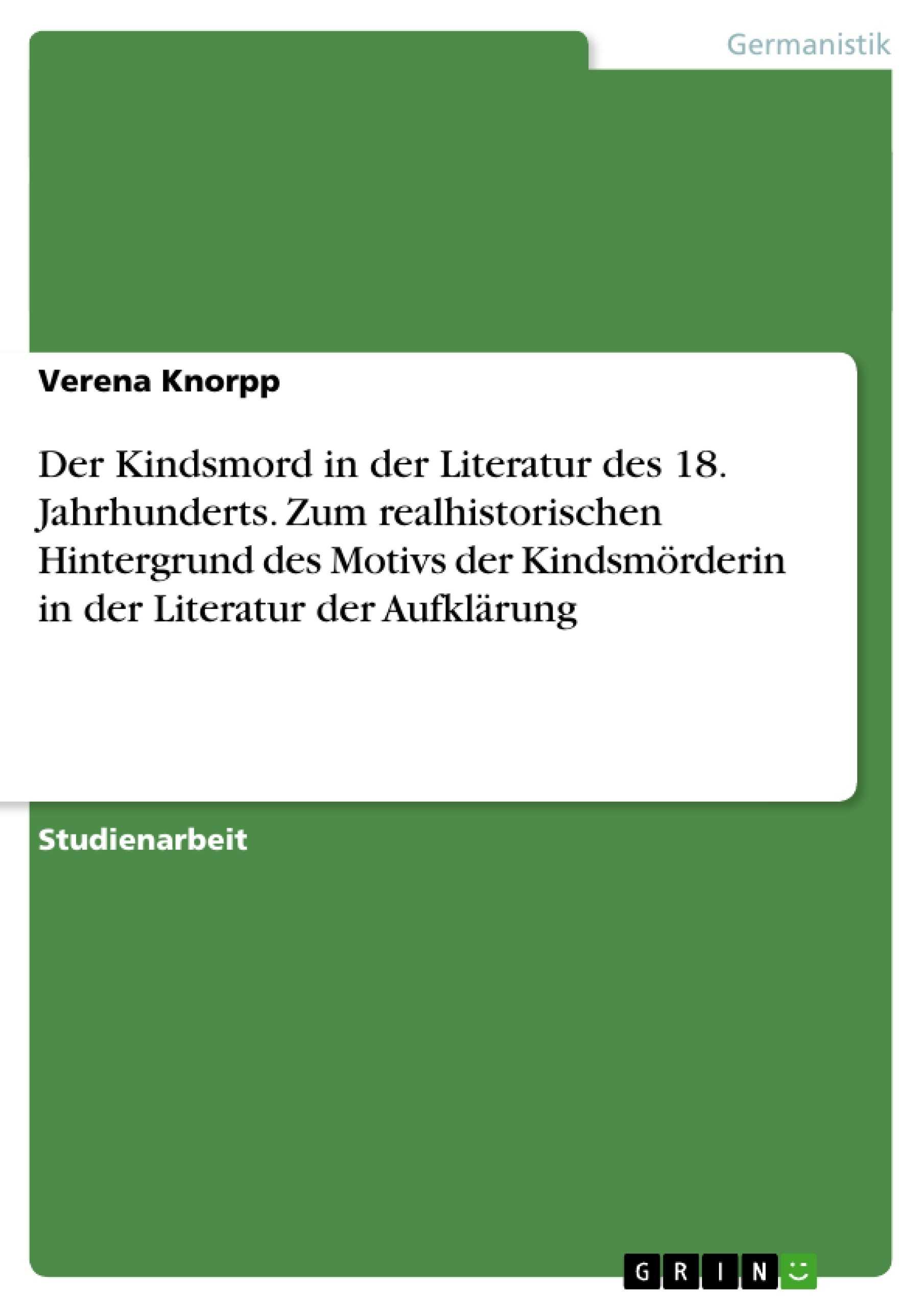Bei einer näheren Betrachtung der deutschen Literatur in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts fällt auf, dass das Motiv der Kindsmörderin in allen Arten der Dichtung sehr häufig auftritt. Seit dem Ende des 17. Jahrhunderts waren europaweit Probleme der Kinderversorgung durch den Staat oder die Kindesaussetzung diskutiert worden. Während in anderen Ländern letztgenanntes Phänomen den Schwerpunkt bildete, beanspruchte in Deutschland vor allem das Problem der Kindestötung besondere Aufmerksamkeit. Dies spiegelt sich auch in der Literatur. Man denke, um nur die bekanntesten Beispiele zu nennen, etwa an die Gretchentragödie in Goethes Faust oder Wagners „Kindermörderin“.
Da Dichter stets im Kontext ihrer Zeit stehen, ist es in jedem Fall von großer Bedeutung, den realhistorischen Hintergrund literarischer Texte zu kennen. Im Falle des Kindsmords trifft dies in besonderem Maße zu, da gerade hier die dichterische Arbeit in engem Zusammenhang mit einer angeregten Diskussion und großen gesellschaftlichen Umbrüchen stand. Im Rahmen der Aufklärung fand ein Umdenken hinsichtlich gesellschaftlicher und sittlicher Anschauungen statt, während andererseits alte gesetzliche Bestimmungen noch in Kraft waren. Der Kindsmord als Thema besaß daher zum damaligen Zeitpunkt höchste Aktualität.
In dieser Arbeit sollen die genannten Zeitumstände im Einzelnen beleuchtet werden, die eine Grundlage der literarischen Analyse bilden. Eine konkrete Betrachtung literarischer Beispiele selbst würde den Rahmen dieser Arbeit leider sprengen, weshalb zum Abschluss der Ausführungen nur kurz auf Variationen des Motivs in der Dichtung sowie beispiel- und skizzenhaft auf Wagners „Kindermörderin“ eingegangen werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Kindsmord im Strafrecht
- Der Kindsmord in der Carolina
- Die Bewertung der Tat und das Strafmaß
- Die Häufigkeit des Kindsmordes
- Die Bestrafung von Unzucht
- Der Kindsmord im französischen Strafrecht
- Die Neubetwertung des Kindsmords im Rahmen der Aufklärung
- Vermutete Tatmotive und Lösungsvorschläge
- Die Reformen Friedrichs II.
- Die tatsächlichen Verhältnisse im Zeitalter der Aufklärung
- Die Situation der typischen Kindsmörderin
- Die Väter der Kinder
- Die Tatmotive
- Das Motiv des Kindsmordes in der Literatur
- Varianten des Motivs der Kindsmörderin
- Wagners „Kindermörderin“
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Motiv des Kindsmordes in der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts und analysiert den realhistorischen Hintergrund der Figur der Kindsmörderin im Kontext der Aufklärung. Ziel ist es, die literarischen Darstellungen im Lichte der zeitgenössischen Debatten über Kinderversorgung, Kindesaussetzung und Kindestötung zu beleuchten.
- Die strafrechtliche Bewertung des Kindsmordes in der Carolina und anderen Rechtsquellen
- Die veränderten gesellschaftlichen Anschauungen im Zuge der Aufklärung
- Die tatsächlichen Lebensbedingungen von Frauen, die Kinder töteten
- Die literarische Darstellung des Motivs der Kindsmörderin, insbesondere in Wagners „Kindermörderin“
- Der Einfluss der realen gesellschaftlichen Verhältnisse auf die literarische Gestaltung des Motivs
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den literarischen Kontext des Motivs der Kindsmörderin im 18. Jahrhundert dar und unterstreicht die Bedeutung des realhistorischen Hintergrunds für die Interpretation literarischer Texte. Sie skizziert die Aktualität des Themas im Zeitalter der Aufklärung und die Relevanz der Arbeit für die Analyse der literarischen Gestaltung des Motivs.
- Der Kindsmord im Strafrecht: Dieses Kapitel befasst sich mit der strafrechtlichen Verfolgung von Kindsmord in der frühen Neuzeit und insbesondere mit der Carolina als maßgeblicher Rechtsquelle im 18. Jahrhundert. Es erläutert den Begriff des Kindsmordes, die Tatbestandsmerkmale und die vorgesehenen Strafen.
- Die Neubetwertung des Kindsmords im Rahmen der Aufklärung: Dieses Kapitel beleuchtet die veränderten Ansichten über den Kindsmord im Zeitalter der Aufklärung. Es analysiert die vermuteten Tatmotive und diskutiert mögliche Lösungsansätze für das Problem.
- Die tatsächlichen Verhältnisse im Zeitalter der Aufklärung: Dieses Kapitel zeichnet ein Bild von der Lebensrealität der typischen Kindsmörderin und beleuchtet die sozialen und ökonomischen Faktoren, die zur Tat führten. Es behandelt auch die Rolle der Väter der Kinder und die verschiedenen Tatmotive.
- Das Motiv des Kindsmordes in der Literatur: Dieses Kapitel befasst sich mit der literarischen Darstellung des Motivs der Kindsmörderin und analysiert verschiedene Varianten des Motivs. Es untersucht die Rolle des realhistorischen Hintergrunds in der literarischen Gestaltung und analysiert anhand von Wagners „Kindermörderin“ die Verbindung zwischen Literatur und gesellschaftlichen Verhältnissen.
Schlüsselwörter
Kindsmord, Aufklärung, Strafrecht, Carolina, Tatmotive, Kindesaussetzung, Kindestötung, Lebensbedingungen von Frauen, Literatur, Wagners „Kindermörderin“
- Quote paper
- Verena Knorpp (Author), 2004, Der Kindsmord in der Literatur des 18. Jahrhunderts. Zum realhistorischen Hintergrund des Motivs der Kindsmörderin in der Literatur der Aufklärung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/30850