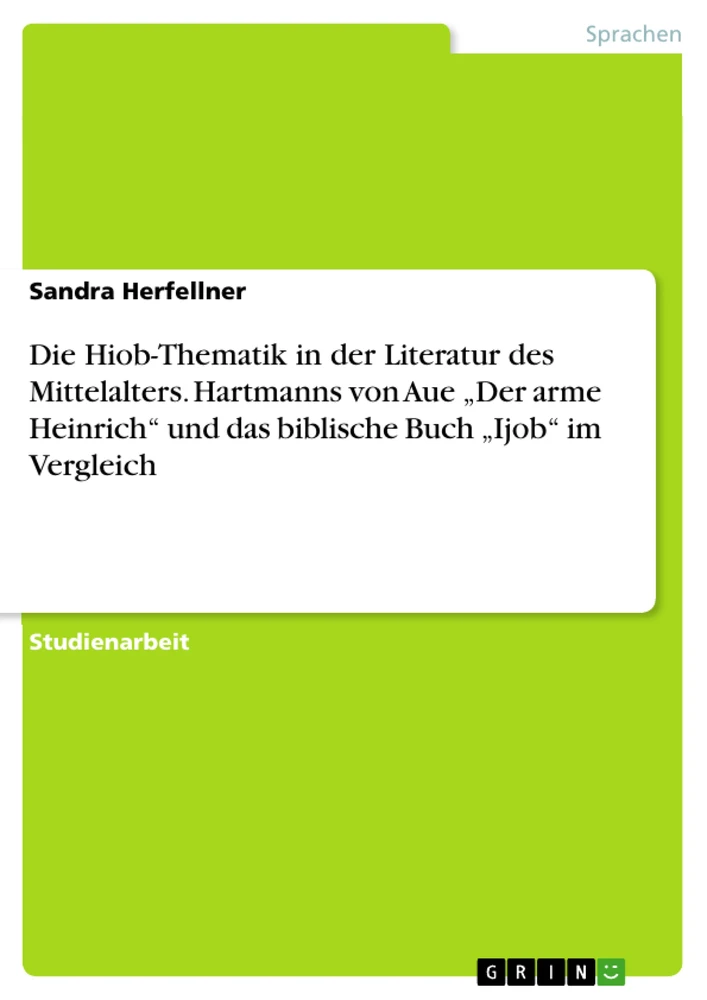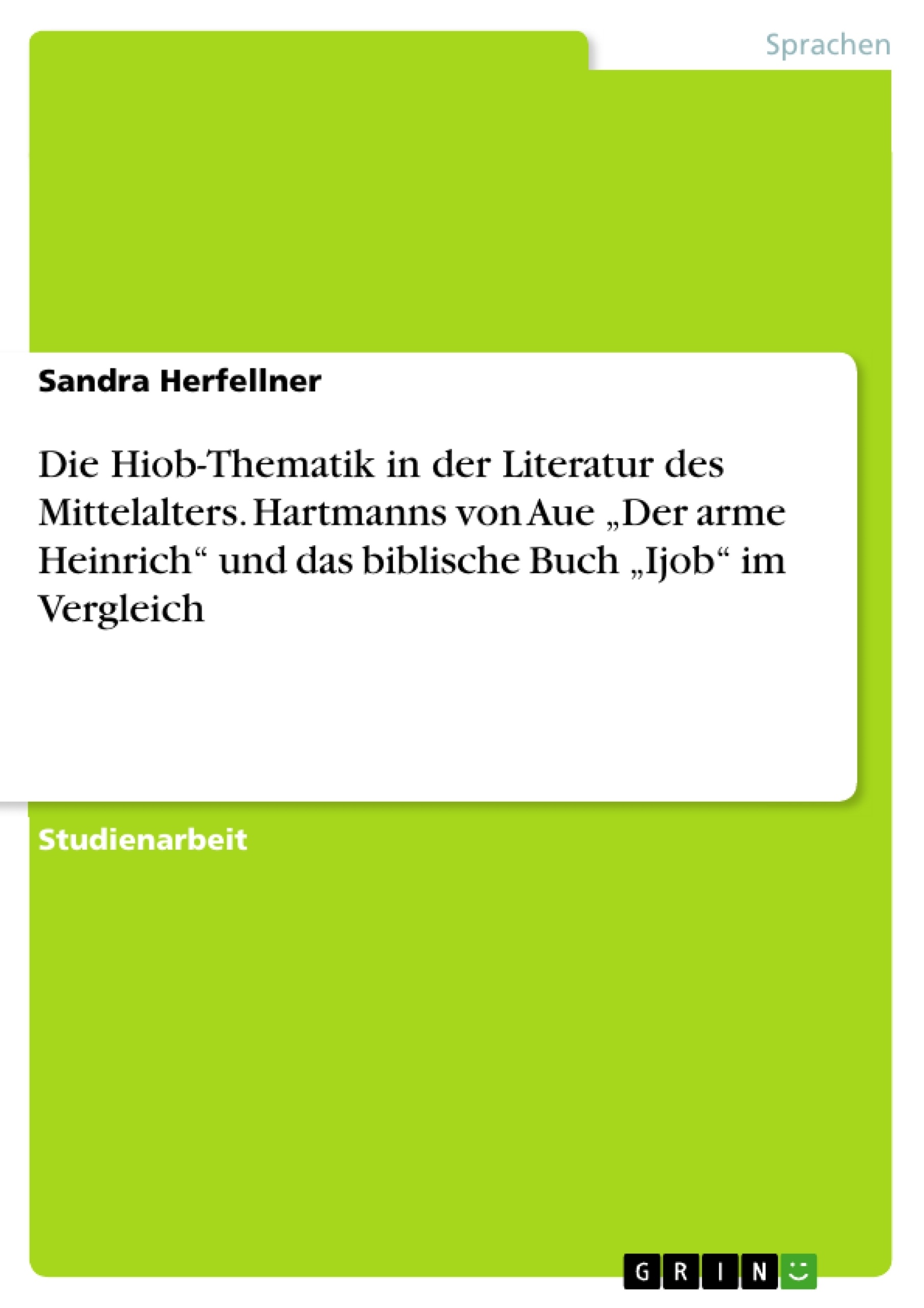Die Hiob-Thematik wurde in der Literatur im Laufe der Zeit immer wieder aufgegriffen und neu interpretiert. Johann Wolfgang von Goethe zum Beispiel verwendete den Hiob-Stoff in seinem Faust. Im “Prolog im Himmel” wetten, ähnlich wie auch in der “Himmelsszene” im Hiob, Gott und Mephisto um die Seele eines einzelnen Menschen. In beiden Werken triumphiert zuerst der Teufel über Gott; im Hiob durch das Unglück, im Faust durch das Glück. Doch sowohl im Buch Hiob als auch im “Armen Heinrich” siegt letztendlich Gott. Auch Josef Roth behandelt die Thematik in seinem 1930 erschienenen Werk: “Hiob. Roman eines einfachen Menschen”. Dort wird dargestellt, wie sich ein Mensch, weil seine Kinder erkranken, von Gott abwendet und durch die wundersame Heilung der Kinder wieder zu seinem Glauben an Gott zurückfindet. Bertolt Brecht beschäftigte sich ebenfalls mit der Hiob-Thematik, allerdings wird sein Werk “Der Blinde” oft als ‘Anti-Hiob’ interpretiert.
Auch schon im Mittelalter beschäftigten sich Autoren häufig mit dieser umstrittenen Thematik. So auch Hartmann von Aue. Er vergleicht in seinem Werk “Der Arme Heinrich” seinen Protagonisten Heinrich an den Wendepunkten des Werks mit Hiob. Augenscheinlich ist, dass “beide Werke […] das Schicksal des Helden auf drei Stufen [zeigen]: reich [und glücklich] am Anfang […] - [krank, vom Schicksal gebeutelt,] verlassen, unverstanden, angeklagt - gerettet und gesegnet nach der Demütigung unter Gottes Willen.” (Glutsch 1972).
In der folgenden Arbeit wird die Figur des Armen Heinrichs mit der biblischen Figur Hiob verglichen. Es werden Unterschiede und Analogien zwischen den beiden Erzählungen und den beiden Hauptfiguren aufgezeigt. Dies geschieht sowohl auf inhaltlicher Basis, als auch auf sprachlicher: Inhaltlich wird verglichen, wie die Figuren charakterisiert werden, wie und vor allem aus welchen Gründen sie vom Schicksal ereilt werden, wie sie darauf reagieren und wie sie am Ende für ihr Leid entschädigt werden. Auf der sprachlichen Ebene wird aufgezeigt, dass die Verfasser beider Werke ähnliche oder sogar dieselben Bilder verwenden. Des Weiteren wird beleuchtet, an welchen Stellen Gott direkt eingreift, wo das Eingreifen Gottes lediglich vom Erzähler als Tatsache dargestellt wird, und wo die Hauptfigur ein Eingreifen Gottes nur annimmt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Die Gestalten Heinrich und Hiob im direkten Vergleich
- 1.1 Der Arme Heinrich
- 1.2 Hiob
- 2. Leiden als Strafe, Prüfung oder Aufruf zur Umkehr
- 2.1 Hiobs Leid als Prüfung und als Mittel für die Ziele Gottes?
- 2.2 Heinrichs Leid und mögliche Ursachen
- 3. Das Malum an sich
- 3.1 Hiobs Schicksalsschläge
- 3.2 Heinrichs Krankheit und ihre Folgen
- 3.3 Vergleichbare Textstellen
- 4. Die Annahme des Leids und die darauf folgende Erlösung
- 4.1 Hiobs Annahme und Erlösung
- 4.2 Heinrichs Annahme und Erlösung
- 5. Das Eingreifen Gottes - Erwiesene Tatsache oder Interpretation?
- 6. Heinrich: Gegenfigur oder Vergleichsfigur zu Hiob?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Vergleich der Figuren des Armen Heinrichs aus Hartmanns gleichnamigem Werk und der biblischen Figur Hiob. Im Zentrum steht die Analyse der beiden Figuren im Kontext ihrer jeweiligen literarischen und religiösen Kontexte, wobei insbesondere die Parallelen und Unterschiede in Bezug auf Leiden, Schicksal, und die Rolle Gottes betrachtet werden.
- Das Leiden als Prüfung oder Strafe: Wie werden die Figuren von Schicksalsschlägen getroffen?
- Die Reaktion auf das Leid: Wie reagieren die Figuren auf ihre jeweilige Situation?
- Die Rolle Gottes: Eingreifen, Verborgenheit und Interpretation des Willens Gottes
- Die sprachliche Gestaltung der Werke: Vergleich der Bildsprache und der Erzählperspektive
- Der Vergleich der Figuren: Heinrich als Gegenfigur oder Vergleichsfigur zu Hiob
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas "Leiden" in der Literatur dar und führt die Figuren des Armen Heinrichs und Hiobs ein. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der Hiob-Thematik und ihre Rezeption in verschiedenen literarischen Werken, beispielsweise Goethes Faust und Roths "Hiob".
- 1. Die Gestalten Heinrich und Hiob im direkten Vergleich: Dieses Kapitel stellt die beiden Figuren vor. Der Arme Heinrich wird als vorbildlicher Ritter dargestellt, während Hiob als frommer Mann beschrieben wird, der sein Leben in Gottesfurcht verbringt.
- 2. Leiden als Strafe, Prüfung oder Aufruf zur Umkehr: Dieses Kapitel untersucht die Gründe für das Leiden der Figuren. Hiobs Leiden wird als göttliche Prüfung dargestellt, die ertragen werden muss, um seine Treue zu Gott zu beweisen. Die Ursache für Heinrichs Krankheit bleibt hingegen ungeklärt.
- 3. Das Malum an sich: In diesem Kapitel werden die konkreten Beispiele des Leids für beide Figuren analysiert. Es werden Hiobs Schicksalsschläge, wie der Verlust seiner Kinder und seines Besitzes, sowie Heinrichs Krankheit und ihre Folgen beschrieben.
- 4. Die Annahme des Leids und die darauf folgende Erlösung: Hier wird gezeigt, wie die Figuren mit ihrem Leid umgehen und wie sie schließlich erlöst werden. Hiob akzeptiert sein Schicksal und findet Trost in Gottes Gnade. Auch Heinrich erlangt durch seine Demut und sein Vertrauen in Gott wieder Gesundheit.
- 5. Das Eingreifen Gottes - Erwiesene Tatsache oder Interpretation?: Dieses Kapitel beleuchtet die Frage, ob und wie Gott in das Geschehen eingreift. Im Buch Hiob wird Gottes Eingreifen deutlich dargestellt, während es im "Armen Heinrich" eher auf Interpretationen der Leser ankommt.
- 6. Heinrich: Gegenfigur oder Vergleichsfigur zu Hiob?: In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Figuren erneut zusammengefasst und analysiert.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen "Leiden", "Gottesfurcht", "Gnade", "Schicksal", "Vergleich", "Figur", "Heinrich", "Hiob", "mittelalterliche Literatur", "biblische Literatur", "Interpretation", "Gott" und "Erlösung".
- Quote paper
- Dr. phil Sandra Herfellner (Author), 2008, Die Hiob-Thematik in der Literatur des Mittelalters. Hartmanns von Aue „Der arme Heinrich“ und das biblische Buch „Ijob“ im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/308449