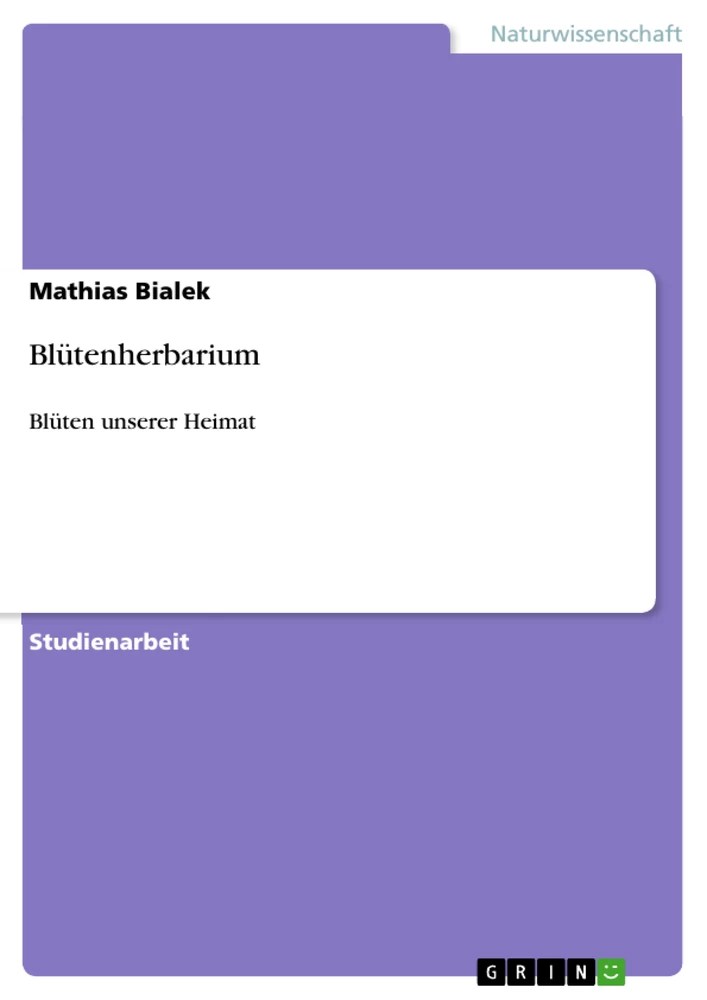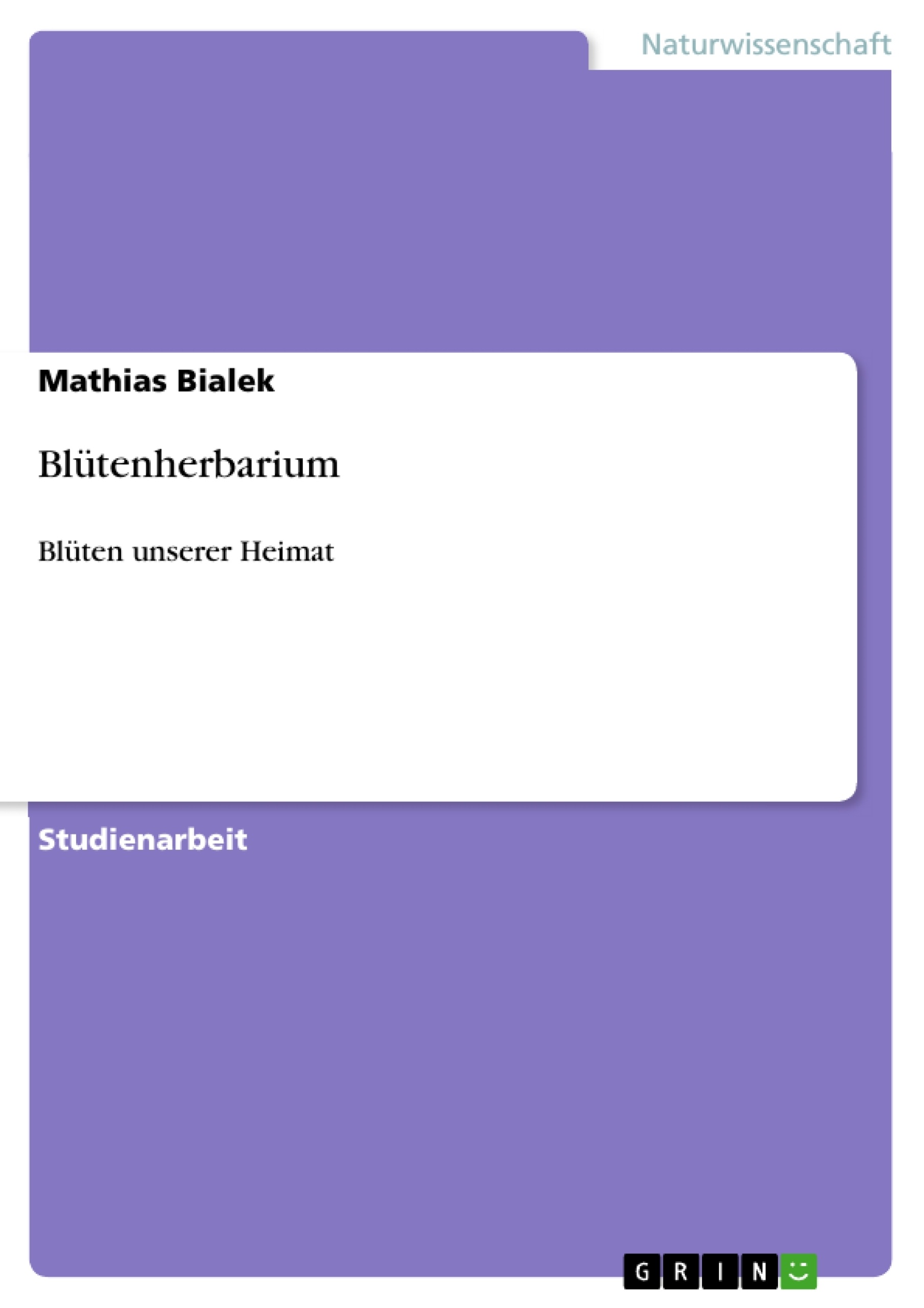Inhaltsverzeichnis
1. Aronstabgewächse (6)
1.1 Gefleckter Aronstab (8)
2. Glockenblumengewächse (10)
2.1 Wiesen-Glockenblumel (12)
3. Hahnenfußgewächse (14)
3.1 Gelbes Windröschen (16)
3.2 Gewöhnliche Akelei (18)
4. Korbblütengewächse (20)
4.1 Kornblume (22)
4.2 Orangerotes Habichtskraut (24)
4.3 Schaf-Garbe (26)
4.4 Wiesen-Margerite (28)
5. Kreuzblütengewächse (30)
5.1 Gewöhnliches Hirtentäschel (32)
5.2 Wiesen-Schaumkraut (34)
5.3 Zwiebel-Zahnwurz (36)
6. Lippenblütengewächse (38)
6.1 Gewöhnlicher Gundermann (40)
6.2 Goldnessel (42)
6.3 Kriechender Günsel (44)
7. Mohngewächse (46)
7.1 Hohler Lerchensporn (48)
7.2 Klatsch-Mohn (50)
7.3 Schöllkraut (52)
8. Narzissengewächse (54)
8.1 Schnitt-Lauch (56)
9. Nelkengewächse (58)
9.1 Acker-Hornkraut (60)
9.2 Große Sternmiere (62)
9.3 Kuckucks-Lichtnelke (64)
9.4 Rote Lichtnelke (66)
10. Raublattgewächse (68)
10.1 Blauroter Steinsame (70)
11. Rötegewächse (72)
11.1 Gewöhnliches Kletten-Labkraut (74)
11.2 Waldmeister (76)
12. Rosengewächse (78)
12.1 Gewöhnliche Nelkenwurz (80)
12.2 Knack-Erdbeere (82)
13. Sauerkleegewächse (84)
13.1 Wald-Sauerklee (86)
14. Schmetterlingsblütengewächse (88)
14.1 Gold-Klee (90)
14.2 Hopfenklee (92)
14.3 Inkarnat-Klee (94)
15. Spargelgewächse (96)
15.1 Vielblütige Weißwurz (98)
16. Steinbrechgewächse (101)
16.1 Wechselblättriges Milzkraut (103)
17. Storchschnabelwächse (105)
17.1 Wiesen-Storchschnabel (107)
18. Wegerichgewächse (109)
18.1 Spitz-Wegerich (111)
19. Wolfsmilchgewächse (113)
19.1 Sonnwend-Wolfsmilch (115)
Literaturverzeichnis (117)
Abbildungsverzeichnis (119)
Anhang (121)
Sammelkalender häufiger Wildfrüchte und -kräuter (121)
Wildkräuterverwendungen (123)
Wildkräuterrezepte (125)
Screenshot (129)
Inhaltsverzeichnis
- 1. Aronstabgewächse (Araceae)
- 1.1 Gefleckter Aronstab (Arum maculatum)
- 2. Glockenblumengewächse (Campanulaceae)
- 2.1 Wiesen-Glockenblume (Campanula patula)
- 3. Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae)
- 3.1 Gelbes Windröschen (Anemone ranunculoides)
- 3.2 Gewöhnliche Akelei (Aquilegia vulgaris)
- 4. Korbblütengewächse (Asteraceae)
- 4.1 Kornblume (Centaurea cyanus)
- 4.2 Orangerotes Habichtskraut (Hieracium aurantiacum)
- 4.3 Schaf-Garbe (Achillea millefolium)
- 4.4 Wiesen-Margerite (Leucanthemum vulgare)
- 5. Kreuzblütengewächse (Brassicaceae)
- 5.1 Gewöhnliches Hirtentäschel (Capsella bursa-pastoris)
- 5.2 Wiesen-Schaumkraut (Cardamine pratensis)
- 5.3 Zwiebel-Zahnwurz (Cardamine bulbifera, Dentaria bulbifera)
- 6. Lippenblütengewächse (Lamiaceae)
- 6.1 Gewöhnlicher Gundermann (Glechoma hederacea)
- 6.2 Goldnessel (Lamium galeobdolon)
- 6.3 Kriechender Günsel (Ajuga reptans)
- 7. Mohngewächse (Papaveraceae)
- 7.1 Hohler Lerchensporn (Corydalis cava)
- 7.2 Klatsch-Mohn (Papaver rhoeas)
- 7.3 Schöllkraut (Chelidonium majus)
- 8. Narzissengewächse (Amaryllidaceae)
- 8.1 Schnitt-Lauch (Allium schoenoprasum)
- 9. Nelkengewächse (Caryophyllaceae)
- 9.1 Acker-Hornkraut (Cerastium arvense)
- 9.2 Große Sternmiere (Stellaria holostea)
- 9.3 Kuckucks-Lichtnelke (Silene flos-cuculi, Lychnis flos-cuculi)
- 9.4 Rote Lichtnelke (Silene dioica, Melandrium rubrum)
- 10. Raublattgewächse (Boraginaceae)
- 10.1 Blauroter Steinsame (Lithospermum purpurocaeruleum)
- 11. Rötegewächse (Rubiaceae)
- 11.1 Gewöhnliches Kletten-Labkraut (Galium aparine)
- 11.2 Waldmeister (Galium odoratum)
- 12. Rosengewächse (Rosaceae)
- 12.1 Gewöhnliche Nelkenwurz (Geum urbanum)
- 12.2 Knack-Erdbeere (Fragaria viridis)
- 13. Sauerkleegewächse (Oxalidaceae)
- 13.1 Wald-Sauerklee (Oxalis acetosella)
- 14. Schmetterlingsblütengewächse (Fabaceae)
- 14.1 Gold-Klee (Trifolium aureum)
- 14.2 Hopfenklee (Medicago lupulina)
- 14.3 Inkarnat-Klee (Trifolium incarnatum)
- 15. Spargelgewächse (Asparagaceae)
- 15.1 Vielblütige Weißwurz (Polygonatum multiflorum)
- 16. Steinbrechgewächse (Saxifragaceae)
- 16.1 Wechselblättriges Milzkraut (Chrysosplenium alternifolium)
- 17. Storchschnabelgewächse (Geraniaceae)
- 17.1 Wiesen-Storchschnabel (Geranium pratense)
- 18. Wegerichgewächse (Plantaginaceae)
- 18.1 Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata)
- 19. Wolfsmilchgewächse (Euphorbiaceae)
- 19.1 Sonnwend-Wolfsmilch (Euphorbia helioscopia)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit bietet eine umfassende Beschreibung verschiedener heimischer Blütenpflanzen. Die Zielsetzung besteht in der detaillierten Darstellung der morphologischen Merkmale, des Vorkommens und weiterer interessanter Fakten zu ausgewählten Arten.
- Morphologische Charakteristika verschiedener Pflanzenfamilien
- Verbreitung und bevorzugte Standorte der Pflanzen
- Besondere Eigenschaften und Anpassungen der Pflanzen
- Verwendung der Pflanzen in der Geschichte und Gegenwart (z.B. als Heil- oder Küchenpflanzen)
- Ökologische Zusammenhänge und Interaktionen mit anderen Lebewesen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Aronstabgewächse (Araceae): Dieses Kapitel beschreibt die Familie der Aronstabgewächse, ihre charakteristischen Merkmale wie kolbige Blütenstände und die oft auffälligen Hochblätter. Es werden allgemeine Merkmale der Blätter, Blüten und Früchte dieser Familie erläutert und am Beispiel des Gefleckten Aronstabs veranschaulicht, der mit seinen besonderen Bestäubungsmechanismen und Giftigkeit detailliert vorgestellt wird.
2. Glockenblumengewächse (Campanulaceae): Das Kapitel behandelt die Familie der Glockenblumengewächse, charakterisiert durch ihre glockenförmigen Blüten. Es werden die Blätter, Blüten und Früchte beschrieben und die Variabilität des Blütenstandes hervorgehoben. Die Beschreibung der Wiesen-Glockenblume verdeutlicht die typischen Merkmale dieser Pflanzenfamilie und ihre Anpassungen an die Bestäubung durch Bienen.
3. Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae): Die Familie der Hahnenfußgewächse wird vorgestellt, mit ihrer Vielfalt an Blütenformen und -farben. Die Beschreibung der Blattstruktur, der Blütenmerkmale und der Fruchttypen wird ausführlich dargestellt. Die Kapitelbeispiele, das Gelbe Windröschen und die Gewöhnliche Akelei, veranschaulichen die Variabilität der Familie und ihre Anpassungsstrategien an verschiedene Habitate.
4. Korbblütengewächse (Asteraceae): Das Kapitel widmet sich der artenreichsten Pflanzenfamilie, den Korbblütengewächsen, und ihren körbchenförmigen Blütenständen. Die Beschreibung der Blattformen, Blütenstrukturen (Röhren- und Zungenblüten) und Früchte (Achänen) wird erläutert. Die einzelnen Arten (Kornblume, Orangerotes Habichtskraut, Schaf-Garbe, Wiesen-Margerite) veranschaulichen die morphologische Vielfalt innerhalb der Familie und ihre unterschiedlichen ökologischen Ansprüche.
5. Kreuzblütengewächse (Brassicaceae): Dieses Kapitel beschreibt die Kreuzblütengewächse mit ihren charakteristischen kreuzförmigen Blüten und den verschiedenen Fruchttypen (Schoten und Schötchen). Die Blattstruktur wird erläutert, ebenso wie der einheitliche Blütenbau. Die drei Beispielarten (Gewöhnliches Hirtentäschel, Wiesen-Schaumkraut und Zwiebel-Zahnwurz) veranschaulichen die Vielfalt innerhalb der Familie und ihre Anpassungsmechanismen.
6. Lippenblütengewächse (Lamiaceae): Die Familie der Lippenblütengewächse wird vorgestellt, charakterisiert durch ihre zygomorphen Blüten mit Ober- und Unterlippe. Der typische vierkantige Stängel und die gegenständigen Blätter werden beschrieben, ebenso die unterschiedlichen Fruchttypen. Die drei Beispielpflanzen (Gewöhnlicher Gundermann, Goldnessel und Kriechender Günsel) illustrieren die morphologische Vielfalt und ihre ökologischen Anpassungen.
7. Mohngewächse (Papaveraceae): Das Kapitel beschreibt die Familie der Mohngewächse, mit ihren vielgestaltigen Blüten und Fruchtformen. Die Merkmale der Blätter, Blüten und Früchte werden erläutert, und die Besonderheiten einiger Arten, wie Milchsaftbildung und Blütenstellung, werden hervorgehoben. Die Arten Hohler Lerchensporn, Klatsch-Mohn und Schöllkraut dienen als Beispiele für die Vielfalt der Familie.
8. Narzissengewächse (Amaryllidaceae): Dieses Kapitel befasst sich mit den Narzissengewächsen, die durch ihre Zwiebeln oder Knollen als Überdauerungsorgane gekennzeichnet sind. Die Blattstruktur, Blütenstände und Blütenformen werden beschrieben. Der Schnitt-Lauch wird als Beispiel einer Nutzpflanze aus dieser Familie detailliert präsentiert.
9. Nelkengewächse (Caryophyllaceae): Die Familie der Nelkengewächse wird vorgestellt, mit ihren meist fünfzähligen Blüten und den oft gegenständigen Blättern. Die Blütenstände und Fruchttypen werden erläutert. Die Arten Acker-Hornkraut, Große Sternmiere, Kuckucks-Lichtnelke und Rote Lichtnelke veranschaulichen die Vielfalt innerhalb der Familie und deren Anpassungen.
10. Raublattgewächse (Boraginaceae): Das Kapitel beschreibt die Familie der Raublattgewächse mit ihren meist behaarten Blättern und wickelförmigen Blütenständen. Die Blütenmerkmale, Fruchttypen und die Verbreitungsmechanismen werden erläutert. Der Blaurote Steinsame dient als Beispiel einer Art aus dieser Familie.
11. Rötegewächse (Rubiaceae): Die Familie der Rötegewächse wird vorgestellt, mit ihren quirligen Blättern und den oft kleinen Blüten. Die Blütenstände und Fruchttypen werden erläutert und am Beispiel des Gewöhnlichen Kletten-Labkrautes und des Waldmeisters veranschaulicht.
12. Rosengewächse (Rosaceae): Das Kapitel befasst sich mit der Familie der Rosengewächse, ihrer Vielfalt an Blütenformen und Fruchttypen. Die Merkmale der Blätter, Blüten und Früchte werden beschrieben, wobei die Nebenblätter als wichtiges Unterscheidungsmerkmal hervorgehoben werden. Die Gewöhnliche Nelkenwurz und die Knack-Erdbeere veranschaulichen die Vielfalt der Familie.
13. Sauerkleegewächse (Oxalidaceae): Die Familie der Sauerkleegewächse wird präsentiert, mit ihren meist dreizähligen Blättern und den fünfzähligen Blüten. Die Blattstruktur, Blütenbau und Fruchttypen werden erläutert. Der Wald-Sauerklee wird als Beispiel einer Art aus dieser Familie detailliert beschrieben.
14. Schmetterlingsblütengewächse (Fabaceae): Die Familie der Schmetterlingsblütengewächse wird vorgestellt, charakterisiert durch ihre zygomorphen Blüten mit Fahne, Flügeln und Schiffchen. Die Blattstruktur, der Blütenbau und die Hülsenfrucht werden beschrieben. Die Arten Gold-Klee, Hopfenklee und Inkarnat-Klee veranschaulichen die Vielfalt der Familie und ihre Bedeutung als Stickstoffbinder.
15. Spargelgewächse (Asparagaceae): Das Kapitel beschreibt die Familie der Spargelgewächse und deren morphologische Vielfalt. Die Blätter (oder Phyllokladien), Blüten und Früchte werden erläutert. Die Vielblütige Weißwurz wird als ein Beispiel einer Art aus dieser Familie detailliert vorgestellt.
16. Steinbrechgewächse (Saxifragaceae): Die Familie der Steinbrechgewächse wird vorgestellt, mit ihrer Vielfalt an Blattformen und Blütenständen. Die Blütenstruktur und Fruchttypen werden erläutert, und das Wechselblättrige Milzkraut dient als Beispiel für eine Art aus dieser Familie.
17. Storchschnabelgewächse (Geraniaceae): Die Familie der Storchschnabelgewächse wird präsentiert, mit ihren meist fünfzähligen Blüten und den charakteristischen Früchten. Die Blattstruktur, der Blütenbau und die Verbreitung der Früchte werden erläutert. Der Wiesen-Storchschnabel wird als Beispiel einer Art aus dieser Familie detailliert beschrieben.
18. Wegerichgewächse (Plantaginaceae): Das Kapitel beschreibt die Familie der Wegerichgewächse und deren morphologische und ökologische Vielfalt. Die Blattstruktur, Blütenstände und Blütenformen werden erläutert, wobei die Windbestäubung als wichtiges Merkmal hervorgehoben wird. Der Spitz-Wegerich wird als Beispiel für eine Art aus dieser Familie detailliert beschrieben.
19. Wolfsmilchgewächse (Euphorbiaceae): Die Familie der Wolfsmilchgewächse wird vorgestellt, mit ihren eingeschlechtlichen Blüten und den oft auffälligen Blütenständen (Cyathium). Die Blattstruktur, Blütenmerkmale und Fruchttypen werden erläutert. Die Sonnwend-Wolfsmilch wird als Beispiel einer Art aus dieser Familie detailliert präsentiert.
Schlüsselwörter
Blütenpflanzen, heimische Flora, Morphologie, Blütenbau, Blattstruktur, Fruchttypen, Verbreitung, Standortansprüche, Bestäubung, Ökologie, Pflanzenverwendung, Heilpflanzen, Küchenkräuter, Giftigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Umfassende Übersicht heimischer Blütenpflanzen"
Welche Pflanzenfamilien werden in diesem Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Pflanzenfamilien: Aronstabgewächse (Araceae), Glockenblumengewächse (Campanulaceae), Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae), Korbblütengewächse (Asteraceae), Kreuzblütengewächse (Brassicaceae), Lippenblütengewächse (Lamiaceae), Mohngewächse (Papaveraceae), Narzissengewächse (Amaryllidaceae), Nelkengewächse (Caryophyllaceae), Raublattgewächse (Boraginaceae), Rötegewächse (Rubiaceae), Rosengewächse (Rosaceae), Sauerkleegewächse (Oxalidaceae), Schmetterlingsblütengewächse (Fabaceae), Spargelgewächse (Asparagaceae), Steinbrechgewächse (Saxifragaceae), Storchschnabelgewächse (Geraniaceae), Wegerichgewächse (Plantaginaceae) und Wolfsmilchgewächse (Euphorbiaceae).
Welche Pflanzenarten werden innerhalb der Familien detailliert beschrieben?
Für jede Familie wird mindestens eine Pflanzenart detailliert beschrieben. Beispiele sind: Gefleckter Aronstab (Arum maculatum), Wiesen-Glockenblume (Campanula patula), Gelbes Windröschen (Anemone ranunculoides), Gewöhnliche Akelei (Aquilegia vulgaris), Kornblume (Centaurea cyanus), Orangerotes Habichtskraut (Hieracium aurantiacum), Schaf-Garbe (Achillea millefolium), Wiesen-Margerite (Leucanthemum vulgare), Gewöhnliches Hirtentäschel (Capsella bursa-pastoris), Wiesen-Schaumkraut (Cardamine pratensis), Zwiebel-Zahnwurz (Cardamine bulbifera/Dentaria bulbifera), Gewöhnlicher Gundermann (Glechoma hederacea), Goldnessel (Lamium galeobdolon), Kriechender Günsel (Ajuga reptans), Hohler Lerchensporn (Corydalis cava), Klatsch-Mohn (Papaver rhoeas), Schöllkraut (Chelidonium majus), Schnitt-Lauch (Allium schoenoprasum), Acker-Hornkraut (Cerastium arvense), Große Sternmiere (Stellaria holostea), Kuckucks-Lichtnelke (Silene flos-cuculi/Lychnis flos-cuculi), Rote Lichtnelke (Silene dioica/Melandrium rubrum), Blauroter Steinsame (Lithospermum purpurocaeruleum), Gewöhnliches Kletten-Labkraut (Galium aparine), Waldmeister (Galium odoratum), Gewöhnliche Nelkenwurz (Geum urbanum), Knack-Erdbeere (Fragaria viridis), Wald-Sauerklee (Oxalis acetosella), Gold-Klee (Trifolium aureum), Hopfenklee (Medicago lupulina), Inkarnat-Klee (Trifolium incarnatum), Vielblütige Weißwurz (Polygonatum multiflorum), Wechselblättriges Milzkraut (Chrysosplenium alternifolium), Wiesen-Storchschnabel (Geranium pratense), Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata) und Sonnwend-Wolfsmilch (Euphorbia helioscopia).
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die morphologischen Charakteristika verschiedener Pflanzenfamilien, ihre Verbreitung und bevorzugten Standorte, besondere Eigenschaften und Anpassungen, Verwendung in der Geschichte und Gegenwart (z.B. als Heil- oder Küchenpflanzen) sowie ökologische Zusammenhänge und Interaktionen mit anderen Lebewesen.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen zu jeder behandelten Pflanzenfamilie und eine Liste von Schlüsselbegriffen.
Für welche Zielgruppe ist dieses Dokument bestimmt?
Das Dokument ist für eine akademische Zielgruppe bestimmt, die sich mit der Thematik heimischer Blütenpflanzen auseinandersetzt. Die Informationen eignen sich für die wissenschaftliche Analyse von Pflanzen und deren Eigenschaften.
Welche Art von Informationen findet man in den Kapitelzusammenfassungen?
Die Kapitelzusammenfassungen bieten eine kurze Übersicht über die jeweilige Pflanzenfamilie, ihre charakteristischen Merkmale (Blütenbau, Blätter, Früchte), die beschriebenen Arten und deren besondere Eigenschaften (z.B. Bestäubungsmechanismen, Giftigkeit, Verwendung).
Wo finde ich die Schlüsselwörter zu diesem Dokument?
Die Schlüsselwörter befinden sich am Ende des Dokuments und umfassen Begriffe wie Blütenpflanzen, heimische Flora, Morphologie, Blütenbau, Blattstruktur, Fruchttypen, Verbreitung, Standortansprüche, Bestäubung, Ökologie, Pflanzenverwendung, Heilpflanzen, Küchenkräuter und Giftigkeit.
- Arbeit zitieren
- Cand. phil. Mathias Bialek (Autor:in), 2015, Blütenherbarium, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/307931