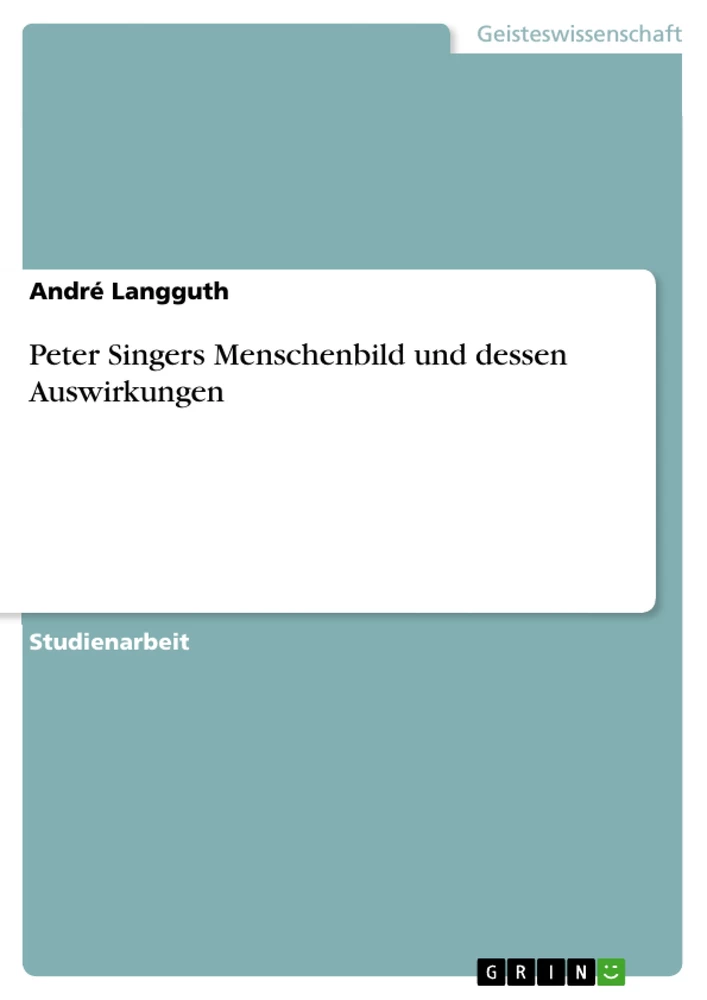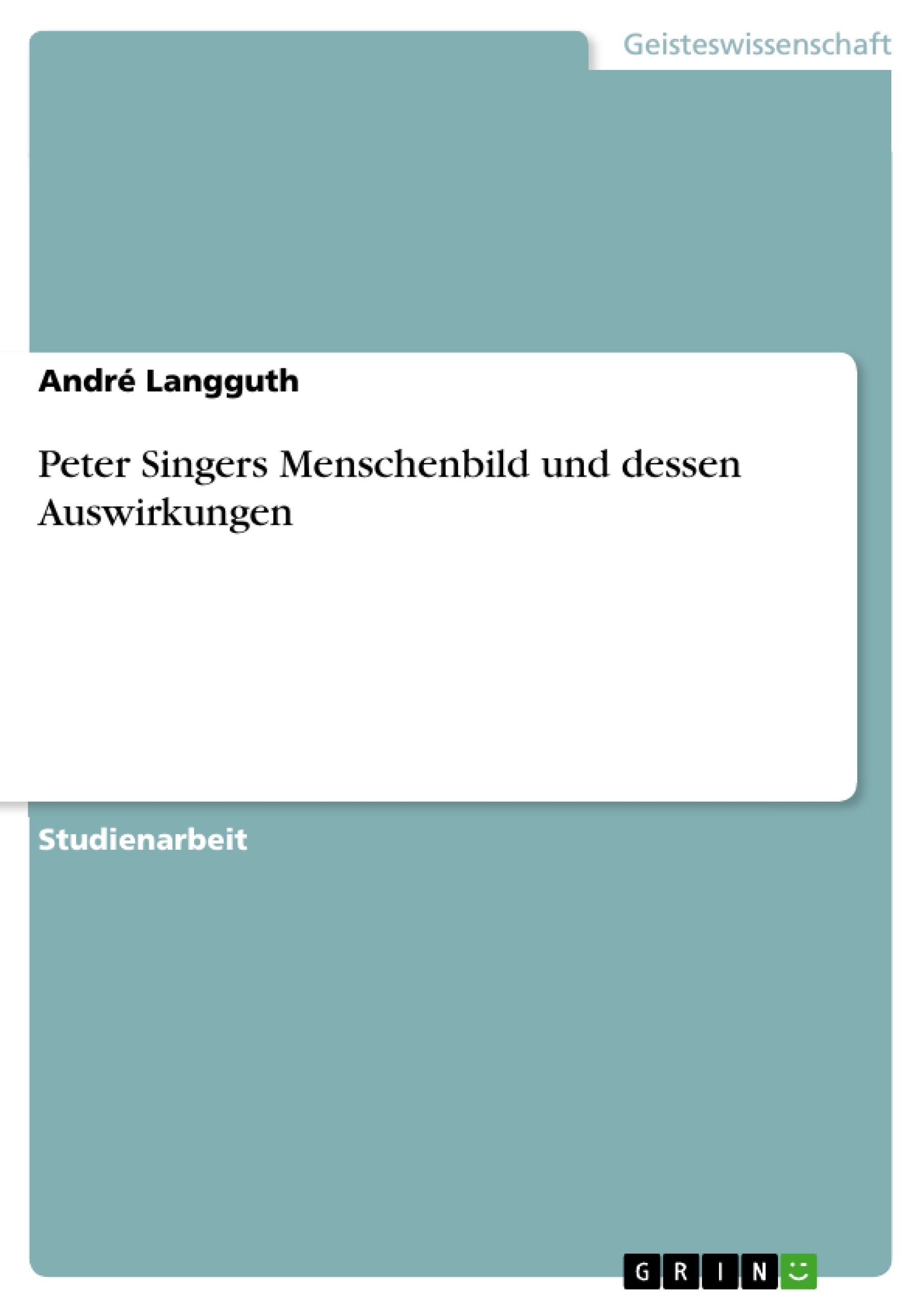Ausgehend von den stetig anhaltenden Diskussionen und Debatten über die Frage der Abtreibung von behinderten Embryonen bzw. der Euthanasie von schwerstbehinderten Menschen, möchte ich im Folgenden darlegen, wie ein vehementer Befürworter der Euthanasie argumentiert, bzw. wie er, Peter Singer, zu seinen radikalen Schlussfolgerungen gelangt und welche Folgen dies für Betroffene haben kann.
Durch meine Arbeit mit behinderten Menschen, deren Behinderungsgrad zum Teil sehr unterschiedlich ausgeprägt war, habe ich schwerst mehrfach behinderte Menschen kennen gelernt und mir des öfteren die unumgängliche Frage gestellt, ob dieses Leben wohl noch Lebenswert sei. Ich erinnere mich an dieses klein gewachsene, 12-jährige Mädchen, welches einen Wasserkopf (Hydrozephalus) hatte, der 1/3 ihrer Körpergröße einnahm. Sie ist seit der Geburt ans Bett gefesselt und keine weiteren Eigenschaften als schlafen, Essensaufnahme (Flüssignahrung) und weinen kann sie ihr Eigen nennen. Schwer zu sagen wie sie sich fühlt bzw. wie viel sie von ihrer Umwelt überhaupt wahrnimmt. Wie würde sie wohl antworten, könnte man sie fragen, ob dieses Leben für sie lebenswert sei? Wir wissen es nicht und werden es auch nie erfahren. Doch wir sollten uns darüber Gedanken machen, ob ein solches Dasein mit allen Mitteln der Technik unterstützt werden soll, oder ob man es der Natur überlassen sollte zu urteilen.
Für Peter Singer, „australischer Wissenschaftler und Cheftheoretiker der sogenannten “Neuen Euthanasie““ (vgl. Internet I) gibt es dahingehend keine Zweifel oder offene Fragen. Sein Urteil steht fest!
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zur Person Peter Singer
- 3. Präferenzutilitarismus, was ist das?
- 3.1. Utilitarismus
- 3.2. Präferenzutilitarismus
- 4. Das Menschenbild des Peter Singer
- 5. Die Argumentationsfolge des Peter Singer und die daraus resultierenden Konsequenzen für Betroffene
- 6. Stellungnahme der Lebenshilfe zu Peter Singer
- 7. Eigene Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Menschenbild von Peter Singer und die daraus resultierenden Konsequenzen, insbesondere im Kontext der Debatten um Abtreibung behinderter Embryonen und Euthanasie schwerstbehinderter Menschen. Die Arbeit analysiert Singers Argumentationslinie und deren ethische Implikationen.
- Das Menschenbild von Peter Singer und dessen Definition von „Mensch“ und „Person“
- Der Präferenzutilitarismus als ethische Grundlage von Singers Argumentation
- Die Konsequenzen von Singers Philosophie für Menschen mit Behinderungen
- Die Stellungnahme der Lebenshilfe zu Singers Position
- Eine kritische Auseinandersetzung mit Singers Argumentation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Anlass der Hausarbeit: die anhaltenden Debatten um Abtreibung behinderter Embryonen und Euthanasie schwerstbehinderter Menschen. Der Autor schildert seine persönlichen Erfahrungen mit schwerstbehinderten Menschen und die daraus resultierende Frage nach der Lebensqualität und dem Wert eines solchen Lebens. Die Arbeit stellt die Frage, ob ein solches Leben mit allen Mitteln unterstützt werden soll oder der Natur überlassen werden sollte, und führt Peter Singer als vehementen Befürworter der Euthanasie ein.
2. Zur Person Peter Singer: Dieses Kapitel beschreibt Peter Singer als australischen Wissenschaftler und Cheftheoretiker der „Neuen Euthanasie“. Seine akademische Karriere, seine frühere Tätigkeit als Tierschützer und die kontroverse Wirkung seines Buches „Praktische Ethik“ werden beleuchtet. Das Kapitel hebt die scharfe Kritik von Seiten der Behindertenpädagogik und Behindertenverbände hervor und führt Singers Zugehörigkeit zum Präferenzutilitarismus als Grundlage seiner Argumentation aus.
3. Präferenzutilitarismus, was ist das?: Dieses Kapitel erläutert den Präferenzutilitarismus, die ethische Grundlage von Singers Argumentation. Es beginnt mit einer historischen Betrachtung des Utilitarismus von Aristoteles bis zur modernen Interpretation, wobei der Fokus auf dem Nützlichkeitsprinzip und der Bewertung von Handlungen anhand ihrer Folgen liegt. Der Präferenzutilitarismus wird als moderne Variante vorgestellt, die Handlungen anhand der Präferenzen betroffener Wesen bewertet und die Bedeutung von zukunftsorientierten Präferenzen wie Selbstbewusstsein und der Fähigkeit, Interessen zu haben, hervorhebt.
4. Das Menschenbild des Peter Singer: Dieses Kapitel beschreibt Singers Menschenbild, das in zwei Kategorien unterteilt ist: Lebewesen mit menschlichen Genen (Homo sapiens) und „Personen“, die zusätzlich „typisch menschliche Eigenschaften“ wie Bewusstsein, Sprachfähigkeit und Vernunft besitzen. Singer ordnet Personen einen höheren Status zu als Lebewesen, die nur teilweise diese Eigenschaften aufweisen. Die Arbeit verdeutlicht die Implikationen dieser Unterscheidung für Menschen mit Behinderungen.
Schlüsselwörter
Peter Singer, Präferenzutilitarismus, Menschenbild, Behinderung, Euthanasie, Abtreibung, Lebensqualität, Ethik, moralische Bewertung, Lebenswert.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Arbeit über Peter Singer
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Menschenbild von Peter Singer und die daraus resultierenden Konsequenzen, insbesondere im Kontext der Debatten um Abtreibung behinderter Embryonen und Euthanasie schwerstbehinderter Menschen. Sie analysiert Singers Argumentationslinie und deren ethische Implikationen.
Wer ist Peter Singer und welche Rolle spielt er in dieser Arbeit?
Peter Singer wird als australischer Wissenschaftler und Cheftheoretiker der „Neuen Euthanasie“ vorgestellt. Seine akademische Karriere, seine frühere Tätigkeit als Tierschützer und die kontroverse Wirkung seines Buches „Praktische Ethik“ werden beleuchtet. Die Arbeit fokussiert auf seine Argumentation und deren ethische Auswirkungen, insbesondere für Menschen mit Behinderungen.
Welche ethische Grundlage verwendet Peter Singer?
Die Arbeit erläutert den Präferenzutilitarismus als ethische Grundlage von Singers Argumentation. Es wird erklärt, wie der Präferenzutilitarismus Handlungen anhand der Präferenzen betroffener Wesen bewertet und die Bedeutung von zukunftsorientierten Präferenzen wie Selbstbewusstsein und der Fähigkeit, Interessen zu haben, hervorhebt.
Wie definiert Peter Singer „Mensch“ und „Person“?
Singers Menschenbild wird in zwei Kategorien unterteilt: Lebewesen mit menschlichen Genen (Homo sapiens) und „Personen“, die zusätzlich „typisch menschliche Eigenschaften“ wie Bewusstsein, Sprachfähigkeit und Vernunft besitzen. Singer ordnet Personen einen höheren Status zu als Lebewesen, die nur teilweise diese Eigenschaften aufweisen. Die Arbeit verdeutlicht die Implikationen dieser Unterscheidung für Menschen mit Behinderungen.
Welche Konsequenzen ergeben sich aus Singers Philosophie für Menschen mit Behinderungen?
Die Arbeit analysiert die Konsequenzen von Singers Philosophie für Menschen mit Behinderungen, die sich aus seiner Definition von „Person“ und der Anwendung des Präferenzutilitarismus ergeben. Die ethischen Implikationen seiner Argumentation im Kontext von Abtreibung und Euthanasie werden untersucht.
Welche Stellungnahme nimmt die Lebenshilfe zu Peter Singer ein?
Die Arbeit beinhaltet eine Darstellung der Stellungnahme der Lebenshilfe zu Singers Position. Diese Stellungnahme wird im Kontext der gesamten Argumentation diskutiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Zur Person Peter Singer, Präferenzutilitarismus, Das Menschenbild des Peter Singer, Die Argumentationsfolge des Peter Singer und die daraus resultierenden Konsequenzen für Betroffene, Stellungnahme der Lebenshilfe zu Peter Singer und Eigene Stellungnahme.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Peter Singer, Präferenzutilitarismus, Menschenbild, Behinderung, Euthanasie, Abtreibung, Lebensqualität, Ethik, moralische Bewertung, Lebenswert.
- Arbeit zitieren
- André Langguth (Autor:in), 2003, Peter Singers Menschenbild und dessen Auswirkungen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/30689