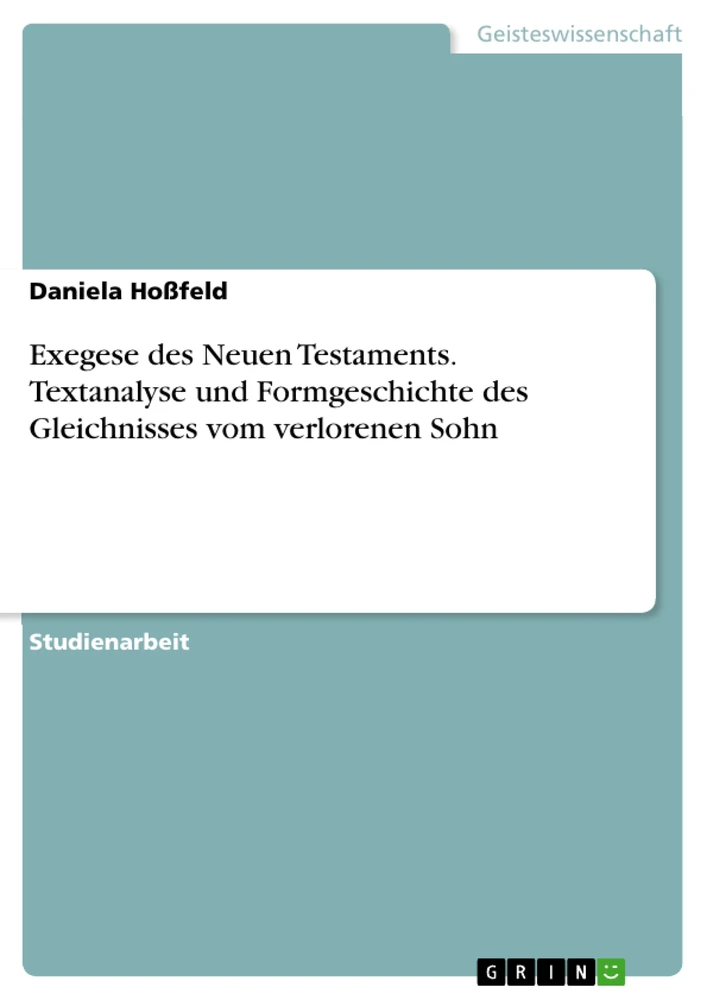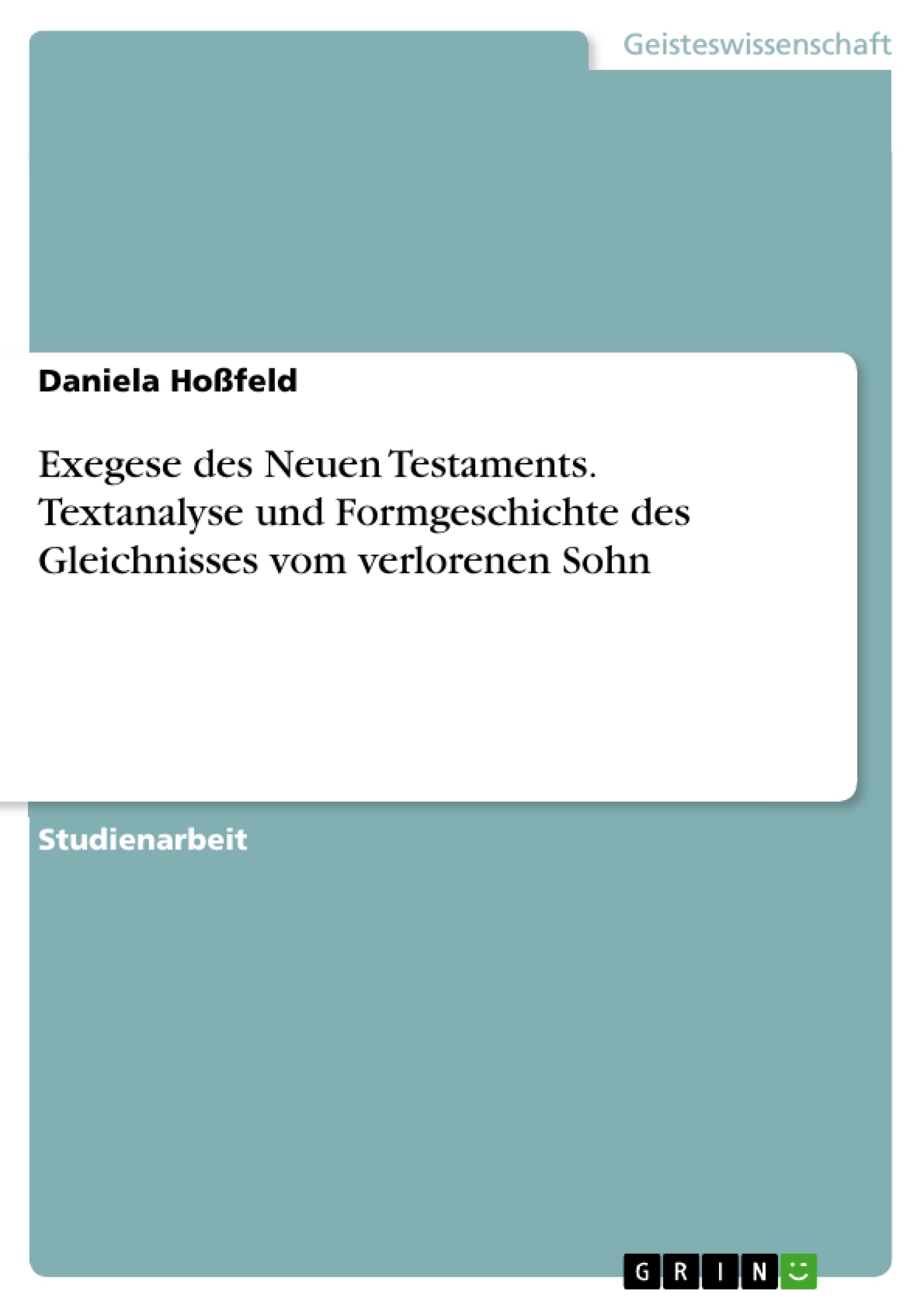Die folgende historisch - kritische Exegese über das Gleichnis „Vom verlorenen Sohn“ (Lk 15,11 - 32) soll durch die methodischen Schritte ‘Textkritik’, ‘Textanalyse’ mit Einbeziehung der ‘sprachlichen Analyse’, ‘Quellenkritik’, ‘Formgeschichte’ und ‘Redaktionsgeschichte’ von mehreren Seiten beleuchtet werden. Dabei habe ich mich an mehreren Methodenbüchern orientiert, bevorzugte allerdings meistens das Buch von Georg Strecker und Udo Schnelle: „Einführung in die neutestamentliche Exegese“.
Weitere methodische Schritte wie die ‘Begriffs - und Motivgeschichte’, die ich für mich behandelt habe, die ‘Hermeneutik’ etc. habe ich aus Gründen des Umfangs der Hausarbeit ausgeschlossen.
Auch den Punkt der ‘Gleichnistheorie’ habe ich in dieser Hausarbeit nicht mehr behandeln; ich habe mich im Großen und Ganzen an den gleichnistheoretischen Ansatz von Kurt Erlemann, der sich an E.Rau und E.Arens u. a. orientiert, seiner Gleichnisauslegung und seinen Untersuchungen bezüglich des Bildes Gottes, gehalten.
Jedoch habe ich auch anderen Auslegern wie Eta Linnemann, Karlheinz Sorger, Hans Weder u.a. in bestimmten Punkten zugestimmt und bin so an gewissen Stellen von Kurt Erlemann „abgedriftet“. Der methodische Schritt der ‘Textpragmatik’ ist in den behandelten Schritten immer wieder mit eingeflossen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Textkritik
- 3 Textanalyse
- 3.1 Abgrenzung
- 3.2 Kontextstellung
- 3.3 Einheitlichkeit des Textes - Sprachliche Stimmigkeit
- 3.4 Grobe Gliederung von Lk 15,11 - 32
- 3.5 Textaufbau
- 3.6 Die Figur des Vaters und das Bild Gottes in Lk 15,11 - 32
- 4 Quellenkritik
- 5 Formgeschichte
- 5.1 Gleichnisse
- 5.2 Formgeschichtliche Ergänzungen zum äußeren Aufbau der Parabel Lk 15, 11 - 32 auch im Hinblick auf seine Stilmerkmale
- 5.3 'Sitz im Leben'
- 5.4 Soziokultureller Hintergrund der Parabel Lk 15,11 - 32 (Zeit Jesu)
- 6 Redaktionsgeschichte
- 6.1 Der Verfasser, (End-) Redaktor Lukas, sein Evangelium und Gottesbild
- 6.2 Lk 15,11 - 32: Spezielle redaktionsgeschichtliche Anmerkungen der Ausleger
- 6.3 Abfassungszeit und Abfassungsort
- 6.4 Erfassung der Gesamtkomposition - Aufriss des Lk - Evangelium
- 7 Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lk 15,11-32) mittels historisch-kritischer Exegese. Ziel ist es, das Gleichnis unter Anwendung verschiedener exegetischer Methoden zu beleuchten und das darin präsentierte Gottesbild zu analysieren. Methodische Schritte wie Textkritik, Textanalyse, Quellenkritik, Formgeschichte und Redaktionsgeschichte werden angewendet.
- Das Gottesbild im Gleichnis vom verlorenen Sohn
- Die literarische Struktur und der Aufbau des Gleichnisses
- Der soziokulturelle Kontext des Gleichnisses zur Zeit Jesu
- Die redaktionsgeschichtlichen Aspekte des Gleichnisses im Lukas-Evangelium
- Vergleichende Analyse verschiedener Bibelübersetzungen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung beschreibt den methodischen Ansatz der Arbeit, der sich auf eine historisch-kritische Exegese des Gleichnisses vom verlorenen Sohn konzentriert. Es werden die angewandten Methoden (Textkritik, Textanalyse, Quellenkritik, Formgeschichte und Redaktionsgeschichte) erläutert und die Grenzen der Arbeit aufgrund des Umfangs definiert. Die zentrale Fragestellung nach dem Gottesbild im Gleichnis wird formuliert und der methodische Ablauf der einzelnen Kapitel skizziert. Der Bezug auf verschiedene Exegeten und deren Ansätze wird erwähnt, wobei die Auswahl aufgrund des Umfangs beschränkt ist. Die Arbeit konzentriert sich auf die Erforschung des Gottesbildes, um den Umfang des umfangreichen Gleichnisses einzuschränken.
2 Textkritik: Dieses Kapitel behandelt den methodischen Schritt der Textkritik, der die Feststellung des ursprünglichen Wortlauts eines Textes zum Ziel hat. Aufgrund fehlender Kenntnisse der griechischen Sprache stützt sich die Autorin auf verschiedene Bibelübersetzungen (Lutherbibel, Zürcher Bibel, katholische Einheitsübersetzung), um die Bedeutungsvielfalt der griechischen Wendungen sichtbar zu machen. Die Unterschiede zwischen den Übersetzungen werden kurz angesprochen, wobei eine detaillierte Analyse aufgrund des Umfangs des Gleichnisses unterlassen wird. Die unterschiedlichen Übersetzungsansätze werden für spätere Kapitel zur Interpretation verschiedener griechischer Begriffe herangezogen.
3 Textanalyse: Dieses Kapitel widmet sich der Untersuchung der literarischen Struktur des Gleichnisses. Es werden Aspekte wie Abgrenzung des Textes, Kontext, Aufbau, sprachliche und sachliche Stimmigkeit sowie die Einheitlichkeit des Textes untersucht. Die Kohärenz des Textes dient als Hilfsmittel zur Bestimmung der Abgrenzung und Einheitlichkeit. Die Ergebnisse der Textanalyse bilden die Grundlage für die folgenden methodischen Schritte. Die Autorin verwendet verschiedene Bibelübersetzungen, um die Abgrenzung des Gleichnisses zu bestimmen und bestätigt die Übereinstimmung in den verwendeten Bibelausgaben.
Schlüsselwörter
Gleichnis vom verlorenen Sohn, Lukas-Evangelium, historisch-kritische Exegese, Textkritik, Textanalyse, Quellenkritik, Formgeschichte, Redaktionsgeschichte, Gottesbild, Bibelübersetzungen, soziokultureller Kontext, Exegeten (Erlemann, Linnemann, Sorger, Weder).
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Gleichnis vom verlorenen Sohn
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit untersucht das Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lk 15,11-32) mittels historisch-kritischer Exegese. Der Fokus liegt auf der Analyse des im Gleichnis präsentierten Gottesbildes.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet verschiedene exegetische Methoden, darunter Textkritik, Textanalyse, Quellenkritik, Formgeschichte und Redaktionsgeschichte. Dabei werden verschiedene Bibelübersetzungen (Lutherbibel, Zürcher Bibel, katholische Einheitsübersetzung) herangezogen, um die Bedeutungsvielfalt des griechischen Originals zu erfassen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in diesen?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung (methodischer Ansatz, Fragestellung), Textkritik (Feststellung des ursprünglichen Wortlauts), Textanalyse (literarische Struktur, Aufbau, Kohärenz), Quellenkritik (nicht explizit detailliert im Preview), Formgeschichte (Gleichnisform, Kontext, soziokultureller Hintergrund), Redaktionsgeschichte (Verfasser Lukas, Abfassungszeit, Komposition des Lukas-Evangeliums) und Schluss. Jedes Kapitel bearbeitet einen spezifischen Aspekt der historisch-kritischen Exegese des Gleichnisses.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf das Gottesbild im Gleichnis, die literarische Struktur und den Aufbau, den soziokulturellen Kontext zur Zeit Jesu und die redaktionsgeschichtlichen Aspekte im Lukas-Evangelium. Ein Vergleich verschiedener Bibelübersetzungen wird ebenfalls angestellt.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird gegeben?
Die Zusammenfassung der Kapitel beschreibt kurz den Inhalt und die Methodik jedes Kapitels. Es wird betont, dass der Umfang der Arbeit die Detailtiefe der Analyse in einigen Bereichen begrenzt. Die Einleitung legt den methodischen Ansatz dar und skizziert den Ablauf. Die Textkritik befasst sich mit den unterschiedlichen Bibelübersetzungen. Die Textanalyse untersucht die literarische Struktur. Weitere Kapitel befassen sich mit der Quellen-, Form- und Redaktionsgeschichte.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter umfassen: Gleichnis vom verlorenen Sohn, Lukas-Evangelium, historisch-kritische Exegese, Textkritik, Textanalyse, Quellenkritik, Formgeschichte, Redaktionsgeschichte, Gottesbild, Bibelübersetzungen, soziokultureller Kontext, Exegeten (Erlemann, Linnemann, Sorger, Weder).
Welche Grenzen hat die Arbeit?
Aufgrund des Umfangs sind einige Aspekte nur oberflächlich behandelt. Die Autorin verfügt nicht über Kenntnisse des Griechischen und stützt sich daher auf Übersetzungen. Eine detaillierte Analyse aller Aspekte des Gleichnisses ist aufgrund des begrenzten Umfangs nicht möglich. Die Auswahl der Exegeten und der betrachteten Aspekte ist eingeschränkt.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist die Beleuchtung des Gleichnisses vom verlorenen Sohn unter Anwendung verschiedener exegetischer Methoden und die Analyse des darin präsentierten Gottesbildes.
- Quote paper
- Daniela Hoßfeld (Author), 2001, Exegese des Neuen Testaments. Textanalyse und Formgeschichte des Gleichnisses vom verlorenen Sohn, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/306857