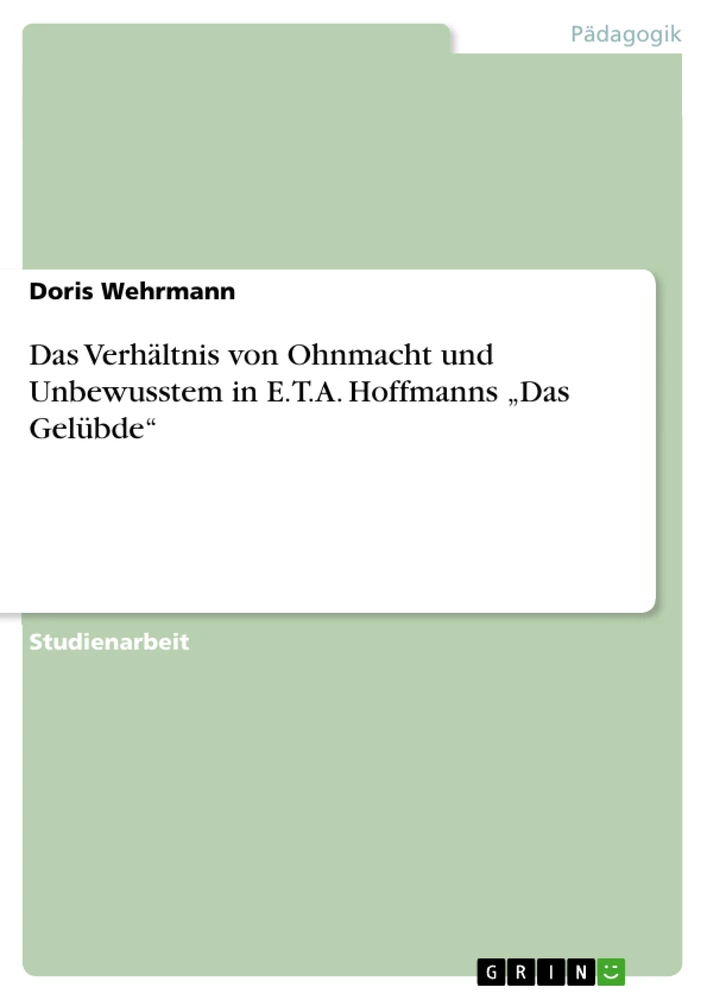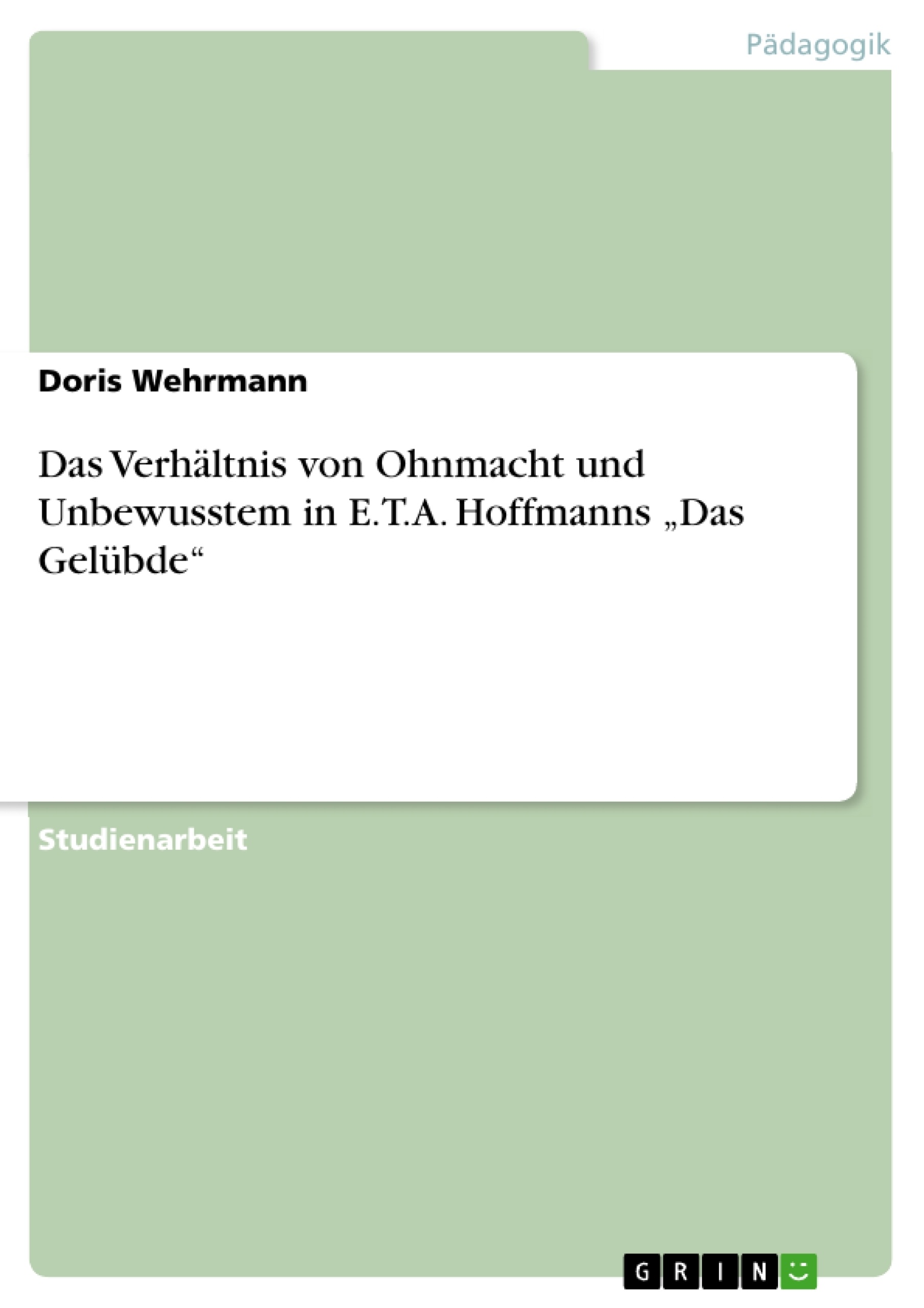Im Rahmen des Präsenzseminars „E.T.A. Hoffmann und das Unbewusste“ in München im Wintersemester 2014/2015 wurde der Aspekt des Unbewussten, in Anlehnung an Sigmund Freud, in E.T.A. Hoffmanns Nachtstücken, unter anderem am Beispiel der Novelle „Das Gelübde“, eingehend untersucht.
Neben Gemeinsamkeiten und Unterschieden zur bekannteren Novelle „Die Marquise von O…“ von Heinrich von Kleist lag das Augenmerk der Besprechung auf dem Motiv der Ohnmacht. Aus zeitlichen Gründen konnte das Verhältnis von Ohnmacht und Unbewusstem nicht umfassender besprochen werden, so dass ich mich dazu entschied, eine Hausarbeit zu dieser Thematik zu verfassen und somit näher darauf einzugehen.
Wie ich bereits bei meinen Recherchen feststellte, befasst sich die Wissenschaft zwar mit zahlreichen Facetten der Körpersprache und nonverbalen Kommunikation in der Literatur, jedoch kommt der Ohnmacht dabei eine eher nebensächliche, sogar vernachlässigte Rolle zu.
In Kapitel 2.1 und 2.2 der Hausarbeit wird daher ein Überblick zum Motiv der Bewusstlosigkeit gegeben sowie der Stand der Forschung skizziert.
Kapitel 2.3 widmet sich dem Vergleich von Ohnmacht und Unbewusstem, wobei ich lediglich Bezug zu literarischen Inszenierungen herstellen werde, da eine Ausweitung auf Bereiche der Psychoanalyse den Rahmen dieser Hausarbeit sprengen würde.
Im zweiten Teil der Arbeit unterziehe ich das Ohnmachtsmotiv und das Unbewusste anhand der ausgewählten Novelle einer näheren Betrachtung.
In Kapitel 3.1 werden unterschiedliche Formen der Ohnmacht dargestellt und verglichen. Anhand von Textbeispielen werde ich auf die handlungsrelevanten Verdrängungs- und Erkenntnisohnmacht eingehen.
Kapitel 3.2 befasst sich mit der unbewussten Wahrnehmung der Hauptfigur Hermenegilda.
Abschließend werde ich ein Fazit zu den erbrachten Untersuchungen ziehen und zusammenfassend aufzeigen, in welchem Verhältnis Ohnmacht und Unbewusstes zueinander stehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Ohnmacht in der Literatur
- Historischer Überblick zum Motiv der Ohnmacht
- Forschungsstand
- Ohnmacht und Unbewusstes
- E.T.A. Hoffmann: Das Gelübde
- Formen der Ohnmacht
- Unbewusste Wahrnehmung
- Das Verhältnis von Ohnmacht und Unbewusstem in E.T.A. Hoffmanns „Das Gelübde“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht das Verhältnis von Ohnmacht und Unbewusstem in E.T.A. Hoffmanns Novelle "Das Gelübde". Zuerst wird ein Überblick über die historische Rezeption des Ohnmachtsmotivs in der Literatur gegeben und der Forschungsstand zur Bewusstlosigkeit in literarischen Werken skizziert. Anschließend wird die Beziehung zwischen Ohnmacht und dem Unbewussten unter Bezugnahme auf psychoanalytische Theorien erläutert.
- Das Motiv der Ohnmacht in der Literatur
- Forschungsstand zur Ohnmacht in der Literatur
- Verhältnis von Ohnmacht und Unbewusstem
- Analyse der Ohnmachtsformen in "Das Gelübde"
- Unbewusste Wahrnehmung in "Das Gelübde"
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext des Präsenzseminars "E.T.A. Hoffmann und das Unbewusste" dar und erklärt die Motivation der Verfasserin, sich in ihrer Hausarbeit mit dem Verhältnis von Ohnmacht und Unbewusstem auseinanderzusetzen. Kapitel 2.1 und 2.2 geben einen historischen Überblick über die Rezeption des Ohnmachtsmotivs in der Literatur und skizzieren den Forschungsstand. Kapitel 2.3 widmet sich dem Vergleich von Ohnmacht und Unbewusstem, wobei die Verfasserin lediglich Bezug auf literarische Inszenierungen herstellt. Im zweiten Teil der Arbeit wird "Das Gelübde" von E.T.A. Hoffmann analysiert. Kapitel 3.1 untersucht die verschiedenen Formen der Ohnmacht in der Novelle, während Kapitel 3.2 die unbewusste Wahrnehmung der Hauptfigur Hermenegilda beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie Ohnmacht, Unbewusstes, Körpertheorie, literarische Inszenierung, Verdrängungsohnmacht, Erkenntnisohnmacht, unbewusste Wahrnehmung, Körpersprache, E.T.A. Hoffmann, "Das Gelübde", Sigmund Freud, Psychoanalyse.
- Quote paper
- Doris Wehrmann (Author), 2015, Das Verhältnis von Ohnmacht und Unbewusstem in E.T.A. Hoffmanns „Das Gelübde“, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/305527