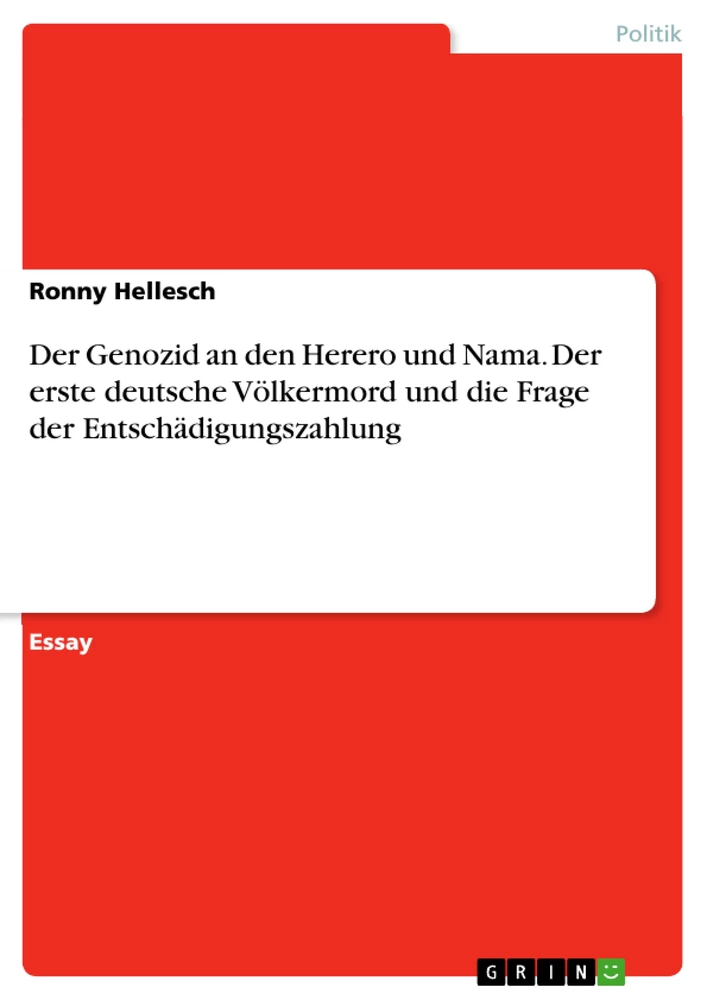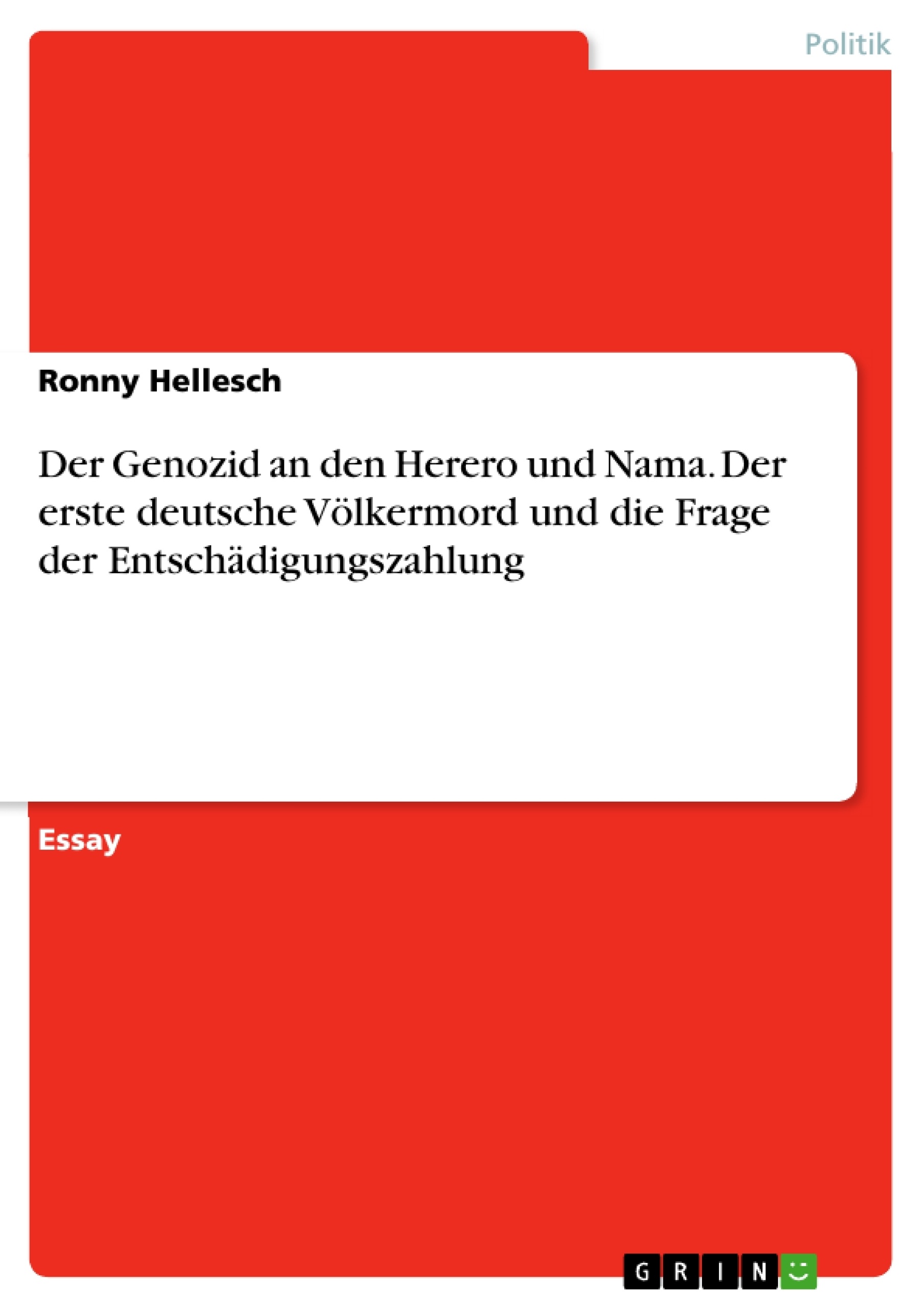„Verbrechen erinnern“ lautet nicht nur die Modulbeschreibung dieses Studium Fundamentale Seminars, sondern impliziert vor allem die zwingende Notwendigkeit, sich mit vergangenen Genoziden auseinanderzusetzen, um einerseits Verantwortung zu übernehmen und sich zugleich an die zahlreichen getöteten Menschen, deren Hinterbliebene und an das damit verbundene endlose Leid und den Schmerz zu erinnern und dessen zu gedenken. Kurzum eine Schuld zur Verpflichtung Erinnerungspolitik zu betreiben, um dadurch eine notwendige Aufarbeitung zu gewährleisten. So auch für den Genozid an den Herero und Nama 1904 – 1908.
Warum insbesondere die deutsche Bundesregierung – als höchste Ebene der Exekutive – nach über hundert Jahren immer noch bestreitet, dass es sich bei der brutalen Niederschlagung
des Aufstandes der ausgebeuteten Volksgruppen der Herero und Nama, durch deutsche Kolonialtruppen um einen bestialischen Völkermord handelte und dies euphemistisch mit der erst später in Kraft getretenen UN-Resolution 260 A (III) begründet, ist
nicht nur unfassbar, sondern vor allem beschämend, weshalb diese Problematik thematisiert werden muss. Denn an Verbrechen gehört erinnert. Hier vor allem an die 65.000 bis 85.000 Herero sowie etwa 10.000 Nama – Kinder, Frauen, Männer, jung und alt. Menschen.
Primär stellt dieses Essay den Versuch dar, die Frage zu beantworten, ob es ein Genozid war und Wiedergutmachung notwendig ist und wie diese aussehen könnte?
Daher lautet meine These: Die Bundesregierung verleugnet einen Völkermord und verharmlost die damit geschehenen Gräueltaten. Darüber hinaus entzieht sie sich bis heute ''erfolgreich'' einer finanziellen Entschädigung der Nachkommen – zu Unrecht.
Zunächst werde ich die schrecklichen Geschehnisse kurz nachzeichnen und anhand des Vernichtungs-Befehls des befehlshabenden Generalleutnant Lothar von Trotha untermauern, dass es sich eindeutig um einen Genozid gehandelt hat. Anschließend wird die juristische Problematik, bezüglich der erst 1955 für Deutschland in Kraft getretenen „UN-Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes“ beleuchtet und diskutiert, wobei sowohl die Wiedergutmachung an den Opfern der Shoa als auch die „fundamentalen Menschenrechte“ ins Feld geführt werden, um daraus abzuleiten, dass die Bundesregierung endlich für diesen Genozid offiziell Verantwortung übernehmen sowie gebotene
Entschädigungen – ideell und materiell – leisten sollte, ja muss.
Inhaltsverzeichnis
- Der erste deutsche Völkermord und der vehemente Versuch der Bundesregierung sich ihrer Verantwortung zu entziehen
- Der Genozid an den Herero und Nama
- Die schrecklichen Geschehnisse
- Die juristische Problematik
- Fundamentale Menschenrechte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Essay untersucht den Genozid an den Herero und Nama und die Weigerung der deutschen Bundesregierung, die volle Verantwortung dafür zu übernehmen. Es analysiert die historischen Ereignisse, die juristische Problematik der Rückwirkung und die moralische Verpflichtung zur Wiedergutmachung.
- Der Genozid an den Herero und Nama als historisches Ereignis
- Die juristische Auseinandersetzung mit dem Völkermord im Kontext der UN-Konvention
- Die Rolle der deutschen Bundesregierung und ihre Weigerung zur Wiedergutmachung
- Die moralische Verpflichtung Deutschlands zur Anerkennung des Genozids und zur Entschädigung
- Der Vergleich mit der Wiedergutmachung an den Opfern des Holocaust
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste deutsche Völkermord und der vehemente Versuch der Bundesregierung sich ihrer Verantwortung zu entziehen: Dieser Abschnitt führt in die Thematik ein und stellt die These auf, dass die deutsche Bundesregierung nicht nur den Völkermord an den Herero und Nama leugnet, sondern sich auch einer finanziellen Entschädigung der Nachkommen verweigert. Er skizziert den weiteren Aufbau des Essays und die zentrale Frage nach der Notwendigkeit von Wiedergutmachung.
Der Genozid an den Herero und Nama: Dieser Teil beschreibt den Kontext des Genozids, beginnend mit der deutschen Kolonialisierung Südwest Afrikas und den daraus resultierenden Konflikten um Land- und Wasserrechte. Er schildert den Aufstand der Herero und Nama, den darauf folgenden Vernichtungskrieg unter Generalleutnant Lothar von Trotha, die abscheuliche Strategie des Austrocknens in der Omaheke-Wüste, und Trothas Vernichtungsbefehl. Der Abschnitt betont das Ausmaß des Genozids und die menschenverachtenden Methoden der deutschen Kolonialtruppen.
Die juristische Problematik: Hier wird die Argumentation der deutschen Bundesregierung bezüglich der erst 1955 in Kraft getretenen UN-Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes beleuchtet. Der Essay kritisiert die Verwendung des Rückwirkungsverbots als Rechtfertigung für die Weigerung zur Wiedergutmachung und vergleicht die Situation mit der Wiedergutmachung an den Opfern des Holocausts. Es wird argumentiert, dass die Existenz des Völkermords vor der Konvention unbestreitbar ist und die Argumentation der Bundesregierung daher ungültig ist.
Fundamentale Menschenrechte: Dieser Abschnitt, obwohl unvollständig im gegebenen Text, verweist auf die Verletzung fundamentaler Menschenrechte als weiteren Aspekt der deutschen Verantwortung. Die Verletzung dieser Rechte unterstreicht die moralische Verpflichtung Deutschlands zur Anerkennung des Genozids und zur Entschädigung.
Schlüsselwörter
Genozid, Herero, Nama, Deutsch-Südwestafrika, Kolonialismus, Lothar von Trotha, Wiedergutmachung, UN-Konvention, Menschenrechte, Verantwortung, deutsche Bundesregierung, Kolonialkrieg, Vernichtungsbefehl.
Häufig gestellte Fragen zum Essay: "Der erste deutsche Völkermord und der vehemente Versuch der Bundesregierung sich ihrer Verantwortung zu entziehen"
Was ist das zentrale Thema des Essays?
Der Essay untersucht den Genozid an den Herero und Nama und die Weigerung der deutschen Bundesregierung, die volle Verantwortung dafür zu übernehmen. Er analysiert die historischen Ereignisse, die juristische Problematik und die moralische Verpflichtung zur Wiedergutmachung.
Welche Aspekte werden im Essay behandelt?
Der Essay behandelt den Genozid an den Herero und Nama als historisches Ereignis, die juristische Auseinandersetzung im Kontext der UN-Konvention, die Rolle der deutschen Bundesregierung und ihre Weigerung zur Wiedergutmachung, die moralische Verpflichtung Deutschlands zur Anerkennung des Genozids und zur Entschädigung sowie einen Vergleich mit der Wiedergutmachung an den Opfern des Holocausts.
Wie ist der Essay strukturiert?
Der Essay ist in Kapitel unterteilt, die den Genozid an den Herero und Nama, die juristische Problematik der Rückwirkung, die Weigerung der Bundesregierung zur Wiedergutmachung und die Verletzung fundamentaler Menschenrechte behandeln. Jedes Kapitel fasst die wichtigsten Punkte zusammen.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in jedem Kapitel?
Der erste deutsche Völkermord und der vehemente Versuch der Bundesregierung sich ihrer Verantwortung zu entziehen: Einleitung und These der Weigerung der Bundesregierung zur finanziellen Entschädigung. Der Genozid an den Herero und Nama: Beschreibung des Kontextes, des Aufstandes, des Vernichtungskrieges unter Generalleutnant Lothar von Trotha und der angewandten Strategien. Die juristische Problematik: Auseinandersetzung mit der Argumentation der Bundesregierung bezüglich der UN-Konvention und Kritik an der Verwendung des Rückwirkungsverbots. Fundamentale Menschenrechte: Verletzung fundamentaler Menschenrechte als weiterer Aspekt der deutschen Verantwortung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Essay?
Genozid, Herero, Nama, Deutsch-Südwestafrika, Kolonialismus, Lothar von Trotha, Wiedergutmachung, UN-Konvention, Menschenrechte, Verantwortung, deutsche Bundesregierung, Kolonialkrieg, Vernichtungsbefehl.
Was ist die zentrale These des Essays?
Die zentrale These ist, dass die deutsche Bundesregierung nicht nur den Völkermord an den Herero und Nama leugnet, sondern sich auch einer finanziellen Entschädigung der Nachkommen verweigert. Der Essay argumentiert für die Notwendigkeit von Wiedergutmachung.
Wie wird die juristische Problematik behandelt?
Der Essay kritisiert die Argumentation der deutschen Bundesregierung, die das Rückwirkungsverbot der UN-Konvention als Rechtfertigung für die Weigerung zur Wiedergutmachung benutzt. Er argumentiert, dass die Existenz des Völkermords vor der Konvention unbestreitbar ist und die Argumentation der Bundesregierung daher ungültig ist.
Welche Rolle spielt der Vergleich mit dem Holocaust?
Der Vergleich mit der Wiedergutmachung an den Opfern des Holocausts dient dazu, die moralische Verpflichtung Deutschlands zur Anerkennung des Genozids und zur Entschädigung hervorzuheben und die Argumentation der Bundesregierung zu widerlegen.
Wer sind die Herero und Nama?
Die Herero und Nama waren indigene Völker in Deutsch-Südwestafrika (heute Namibia), die während der deutschen Kolonialherrschaft einem Genozid ausgesetzt waren.
- Arbeit zitieren
- Ronny Hellesch (Autor:in), 2012, Der Genozid an den Herero und Nama. Der erste deutsche Völkermord und die Frage der Entschädigungszahlung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/303897