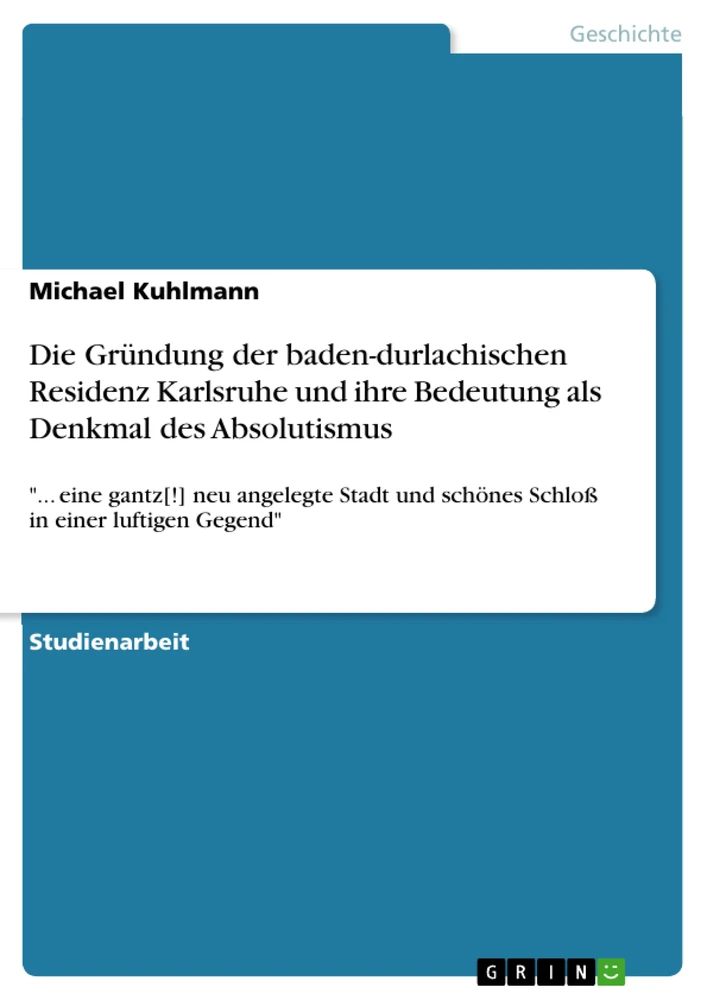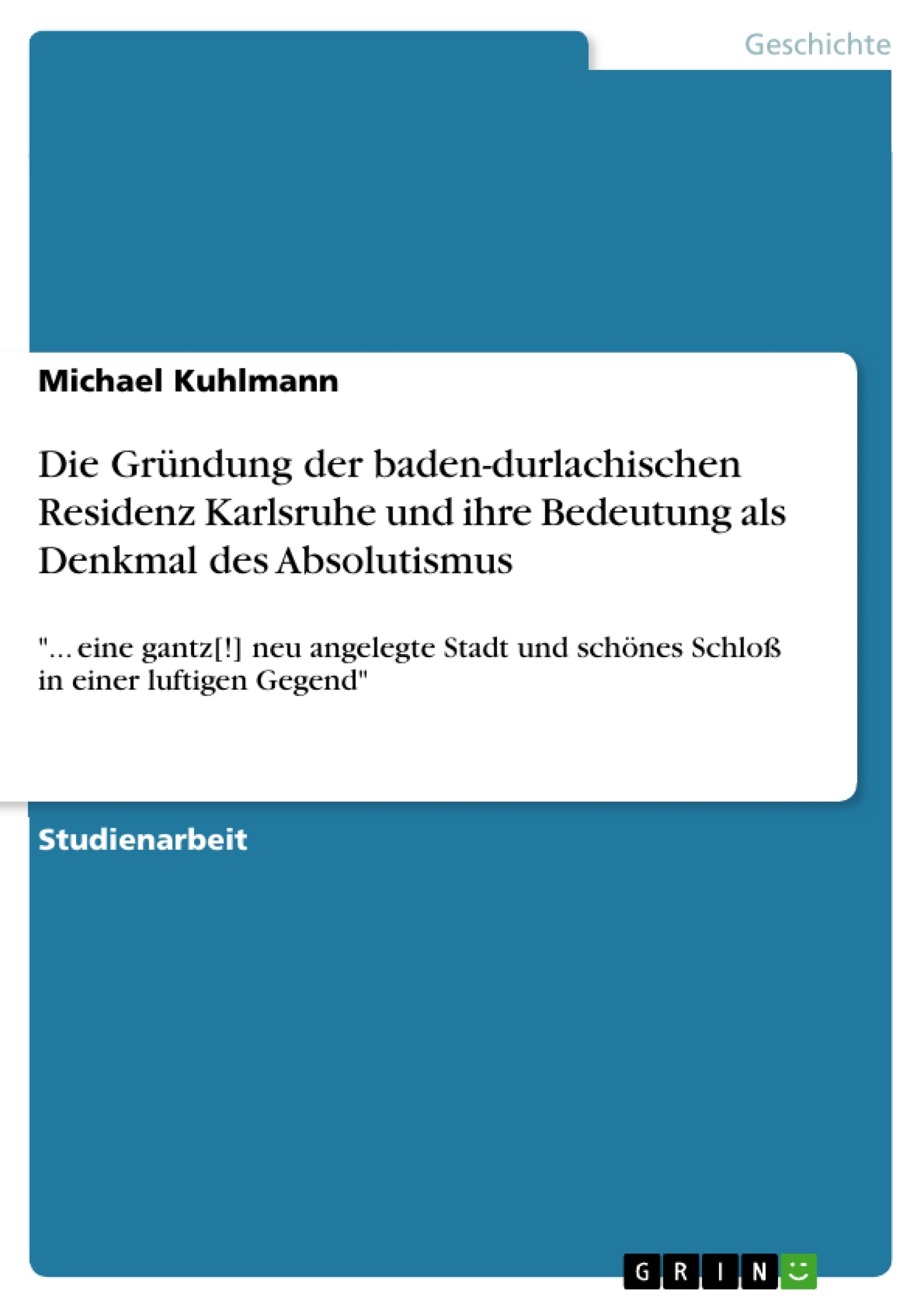Als im Jahre 1952 aus den Ländern Württemberg-Baden, Württemberg-Hohenzollern und Baden das Bundesland Baden-Württemberg wurde, ging für die nordbadische Stadt Karlsruhe eine Epoche zuende. Für mehr als zwei Jahrhunderte war sie die Hauptstadt eines selbständigen Landes gewesen, ein Schauplatz absolutistischer Machtausübung wie auch erster parlamentarischer Arbeit in Deutschland. Später hatte die aufkommende Industrialisierung auch hier das Stadtbild geprägt. Karlsruhe wurde zur lebendigen Metropole Badens, bis die Bomben des Zweiten Weltkrieges das Gesicht der Stadt weitgehend veränderten.
Trotz aller Zerstörungen blieb bis heute erkennbar, was das Charakteristikum Karlsruhes ausmachte: Sein im frühen 18. Jahrhundert angelegter fächerförmiger Kern hat die Zeiten überdauert. Von einem im Zentrum gelegenen Schloß ausgehend entwarfen die Planer eine Residenz, die eine Verbindung aus herrschaftlicher Repräsentation und herrscherlicher Zerstreuung, aus geschäftiger Siedlung und großzügigem Waldgebiet darstellte. Die politische Grundvoraussetzung, unter der ein solches Bauvorhaben in die Tat umgesetzt werden konnte, war das Bestehen eines absolutistischen Staates.
Zwar haben auch spätere Umwälzungen vor allem sozioökonomischer Natur im Grundriß Karlsruhes ihren Niederschlag gefunden, gegenüber der in diesen Zeiten entstandenen unregelmäßigen Bebauung ist das geometrisch angelegte Stadtzentrum mit dem Schloß jedoch umso weniger zu übersehen. Heute kann Karlsruhe somit als ein Denkmal gelten, das an die Epoche des Absolutismus ebenso zu erinnern vermag wie an das industrielle Zeitalter.
Die Arbeit beschreibt die Entstehung der baden-durlachischen Residenzstadt und geht zum Abschluß der Frage nach, inwiefern diese ein Denkmal ihrer Gründungsepoche, des frühen 18. Jahrhunderts darstellt.
Der einleitende Abschnitt des Hauptteils skizziert die politischen Rahmenbedingungen. Der anschließende Teil beschreibt Planung und Bau der Residenz. Schließlich versucht der Schlußabschnitt, zu zeigen, inwieweit die "Fächerstadt" heute als Denkmal betrachtet werden kann.
Als sie 1715 entstand, versinnbildlichte sie in strenger Geometrie - ob freiwillig oder unfreiwillig - das Ideal politischer Machtverhältnisse. Daneben hat die wirtschaftliche Abhängigkeit einer Residenzstadt vom Hofe in ihrem Grundriß symbolischen Ausdruck gefunden. Rückblickend betrachtet haben jedoch auch die tatsächlichen Zeitumstände ihre Spuren hinterlassen: Die Epoche des Absolutismus geht zuende.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Die badischen Markgrafschaften zwischen dem Pfälzischen Erbfolgekrieg und dem Frieden von Rastatt 1714
- II. Die Residenz Karls III. Wilhelm
- 1. Der neue Landesherr
- 2. Der markgräfliche Hof - in Durlach ohne Zukunft
- 3. Das Projekt
- 4. "Carolsruhe" entsteht
- a) Das Schloß im Hardtwald
- b) Die Gartenanlagen
- c) Residenzschloß oder Residenzstadt?
- d) Stadtanlage und Bebauung
- III. Karlsruhe als Denkmal
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gründung der Residenzstadt Karlsruhe und ihre Bedeutung als Denkmal des Absolutismus. Sie beleuchtet die politischen, planerischen und architektonischen Aspekte der Stadtentstehung im frühen 18. Jahrhundert.
- Die politischen Rahmenbedingungen der Gründung Karlsruhes
- Die Planung und der Bau der Residenzstadt
- Karlsruhe als Symbol absolutistischer Macht
- Der Einfluss der wirtschaftlichen Abhängigkeit vom Hof
- Karlsruhe als Denkmal des Absolutismus und des industriellen Zeitalters
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die historische Bedeutung Karlsruhes als Hauptstadt eines selbständigen Landes und beleuchtet dessen Entwicklung vom absolutistischen Zentrum bis zur modernen Metropole. Sie hebt den fächerförmigen Stadtkern als charakteristisches Merkmal hervor und stellt die Bedeutung des Absolutismus für die Stadtplanung heraus. Die Arbeit konzentriert sich auf die Architektur der Stadt im Zusammenhang mit ihrer Gründung im frühen 18. Jahrhundert, analysiert die politischen Rahmenbedingungen, Planung und Bau der Residenz und untersucht, inwieweit Karlsruhe als Denkmal der Gründungsepoche betrachtet werden kann.
I. Die badischen Markgrafschaften zwischen dem Pfälzischen Erbfolgekrieg und dem Frieden von Rastatt 1714: Dieses Kapitel wird einen Überblick über die politische Situation der badischen Markgrafschaften in der Zeit vor der Gründung Karlsruhes liefern. Es wird die relevanten Ereignisse und Entwicklungen, die zu der Entscheidung für den Bau einer neuen Residenz geführt haben, aufzeigen, den Einfluss des Pfälzischen Erbfolgekriegs und des Friedens von Rastatt auf die badischen Markgrafschaften erläutern, und die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen skizzieren, die die Gründung Karlsruhes ermöglichten. Es wird detailliert auf die politische Landschaft und die strategischen Überlegungen eingehen, die die Markgrafen bei ihrer Entscheidung beeinflusst haben.
II. Die Residenz Karls III. Wilhelm: Dieses Kapitel analysiert detailliert die Entstehung der Residenz unter Markgraf Karl Wilhelm. Es wird die Persönlichkeit des neuen Landesherrn und die Unzulänglichkeiten des bisherigen Hofes in Durlach untersuchen. Die Kapitel werden sich intensiv mit dem Projekt "Carolsruhe" auseinandersetzen, den Entwurf des Schlosses im Hardtwald, die Gestaltung der Gartenanlagen und die Konzeption der Residenzstadt umfassend beleuchten. Die Analyse wird dabei die Verbindung von herrschaftlicher Repräsentation und Zerstreuung, sowie die Balance zwischen geschäftiger Siedlung und großzügigem Waldgebiet, untersuchen. Besondere Aufmerksamkeit wird der Stadtanlage und der Bebauung gewidmet werden, einschließlich der detaillierten Analyse der fächerförmigen Struktur und ihrer Bedeutung.
Schlüsselwörter
Karlsruhe, Residenzstadt, Absolutismus, Stadtplanung, Architektur, Markgraf Karl Wilhelm, Fächerstadt, 18. Jahrhundert, Denkmal, Planstadt, Baden-Durlach.
Häufig gestellte Fragen zur Gründung Karlsruhes
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Dieser Text ist eine umfassende Vorschau auf eine wissenschaftliche Arbeit über die Gründung der Residenzstadt Karlsruhe. Er enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Gründung Karlsruhes im Kontext des Absolutismus und seiner Bedeutung als Denkmal dieser Epoche.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptkapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel über die badischen Markgrafschaften zwischen dem Pfälzischen Erbfolgekrieg und dem Frieden von Rastatt (1714), und ein Kapitel über die Residenz Karls III. Wilhelm mit Fokus auf die Entstehung Karlsruhes. Das letzte Kapitel behandelt Karlsruhe als Denkmal.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Gründung der Residenzstadt Karlsruhe und ihre Bedeutung als Denkmal des Absolutismus. Sie beleuchtet die politischen, planerischen und architektonischen Aspekte der Stadtentstehung im frühen 18. Jahrhundert.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die politischen Rahmenbedingungen der Gründung Karlsruhes, die Planung und den Bau der Residenzstadt, Karlsruhe als Symbol absolutistischer Macht, den Einfluss der wirtschaftlichen Abhängigkeit vom Hof und Karlsruhe als Denkmal des Absolutismus und des industriellen Zeitalters.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung beschreibt die historische Bedeutung Karlsruhes als Hauptstadt eines selbständigen Landes und seine Entwicklung vom absolutistischen Zentrum zur modernen Metropole. Sie hebt den fächerförmigen Stadtkern hervor und betont die Bedeutung des Absolutismus für die Stadtplanung. Die Arbeit konzentriert sich auf die Architektur im Zusammenhang mit der Gründung im frühen 18. Jahrhundert, analysiert die politischen Rahmenbedingungen, Planung und Bau der Residenz und untersucht, inwieweit Karlsruhe als Denkmal der Gründungsepoche betrachtet werden kann.
Worüber handelt Kapitel I ("Die badischen Markgrafschaften...")?
Kapitel I liefert einen Überblick über die politische Situation der badischen Markgrafschaften vor der Gründung Karlsruhes. Es zeigt die Ereignisse und Entwicklungen auf, die zur Entscheidung für den Bau einer neuen Residenz führten, erläutert den Einfluss des Pfälzischen Erbfolgekriegs und des Friedens von Rastatt und skizziert die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gründung.
Worüber handelt Kapitel II ("Die Residenz Karls III. Wilhelm")?
Kapitel II analysiert detailliert die Entstehung der Residenz unter Markgraf Karl Wilhelm. Es untersucht die Persönlichkeit des Landesherrn, die Unzulänglichkeiten des Hofes in Durlach und das Projekt "Carolsruhe". Es beleuchtet den Entwurf des Schlosses, die Gartenanlagen, die Konzeption der Residenzstadt, die Verbindung von herrschaftlicher Repräsentation und Zerstreuung und die Stadtanlage mit ihrer fächerförmigen Struktur.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter sind: Karlsruhe, Residenzstadt, Absolutismus, Stadtplanung, Architektur, Markgraf Karl Wilhelm, Fächerstadt, 18. Jahrhundert, Denkmal, Planstadt, Baden-Durlach.
- Quote paper
- Michael Kuhlmann (Author), 1994, Die Gründung der baden-durlachischen Residenz Karlsruhe und ihre Bedeutung als Denkmal des Absolutismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/303215