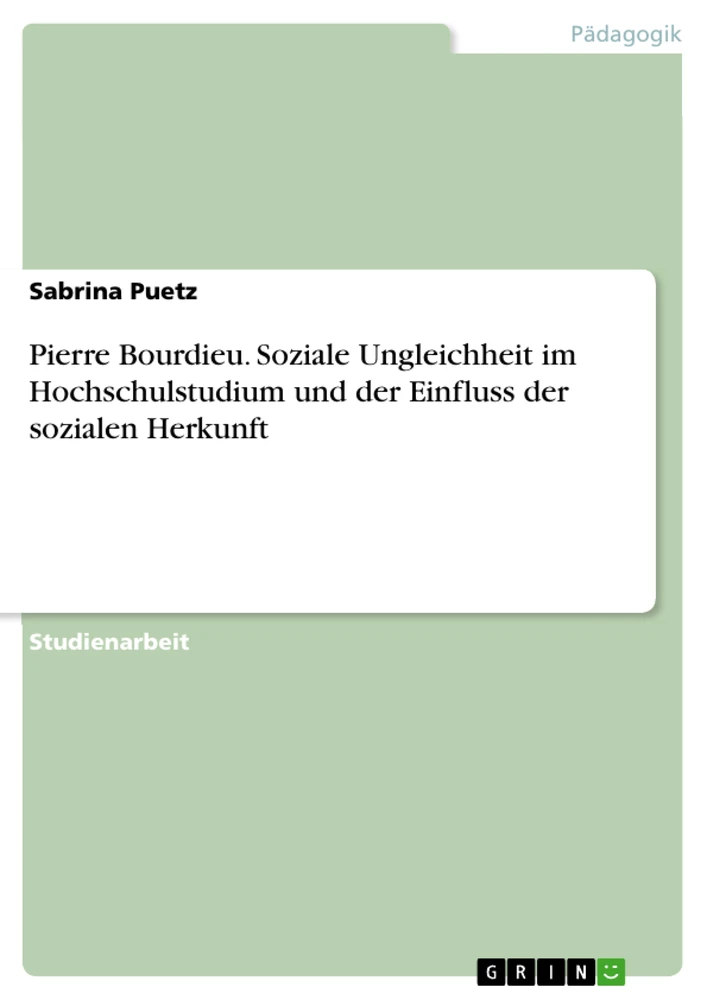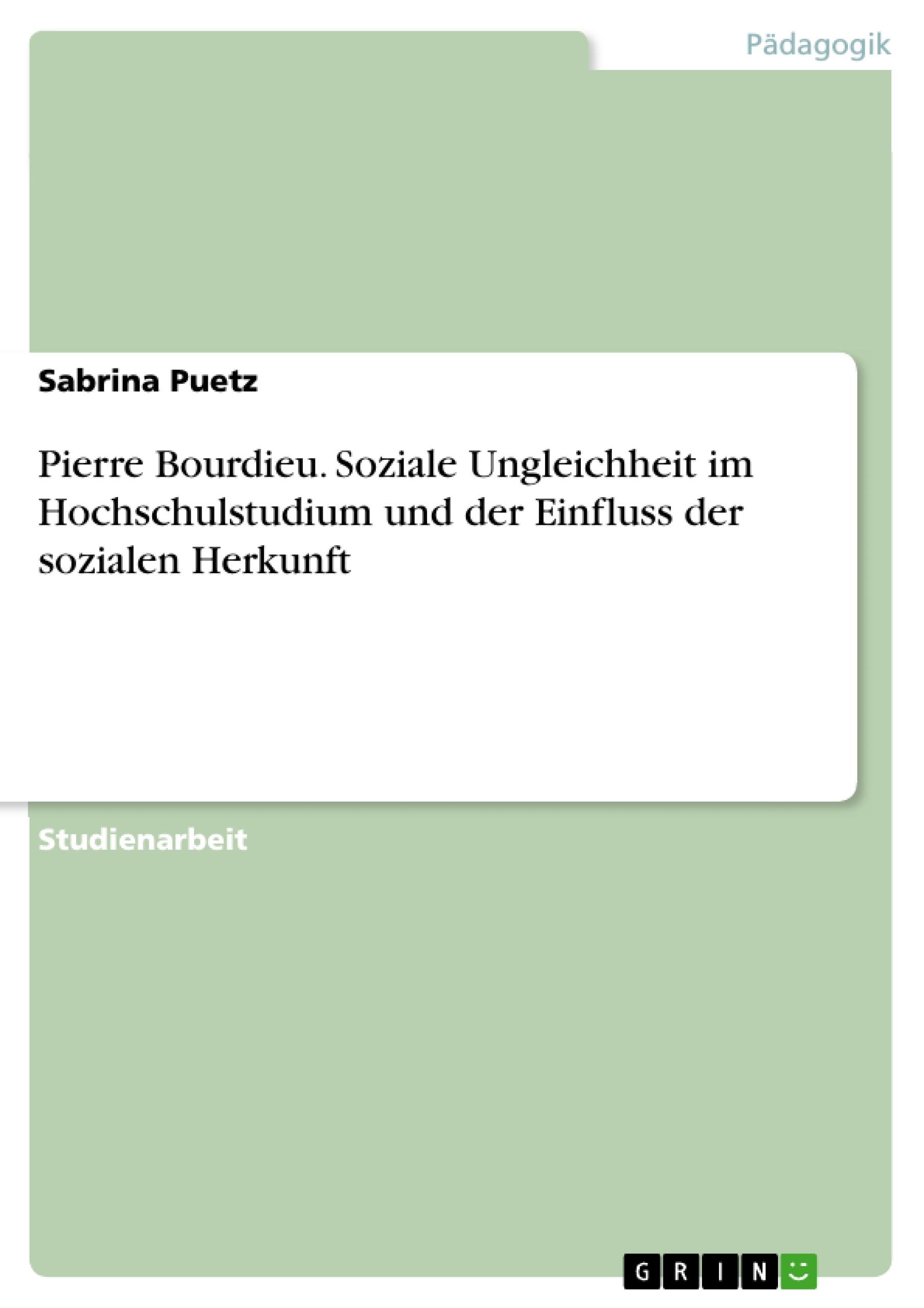„Wenn man sich anstrengt, kann man alles erreichen!“. Dieser gut gemeinte Ratschlag wird häufig erteilt, wenn in unserer Gesellschaft über Bildungs- und Aufstiegschancen gesprochen wird. Doch hängt der Bildungserfolg in der modernen Gesellschaft tatsächlich allein von der individuellen Leistungsbereitschaft ab? Viele Studien verweisen auf einen Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft und dem Bildungserfolg. So haben die Untersuchungen der internationalen Schulleistungsstudie PISA bereits im Jahr 2000 gezeigt, dass „in allen PISA-Teilnehmerstaaten ein Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und erworbenen Kompetenzen [besteht]“
(PISA-Konsortium 2000, S.57). Kinder, deren Eltern einen hohen sozioökonomischen Status aufweisen, erreichen in der Regel ein höheres Kompetenzniveau als diejenigen, deren Eltern der Arbeiterklasse angehören (vgl. ebd.). Besonders in Deutschland ist der Schulerfolg von der sozialen Herkunft und der familiären Orientierung abhängig. Diese Entwicklung wirkt angesichts der Forderung nach Chancengleichheit im Bildungssystem alarmierend. Es stellt sich die Frage, ob von diesem Umstand nicht nur SchülerInnen der Sekundarstufe, sondern auch zunehmend Studierende der Hochschulen betroffen sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Soziale Ungleichheit – Begriffsklärung
- 2.1 Bildungsbenachteiligungen und Chancengleichheit
- 3. Pierre Bourdieu und soziale Ungleichheit
- 3.1 Das Modell des sozialen Raum – zentrale Begriffe
- 3.2 Der Kapitalbegriff
- 3.2.1 Das ökonomische Kapital
- 3.2.2 Das kulturelle Kapital
- 3.2.3 Das soziale Kapital
- 3.2.4 Symbolisches Kapital
- 3.2.5 Kapitalumwandlungen
- 4. Soziale Ungleichheit im Hochschulstudium
- 4.1 „Die Illusion der Chancengleichheit“ in Frankreich
- 4.2 Betrachtung aktueller Forschungsergebnisse in Deutschland
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss sozialer Herkunft auf den Bildungserfolg im Hochschulstudium. Sie analysiert, inwieweit soziale Ungleichheiten die Chancen auf Bildung beeinflussen und wie diese Ungleichheiten reproduziert werden. Die Arbeit stützt sich dabei auf das Werk von Pierre Bourdieu und Jean-Claude Passeron und bezieht aktuelle Forschungsergebnisse mit ein.
- Definition und Erklärung sozialer Ungleichheit
- Bourdieus Kapitalbegriff und sein Modell des sozialen Raums
- Die Rolle von Bildungsbenachteiligung und Chancengleichheit
- Analyse der sozialen Ungleichheit im französischen und deutschen Hochschulsystem
- Reproduktion sozialer Ungleichheit durch das Bildungssystem
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg im Hochschulstudium. Sie verweist auf Studien wie PISA, die einen solchen Zusammenhang aufzeigen, und die Arbeit der Hans-Böckler-Stiftung, welche die Benachteiligung von Studierenden aufgrund ihrer sozialen Herkunft beleuchtet. Die Einleitung führt das Werk von Bourdieu und Passeron ein und skizziert den Aufbau der Arbeit, der die Definition wichtiger Begriffe, die Erläuterung von Bourdieus Modell und die Anwendung dieser Konzepte auf das französische und deutsche Hochschulsystem umfasst.
2. Soziale Ungleichheit - Begriffsklärung: Dieses Kapitel definiert den Begriff der sozialen Ungleichheit, basierend auf Hradils Definition, die soziale Ungleichheit mit der ungleichen Verteilung von gesellschaftlich wertvollen Gütern verbindet. Es erläutert, dass diese Güter (z.B. Einkommen, Bildung, soziale Netzwerke) die Lebenschancen beeinflussen und dass eine ungleiche Verteilung zu unterschiedlichen sozialen Positionen führt. Das Kapitel legt den Grundstein für die spätere Analyse, indem es die Bedeutung von Bildung als wichtige Ressource für den sozialen Aufstieg hervorhebt und den Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und Bildung benennt.
2.1 Bildungsbenachteiligungen und Chancengleichheit: Dieses Kapitel unterstreicht die zentrale Bedeutung von Bildung für den individuellen und gesellschaftlichen Erfolg. Es betont die Bedeutung von Chancengleichheit im Bildungssystem, wobei der Bildungserfolg idealerweise nur von der individuellen Leistung abhängen sollte, nicht aber von sozioökonomischen Faktoren. Der Widerspruch zwischen diesem Ideal und der Realität von Bildungsbenachteiligungen wird hervorgehoben. Das Kapitel führt den Begriff der Chancengleichheit ein und deutet bereits die Problematik der ungleichen Verteilung von Bildungsressourcen an.
3. Pierre Bourdieu und soziale Ungleichheit: Dieses Kapitel widmet sich Bourdieus Theorie sozialer Ungleichheit, einschliesslich seines Konzepts des sozialen Raums und der verschiedenen Kapitalformen (ökonomisches, kulturelles, soziales und symbolisches Kapital). Die Analyse des Kapitalbegriffes und die Erklärung der Kapitalumwandlungsprozesse bilden die theoretische Grundlage für die nachfolgenden Analysen der sozialen Ungleichheit im Hochschulsystem. Bourdieus Modell dient als analytisches Werkzeug für die Untersuchung der Reproduktion von Ungleichheiten.
4. Soziale Ungleichheit im Hochschulstudium: Dieses Kapitel befasst sich mit der Anwendung von Bourdieus Theorie auf das Hochschulstudium, zunächst am Beispiel Frankreichs und anschliessend mit aktuellen Forschungsergebnissen aus Deutschland. Der Vergleich der beiden Systeme ermöglicht eine differenzierte Betrachtung der Problematik und deckt mögliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf. Die Ausführungen befassen sich mit der "Illusion der Chancengleichheit" im Hochschulwesen und beleuchten die komplexen Zusammenhänge zwischen sozialer Herkunft und Studienabschluss.
Schlüsselwörter
Soziale Ungleichheit, Hochschulstudium, Pierre Bourdieu, Kapital (ökonomisches, kulturelles, soziales, symbolisches), Bildungsbenachteiligung, Chancengleichheit, Reproduktion sozialer Ungleichheit, Bildungserfolg, soziale Herkunft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text "Soziale Ungleichheit im Hochschulstudium"
Was ist der zentrale Gegenstand dieses Textes?
Der Text untersucht den Einfluss sozialer Herkunft auf den Bildungserfolg im Hochschulstudium. Er analysiert, wie soziale Ungleichheiten die Bildungschancen beeinflussen und wie diese Ungleichheiten reproduziert werden.
Welche Theorien und Konzepte werden im Text verwendet?
Der Text stützt sich maßgeblich auf die Theorie von Pierre Bourdieu und Jean-Claude Passeron, insbesondere auf Bourdieus Kapitalbegriff (ökonomisches, kulturelles, soziales und symbolisches Kapital) und sein Modell des sozialen Raums. Aktuelle Forschungsergebnisse aus Frankreich und Deutschland werden ebenfalls einbezogen.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es in ihnen?
Der Text gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) stellt die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit vor. Kapitel 2 (Soziale Ungleichheit – Begriffsklärung) definiert den Begriff der sozialen Ungleichheit und beleuchtet Bildungsbenachteiligungen und Chancengleichheit. Kapitel 3 (Pierre Bourdieu und soziale Ungleichheit) erläutert Bourdieus Theorie. Kapitel 4 (Soziale Ungleichheit im Hochschulstudium) wendet Bourdieus Theorie auf das französische und deutsche Hochschulsystem an. Kapitel 5 (Schlussbetrachtung) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Rolle spielt Pierre Bourdieu in diesem Text?
Bourdieus Theorie sozialer Ungleichheit, insbesondere sein Kapitalbegriff und sein Modell des sozialen Raums, bilden die zentrale theoretische Grundlage der Analyse. Seine Konzepte dienen als analytisches Werkzeug, um die Reproduktion sozialer Ungleichheiten im Bildungssystem zu untersuchen.
Welche Arten von Kapital werden im Text unterschieden?
Der Text unterscheidet zwischen ökonomischem, kulturellem, sozialem und symbolischem Kapital. Es wird erläutert, wie diese verschiedenen Kapitalformen zusammenwirken und wie sie ineinander umgewandelt werden können, um soziale Ungleichheiten zu reproduzieren.
Wie wird die soziale Ungleichheit im Hochschulstudium im Text behandelt?
Der Text analysiert die soziale Ungleichheit im Hochschulstudium anhand von Beispielen aus Frankreich und Deutschland. Er untersucht die "Illusion der Chancengleichheit" und beleuchtet die komplexen Zusammenhänge zwischen sozialer Herkunft und Studienabschluss. Aktuelle Forschungsergebnisse werden herangezogen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Soziale Ungleichheit, Hochschulstudium, Pierre Bourdieu, Kapital (ökonomisches, kulturelles, soziales, symbolisches), Bildungsbenachteiligung, Chancengleichheit, Reproduktion sozialer Ungleichheit, Bildungserfolg, soziale Herkunft.
Welche zentrale Forschungsfrage wird im Text behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie wirkt sich die soziale Herkunft auf den Bildungserfolg im Hochschulstudium aus, und wie werden soziale Ungleichheiten im Bildungssystem reproduziert?
Für welche Zielgruppe ist dieser Text gedacht?
Der Text richtet sich an eine akademische Zielgruppe, die sich mit Fragen der sozialen Ungleichheit und des Bildungssystems auseinandersetzt. Er ist geeignet für Studierende, Wissenschaftler und alle, die sich für die Thematik interessieren.
Wo kann ich den vollständigen Text einsehen?
Die Frage nach dem Zugriff auf den vollständigen Text kann hier nicht beantwortet werden. Die Informationen basieren auf einer vorher bereitgestellten HTML-Struktur des Inhaltsverzeichnisses, der Zielsetzung und der Kapitelzusammenfassungen.
- Quote paper
- Sabrina Puetz (Author), 2015, Pierre Bourdieu. Soziale Ungleichheit im Hochschulstudium und der Einfluss der sozialen Herkunft, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/301287