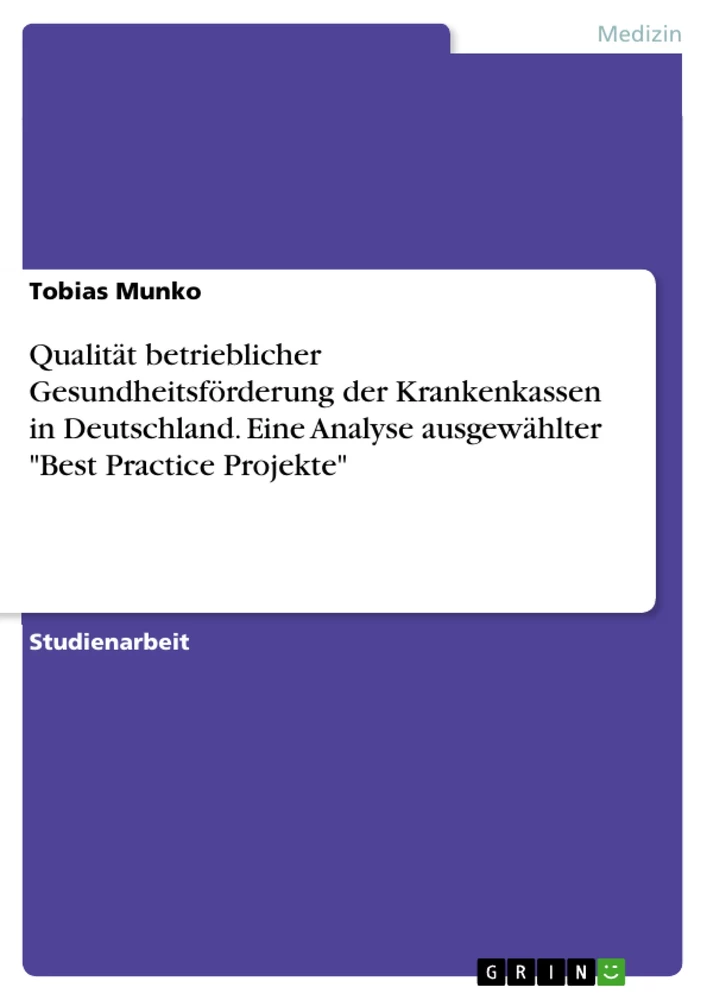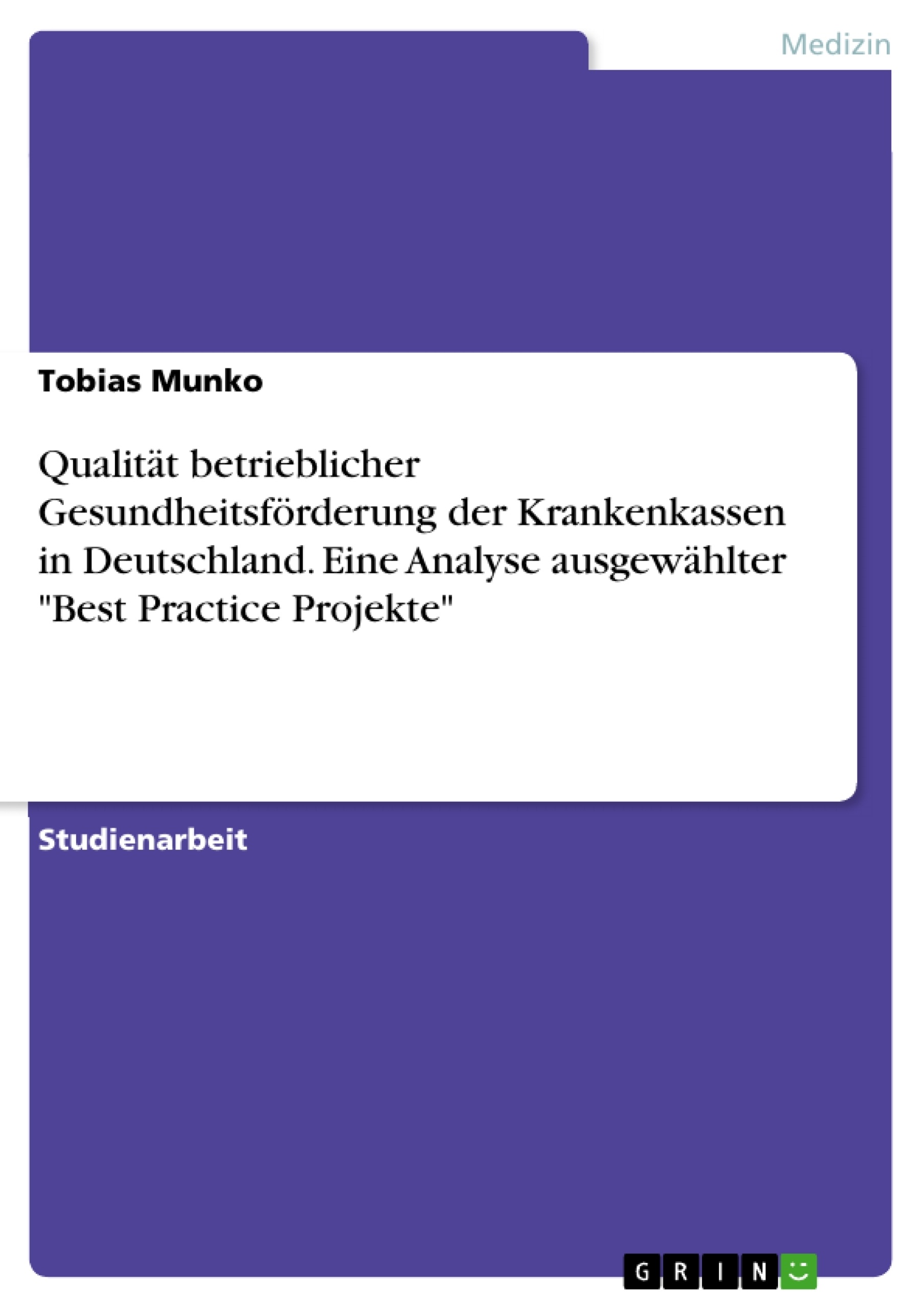Eine Änderung des Arbeitsschutzgesetzes durch das BUK-Neuorganisationsgesetz hat bereits 2013 dazu geführt, dass der Fokus explizit mit auf die „psychische Gesundheit“ (§ 4 ArbSchG) gelegt wird sowie „psychische Belastungen bei der Arbeit“ (§ 5 ArbSchG) mit in die Beurteilung von Arbeitsbedingungen einzuschließen sind (BUK-NOG, 2013).
Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) scheint daher zunehmend für Unternehmen der Bundesrepublik Deutschland an Bedeutung zu gewinnen. Dies geschieht nicht zuletzt aus gesetzlichem Zwang heraus, sondern auch aus anderen Motivationen wie z. B. dem Erhalt der Gesundheit der Belegschaft und damit der Produktionsfähigkeit (Badura et. al., 2010). So berichten der Medizinische Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e. V. (MDS) und der GKV-Spitzenverband (2014) im aktuellen Präventionsbericht 2014, dass im Berichtsjahr 2013 ca. 10.000 Betriebe durch die betrieblichen Gesundheitsförderungsmaßnahmen der Krankenkassen unterstütz worden sein. 54 Mio. Euro wurden allein für betriebliche Maßnahmen der Gesundheitsförderung aufgewendet.
Die Qualität der durchgeführten Maßnahmen ist dabei von entscheidender Bedeutung. Investitionen in BGF zeigen zumeist erst einige Zeit später einen sichtbaren Erfolg, welcher sich in der Regel nicht mit eindeutigen harten Kriterien messen lässt, bzw. die direkte Kausalität durch die Komplexität der Zusammenhänge häufig nicht nachzuweisen ist (Ueberle & Greiner, 2010). Gleiches gilt für das Messen von psychischer Belastung.
Daher erscheint es umso wichtiger bisher entwickelte und zum Teil evaluierte Standards in der BGF zu nutzen, um die Qualität der Maßnahmen zumindest auf konzeptioneller Ebene zu sichern. Dieser Konzept-Qualität widmet sich unter anderem das European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP). Das ENWHP hat u. a. sechs Kernkriterien für die Qualität der BGF benannt.
In der vorliegenden Arbeit soll mithilfe dieser Qualitätskriterien des ENWHP folgende Fragestellung bearbeitet werden: Inwiefern erfüllen Best Practice Projekte betrieblicher Gesundheitsförderung der Krankenkassen in der BRD die Kriterien des Europäischen Netzwerks für betriebliche Gesundheitsförderung (ENWHP)? Dafür wurden für diese Arbeit 19 exemplarische Best Practice Projekte ausgewählt, die hinsichtlich der Fragestellung analysiert wurden und somit einen Einblick in die konzeptionelle Gestaltungspraxis betrieblicher Gesundheitsförderungsmaßnahmen der Krankenkassen geben sollen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hintergrund
- 2.1. Begriffsdefinition betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)
- 2.2. Relevanz der betrieblichen Gesundheitsförderung der Krankenkassen
- 2.3. Qualitätskriterien des ENWHP
- 3. Methodik
- 4. Ergebnisse
- 5. Diskussion
- 6. Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Qualität betrieblicher Gesundheitsförderung (BGF) durch Krankenkassen in Deutschland. Ziel ist es, ausgewählte Best Practice Projekte anhand der Kriterien des Europäischen Netzwerks für betriebliche Gesundheitsförderung (ENWHP) qualitativ zu untersuchen.
- Qualität betrieblicher Gesundheitsförderung
- Bewertung von Best Practice Projekten
- Anwendbarkeit der ENWHP-Kriterien
- Einfluss des demografischen Wandels auf die BGF
- Rolle der Krankenkassen in der BGF
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den demografischen Wandel in Deutschland und dessen Auswirkungen auf das Arbeitsleben und die steigenden Kosten der Sozialversicherungen. Sie führt in die Thematik der betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) ein und hebt die wachsende Bedeutung der BGF für Unternehmen und die Rolle der Krankenkassen hervor. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit qualitativ hochwertiger BGF-Maßnahmen und der damit verbundenen Herausforderungen.
2. Hintergrund: Dieses Kapitel liefert die theoretischen Grundlagen der Arbeit. Es definiert den Begriff der betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF), erläutert die Relevanz der BGF-Aktivitäten der Krankenkassen im Kontext des demografischen Wandels und der steigenden Gesundheitskosten, und stellt die Qualitätskriterien des Europäischen Netzwerks für betriebliche Gesundheitsförderung (ENWHP) vor. Es bildet die Basis für die spätere qualitative Analyse der Best Practice Projekte.
3. Methodik: Das Kapitel Methodik beschreibt detailliert die Vorgehensweise der qualitativen Analyse. Es legt dar, wie die Best Practice Projekte ausgewählt und die Daten erhoben und ausgewertet wurden. Die Beschreibung der Methodik ermöglicht die Nachvollziehbarkeit und die Beurteilung der Gültigkeit der Ergebnisse.
4. Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der qualitativen Analyse der ausgewählten Best Practice Projekte. Es zeigt die Ergebnisse der Untersuchung auf, wie gut die Projekte die ENWHP Kriterien erfüllen. Die Ergebnisse dienen als Grundlage für die Diskussion im folgenden Kapitel.
5. Diskussion: Die Diskussion interpretiert die Ergebnisse der Studie und setzt sie in den Kontext der bestehenden Literatur und des Forschungsstandes. Hier werden die Stärken und Schwächen der analysierten Projekte diskutiert, und es werden Schlussfolgerungen für die Praxis der betrieblichen Gesundheitsförderung gezogen.
Schlüsselwörter
Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF), Krankenkassen, Qualitätskriterien, ENWHP, Best Practice, qualitative Analyse, demografischer Wandel, Arbeitsschutz, Gesundheitskosten, Prävention.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Qualität betrieblicher Gesundheitsförderung durch Krankenkassen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Qualität betrieblicher Gesundheitsförderung (BGF) durch Krankenkassen in Deutschland. Der Fokus liegt auf der qualitativen Untersuchung ausgewählter Best-Practice-Projekte anhand der Kriterien des Europäischen Netzwerks für betriebliche Gesundheitsförderung (ENWHP).
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Qualität betrieblicher Gesundheitsförderung, die Bewertung von Best-Practice-Projekten, die Anwendbarkeit der ENWHP-Kriterien, den Einfluss des demografischen Wandels auf die BGF und die Rolle der Krankenkassen in der BGF.
Welche Methodik wurde angewendet?
Es wurde eine qualitative Analyse angewendet. Die Arbeit beschreibt detailliert die Auswahl der Best-Practice-Projekte, die Datenerhebung und -auswertung. Die Methodik soll die Nachvollziehbarkeit und die Beurteilung der Gültigkeit der Ergebnisse ermöglichen.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Das Kapitel "Ergebnisse" präsentiert die Ergebnisse der qualitativen Analyse der ausgewählten Best-Practice-Projekte. Es zeigt, wie gut die Projekte die ENWHP-Kriterien erfüllen. Diese Ergebnisse bilden die Grundlage für die Diskussion.
Wie werden die Ergebnisse diskutiert?
Die Diskussion interpretiert die Ergebnisse im Kontext bestehender Literatur und des Forschungsstandes. Stärken und Schwächen der analysierten Projekte werden diskutiert, und es werden Schlussfolgerungen für die Praxis der betrieblichen Gesundheitsförderung gezogen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Hintergrund (mit Unterkapiteln zu Begriffsdefinition, Relevanz und Qualitätskriterien des ENWHP), Methodik, Ergebnisse, Diskussion und Schlussfolgerung.
Was sind die Schlüsselwörter der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF), Krankenkassen, Qualitätskriterien, ENWHP, Best Practice, qualitative Analyse, demografischer Wandel, Arbeitsschutz, Gesundheitskosten, Prävention.
Welche Rolle spielt der demografische Wandel?
Der demografische Wandel und seine Auswirkungen auf das Arbeitsleben und die steigenden Kosten der Sozialversicherungen werden als wichtiger Kontextfaktor für die Bedeutung der BGF und die Rolle der Krankenkassen beschrieben.
Welche Bedeutung haben die ENWHP-Kriterien?
Die Qualitätskriterien des Europäischen Netzwerks für betriebliche Gesundheitsförderung (ENWHP) dienen als Bewertungsgrundlage für die untersuchten Best-Practice-Projekte.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit betrieblicher Gesundheitsförderung, der Rolle der Krankenkassen, Qualitätsmanagement in der BGF und dem Einfluss des demografischen Wandels auf den Arbeitsmarkt beschäftigen.
- Quote paper
- Tobias Munko (Author), 2015, Qualität betrieblicher Gesundheitsförderung der Krankenkassen in Deutschland. Eine Analyse ausgewählter "Best Practice Projekte", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/300778