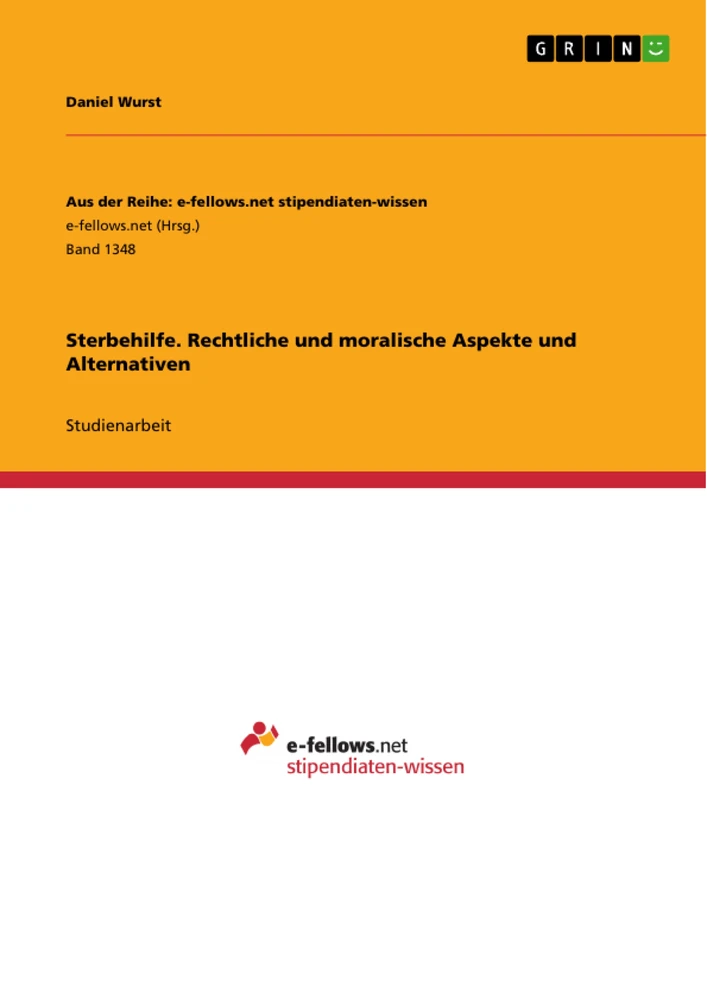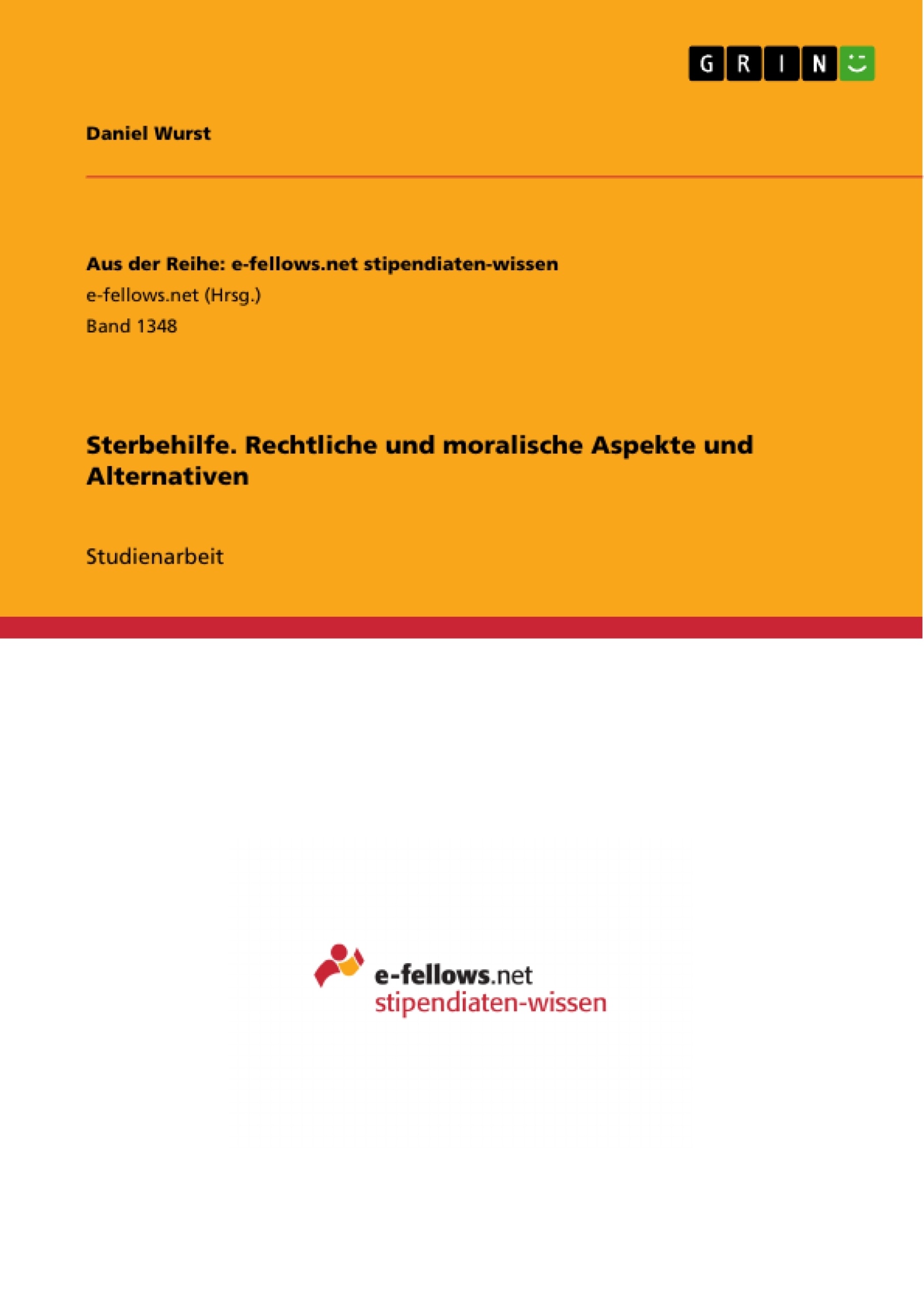Aufgabe dieser Arbeit soll es sein, zunächst den Begriff Sterbehilfe zu bestimmen, seine verschiedenen Ausprägungen darzustellen und sodann auf die geltende Rechtslage einzugehen.
Anschließend wird diskutiert, welche moralischen und ethischen Aspekte den rechtlichen Regelungen entsprechen oder entgegenstehen. Zum Schluss wird ein Blick in die Niederlande geworfen, in denen die Sterbehilfe gesetzlich erlaubt wurde.
Es stehen zwei Interessen miteinander im Konflikt. Auf der einen Seite steht der Staat, der vorsätzliches Töten verbietet und das Leben als unverfügbares Gut in seine Verfassung aufgenommen hat, welches zu schützen seine Aufgabe ist. Auf der anderen Seite steht der Ehemann mit seiner Ehefrau, die laut Aussage des Mannes keinen Sinn in ihrem Leben mehr gesehen hat.
Sie wusste von ihrer Krankheit und hielt es nicht aus, bewusst mitzuerleben, wie eine Funktion des Gehirns nach der anderen wegfiel. Ihre Vorstellung von einem Leben in Würde wurde jeden Tag untergraben, bis sie keine Würde mehr in ihrem Dasein finden konnte.
Welches Interesse überwiegt nun? Kann der Staat seinen Bürgern verbieten, ihr Leben in Würde beenden zu wollen, im Zweifel unter Zuhilfenahme anderer oder sogar durch andere? Der Ehemann hat sich durch die Tötung seiner Frau nach deutschem Recht einer Tötung auf Verlangen gem. § 216 StGB strafbar gemacht, wenn die Ehefrau ausdrücklich nach Tötung verlangt hat.
Wenn sie dies nicht tat, käme sogar ein Totschlag gem. § 212 StGB in Betracht. Daran ändert unter der heute geltenden Rechtslage auch nicht, dass der Mann menschlich nachvollziehbar und ethisch möglicherweise gerechtfertigt gehandelt hat.
Inhaltsverzeichnis
- I. Zusammenfassung Filmausschnitt
- II. Widerstreitende Interessen und erste Einschätzung
- III. Begriffsbestimmungen und Arten der Sterbehilfe
- IV. Grundrechtsfragen der Sterbehilfe
- 1. Grundrecht auf Sterben
- 2. Grundrecht auf Hilfe beim Sterben
- 3. Grundrecht auf selbstbestimmte Entscheidung über lebensverlängernde Maßnahmen
- V. Rechtliche Würdigung der Sterbehilfe
- 1. Die reine Sterbehilfe
- 2. Die Beihilfe zur Selbsttötung
- 3. Die indirekte Sterbehilfe
- 4. Die aktive direkte Sterbehilfe
- 5. Passive Sterbehilfe
- a) Recht des Patienten auf eigenverantwortliche Ablehnung der Behandlung
- b) Konsequenzen des Selbstbestimmungsrechts
- VI. Moralisch-ethische Aspekte der Sterbehilfe
- 1. Geschichtlich orientierte Argumentation gegen aktive Sterbehilfe
- 2. Dammbruch- oder „slippery slope“-Argumente
- 3. Die Rolle des Arztes und das ärztliche Berufsrecht
- 4. Der Moribunde
- 5. In Würde sterben dürfen
- VII. Alternativentwürfe und Vorschläge
- 1. Alternativentwürfe
- 2. Vorschläge
- VIII. Sterbehilfe im Ausland
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Umgang mit medizinethischen Konfliktfällen, insbesondere der Sterbehilfe, anhand von amerikanischen Fernsehserien. Ziel ist es, die verschiedenen Perspektiven und Argumente in Bezug auf Recht und Ethik im Kontext der Sterbehilfe zu beleuchten.
- Rechtliche Aspekte der Sterbehilfe in verschiedenen Formen (aktive, passive, Beihilfe etc.)
- Ethische und moralische Dilemmata im Zusammenhang mit Sterbehilfeentscheidungen
- Das Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmungsrecht des Patienten und ärztlicher Verantwortung
- Gesellschaftliche Debatten und unterschiedliche Positionen zur Sterbehilfe
- Vergleichende Betrachtung der Sterbehilfe im Ausland
Zusammenfassung der Kapitel
I. Zusammenfassung Filmausschnitt: Dieses Kapitel bietet eine kurze Einführung in die Thematik, indem es einen konkreten Filmausschnitt analysiert und erste Fragen und Problemstellungen im Kontext von Sterbehilfe aufwirft. Der Ausschnitt dient als Ausgangspunkt für die detailliertere Betrachtung in den folgenden Kapiteln.
II. Widerstreitende Interessen und erste Einschätzung: Hier werden die verschiedenen, oft konfligierenden Interessen der beteiligten Akteure (Patient, Arzt, Angehörige) im Kontext von Sterbehilfe-Debatten skizziert. Es erfolgt eine erste, allgemeine Einschätzung der Komplexität der Thematik und der Schwierigkeiten bei der Suche nach eindeutigen Lösungen.
III. Begriffsbestimmungen und Arten der Sterbehilfe: Dieses Kapitel klärt grundlegende Begriffe im Zusammenhang mit Sterbehilfe und differenziert zwischen verschiedenen Formen wie aktiver, passiver, direkter und indirekter Sterbehilfe. Es wird eine systematische Grundlage für die weitere Auseinandersetzung mit dem Thema geschaffen.
IV. Grundrechtsfragen der Sterbehilfe: Dieses Kapitel untersucht die grundrechtlichen Aspekte der Sterbehilfe, insbesondere das Recht auf Sterben, das Recht auf Hilfe beim Sterben und das Recht auf selbstbestimmte Entscheidungen über lebensverlängernde Maßnahmen. Es analysiert die potenziellen Konflikte zwischen diesen Rechten und anderen relevanten Rechtsgütern.
V. Rechtliche Würdigung der Sterbehilfe: Hier wird eine detaillierte rechtliche Analyse der verschiedenen Arten von Sterbehilfe vorgenommen. Es werden die unterschiedlichen rechtlichen Konsequenzen und die jeweilige strafrechtliche Einordnung beleuchtet, wobei die Rechtslage zu passiver Sterbehilfe und dem Selbstbestimmungsrecht des Patienten besonders betont wird.
VI. Moralisch-ethische Aspekte der Sterbehilfe: Dieses Kapitel befasst sich mit den ethischen und moralischen Fragen der Sterbehilfe. Es werden historische Argumente gegen aktive Sterbehilfe, der "slippery slope"-Argumentation, die Rolle des Arztes und die Bedeutung von Würde im Sterbeprozess erörtert. Es werden unterschiedliche ethische Standpunkte und deren Begründung präsentiert.
VII. Alternativentwürfe und Vorschläge: Dieses Kapitel präsentiert alternative Lösungsansätze und konkrete Vorschläge für einen verantwortungsvollen Umgang mit Sterbehilfe-Fragen. Es werden konstruktive Möglichkeiten aufgezeigt, um den bestehenden Konflikt zwischen rechtlichen Vorgaben und ethischen Überlegungen zu lösen.
VIII. Sterbehilfe im Ausland: Dieses Kapitel vergleicht die Rechtslage und Praxis der Sterbehilfe in verschiedenen Ländern. Es analysiert die unterschiedlichen rechtlichen und gesellschaftlichen Ansätze und zieht mögliche Schlussfolgerungen für die deutsche Debatte.
Schlüsselwörter
Sterbehilfe, aktive Sterbehilfe, passive Sterbehilfe, Beihilfe zur Selbsttötung, Selbstbestimmungsrecht, ärztliche Verantwortung, Medizinrecht, Strafrecht, Ethik, Moral, Würde, Lebensende, Patientenverfügung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Umgang mit medizinethischen Konfliktfällen anhand von amerikanischen Fernsehserien
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Dieses Dokument analysiert den Umgang mit medizinethischen Konfliktfällen, insbesondere der Sterbehilfe, anhand von amerikanischen Fernsehserien. Es beleuchtet die verschiedenen Perspektiven und Argumente in Bezug auf Recht und Ethik im Kontext der Sterbehilfe.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt rechtliche Aspekte der Sterbehilfe (aktive, passive, Beihilfe etc.), ethische und moralische Dilemmata, das Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmungsrecht und ärztlicher Verantwortung, gesellschaftliche Debatten und unterschiedliche Positionen zur Sterbehilfe sowie einen Vergleich der Sterbehilfe im Ausland.
Welche Arten von Sterbehilfe werden unterschieden?
Das Dokument unterscheidet zwischen reiner Sterbehilfe, Beihilfe zur Selbsttötung, indirekter Sterbehilfe, aktiver direkter Sterbehilfe und passiver Sterbehilfe (inkl. des Rechts des Patienten auf Ablehnung der Behandlung und den Konsequenzen daraus).
Welche rechtlichen Aspekte werden betrachtet?
Die rechtliche Würdigung umfasst die strafrechtliche Einordnung der verschiedenen Sterbehilfeformen und betont die Rechtslage zur passiven Sterbehilfe und zum Selbstbestimmungsrecht des Patienten.
Welche ethischen und moralischen Aspekte werden diskutiert?
Das Dokument erörtert historische Argumente gegen aktive Sterbehilfe, die "slippery slope"-Argumentation, die Rolle des Arztes, die Bedeutung von Würde im Sterbeprozess und präsentiert unterschiedliche ethische Standpunkte.
Welche Grundrechtsfragen werden im Zusammenhang mit Sterbehilfe behandelt?
Es werden die Grundrechte auf Sterben, auf Hilfe beim Sterben und auf selbstbestimmte Entscheidungen über lebensverlängernde Maßnahmen untersucht, sowie potenzielle Konflikte zwischen diesen Rechten und anderen Rechtsgütern.
Gibt es Vorschläge oder Alternativentwürfe im Dokument?
Ja, das Dokument präsentiert alternative Lösungsansätze und konkrete Vorschläge für einen verantwortungsvollen Umgang mit Sterbehilfe-Fragen, um den Konflikt zwischen rechtlichen Vorgaben und ethischen Überlegungen zu lösen.
Wie wird die Sterbehilfe im Ausland betrachtet?
Das Dokument vergleicht die Rechtslage und Praxis der Sterbehilfe in verschiedenen Ländern, analysiert unterschiedliche Ansätze und zieht Schlussfolgerungen für die deutsche Debatte.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für dieses Dokument?
Schlüsselwörter sind: Sterbehilfe, aktive Sterbehilfe, passive Sterbehilfe, Beihilfe zur Selbsttötung, Selbstbestimmungsrecht, ärztliche Verantwortung, Medizinrecht, Strafrecht, Ethik, Moral, Würde, Lebensende, Patientenverfügung.
Wie ist der Aufbau des Dokuments?
Das Dokument umfasst eine Zusammenfassung des Filmausschnitts, eine Betrachtung widerstreitender Interessen, Begriffsbestimmungen und Arten der Sterbehilfe, eine Analyse der Grundrechtsfragen, eine rechtliche Würdigung, eine Auseinandersetzung mit moralisch-ethischen Aspekten, die Präsentation von Alternativentwürfen und Vorschlägen sowie einen Vergleich der Sterbehilfe im Ausland.
- Arbeit zitieren
- Daniel Wurst (Autor:in), 2013, Sterbehilfe. Rechtliche und moralische Aspekte und Alternativen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/300445