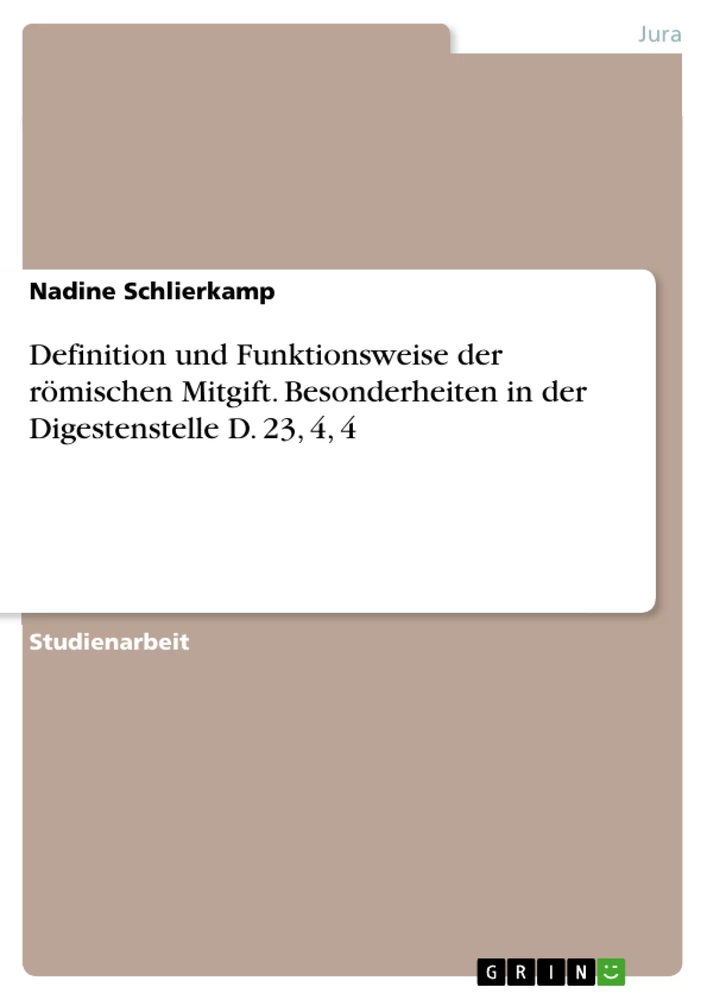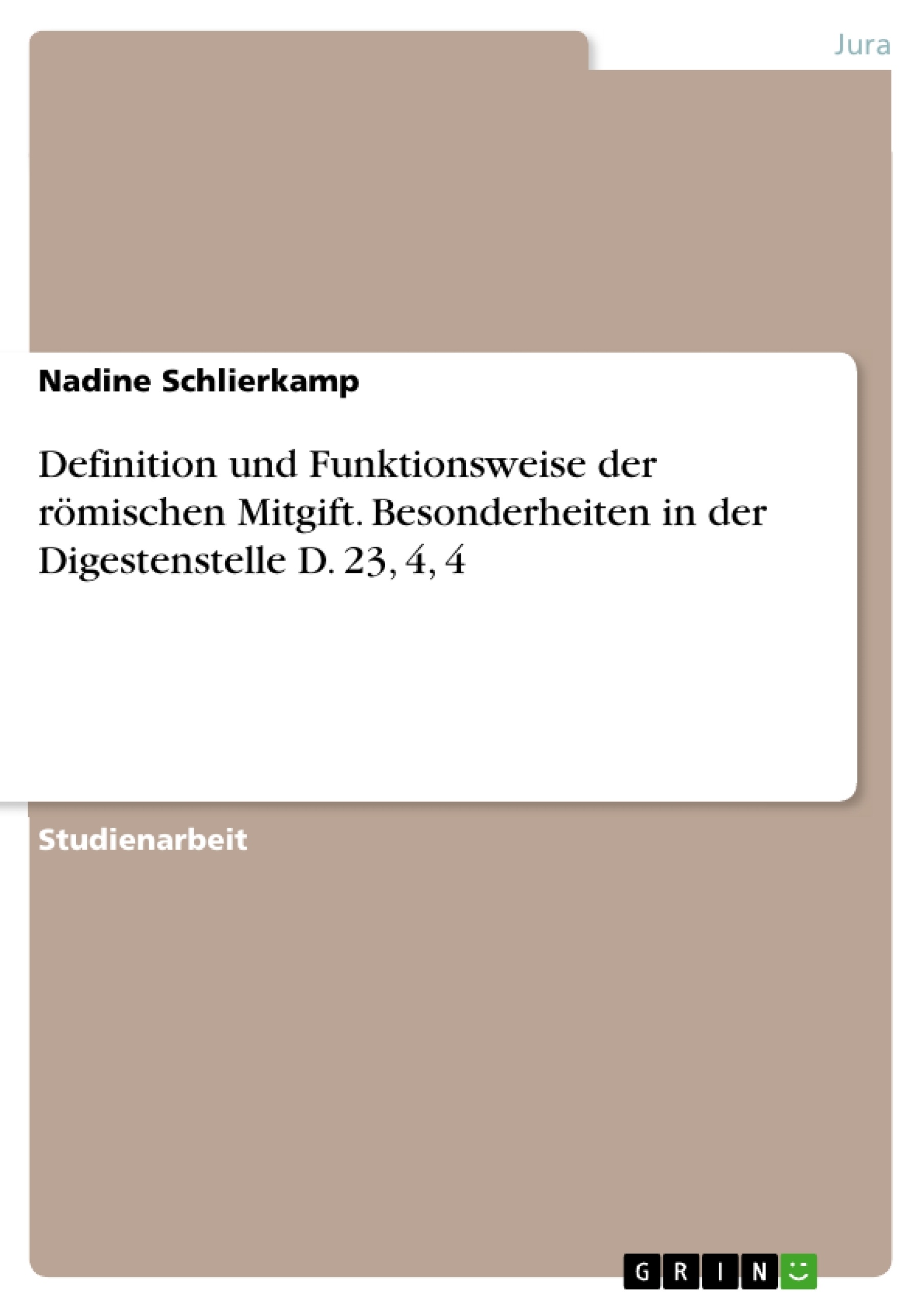Meine Seminararbeit befasst sich mit der römischen Mitgift im Allgemeinen und im Besonderen mit einer Digestenstelle (D. 23, 4, 4), in der es um zulässige und unzulässige Nebenabreden bei der Bestellung der römischen Mitgift geht.
Im Folgenden werde ich zunächst auf die Funktionsweise der römischen Mitgift, d. h. auf alle wichtigen Hintergründe und Regelungen des römischen Dotalrechts eingehen.
Danach komme ich auf die genannte Digestenstelle und ihre Besonderheiten in der Fallgestaltung zu sprechen, bevor ich einen Ausblick auf die weitere Entwicklung des Dotalrechts gebe.
Abschließend werde ich mein persönliches und zusammenfassendes Fazit der Seminararbeit darlegen.
Die römische Mitgift war eine auf Sitte und Brauch beruhende Gabe an den zukünftigen Ehemann von Seiten der Frau vor oder bei Eingehung der Ehe, unabhängig davon, ob die Ehe gewaltfrei oder gewaltunterworfen zustande kam.
Voraussetzung für die wirksame Mitgiftbestellung war allein, dass eine rechtsgültige Ehe geschlossen worden war. Funktional gesehen war sie für die Tochter, die in die gewaltfreie Ehe eintrat, ein vorweggenommenes Erbteil, denn beim Tode ihres Vaters musste sie sich die dos auf ihren Erbanteil anrechnen lassen, soweit jener ihr die Mitgift bestellt hatte.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Die Funktionsweise der römischen Mitgift
- I. Die römische Ehe, ihre Entwicklung und das Scheidungsrecht
- 1. Die manus-Ehe
- 2. Die gewaltfreie Ehe
- 3. Entwicklung des Scheidungsrechts
- II. Die römische Mitgift (dos)
- 1. Definition der römischen “dos”
- 2. Gründe für die Entwicklung eines Dotalrechts
- 3. Bestellung der Mitgift
- 4. Abschirmung des Dotalrechts gegen störende Einflüsse
- III. Restitution der Mitgift nach Scheidung oder Tod eines Ehepartners
- 1. Bei Scheidung
- 2. Bei Tod des Ehemanns
- 3. Bei Tod der Ehefrau
- IV. Pacta dotalia
- C. Besonderheiten der in D. 23, 4, 4 behandelten Fallgestaltung
- I. Text und Übersetzung
- II. Autor, Systematische und Historische Einordnung der Digestenstelle
- III. Erläuterung einzelner Textpassagen und der Besonderheiten des Falles
- IV. Bedeutung der Digestenstelle für die Rechtsentwicklung
- D. Weitere Entwicklung des Dotalrechts
- E. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die zulässigen und unzulässigen Nebenabreden bei der Bestellung der Mitgift (dos) im römischen Recht, speziell anhand der Digestenstelle D. 23, 4, 4 (Ulp. 31 ad Sab.). Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Funktionsweise der römischen Mitgift im Kontext der römischen Ehe und des Scheidungsrechts zu beleuchten und die Besonderheiten der ausgewählten Fallgestaltung zu analysieren.
- Die Funktionsweise der römischen Mitgift (dos) und ihre Bedeutung für die Ehe.
- Die Entwicklung des römischen Ehe- und Scheidungsrechts.
- Zulässige und unzulässige Nebenabreden bei der Mitgiftbestellung.
- Die Restitution der Mitgift nach Scheidung oder Tod eines Ehepartners.
- Die Bedeutung der Digestenstelle D. 23, 4, 4 für die Rechtsentwicklung.
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Seminararbeit ein und beschreibt den Fokus auf die zulässigen und unzulässigen Nebenabreden bei der Bestellung der römischen Mitgift (dos) anhand der Digestenstelle D. 23, 4, 4 (Ulp. 31 ad Sab.). Sie skizziert den methodischen Ansatz und die Struktur der Arbeit.
B. Die Funktionsweise der römischen Mitgift: Dieses Kapitel beleuchtet umfassend die römische Mitgift (dos), ihre Funktion innerhalb der römischen Ehe und ihr Verhältnis zum Scheidungsrecht. Es untersucht verschiedene Ehettypen (manus- und gewaltfreie Ehe) und ihre vermögensrechtlichen Implikationen, analysiert die Gründe für die Entwicklung eines Dotalrechts, untersucht die Bestellung der Mitgift (Besteller, Gegenstände, Art der Bestellung, Funktionen) und befasst sich eingehend mit der Abschirmung des Dotalrechts gegen störende Einflüsse wie eheverträge. Schließlich wird die Restitution der Mitgift nach Scheidung oder Tod eines Ehepartners detailliert erörtert, inklusive der verschiedenen Klagemöglichkeiten und Retentionsrechte.
C. Besonderheiten der in D. 23, 4, 4 behandelten Fallgestaltung: Dieses Kapitel analysiert die Digestenstelle D. 23, 4, 4 (Ulpian 31 ad Sabinum) in Bezug auf den Kontext, die einzelnen Textpassagen und die Besonderheiten des darin beschriebenen Falles. Es beinhaltet eine Übersetzung des Textes, die Einordnung des Autors Ulpian und eine systematische sowie historische Einordnung der Digestenstelle. Die Arbeit erklärt die vier Fallalternativen und ihre dotalrechtlichen Besonderheiten und bewertet die Bedeutung dieser Digestenstelle für die Entwicklung des römischen Rechts.
D. Weitere Entwicklung des Dotalrechts: Dieses Kapitel behandelt die weitere Entwicklung des römischen Dotalrechts nach der in Kapitel C analysierten Digestenstelle. Es setzt die Entwicklung im Kontext der römischen Rechtsgeschichte fort und ergänzt die bisherigen Ausführungen um weitere relevante Aspekte der Rechtsentwicklung.
Schlüsselwörter
Römische Mitgift (dos), Nebenabreden, Dotalrecht, Ehevertrag, Scheidungsrecht, manus-Ehe, gewaltfreie Ehe, Restitution, Actio rei uxoriae, Actio ex stipulatu, Digestenstelle D. 23, 4, 4 (Ulp. 31 ad Sab.), Ulpian, Römisches Privatrecht, Rechtsentwicklung.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Römische Mitgift (dos)
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht zulässige und unzulässige Nebenabreden bei der Bestellung der römischen Mitgift (dos), insbesondere anhand der Digestenstelle D. 23, 4, 4 (Ulp. 31 ad Sab.). Sie beleuchtet die Funktionsweise der römischen Mitgift im Kontext der römischen Ehe und des Scheidungsrechts und analysiert die Besonderheiten des ausgewählten Falles.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Funktionsweise der römischen Mitgift (dos) und ihre Bedeutung für die Ehe, die Entwicklung des römischen Ehe- und Scheidungsrechts, zulässige und unzulässige Nebenabreden bei der Mitgiftbestellung, die Restitution der Mitgift nach Scheidung oder Tod eines Ehepartners und die Bedeutung der Digestenstelle D. 23, 4, 4 für die Rechtsentwicklung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Die Funktionsweise der römischen Mitgift, Besonderheiten der in D. 23, 4, 4 behandelten Fallgestaltung, Weitere Entwicklung des Dotalrechts und Fazit. Jedes Kapitel bearbeitet einen spezifischen Aspekt des Themas, beginnend mit einer Einführung und endend mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse.
Wie wird die römische Mitgift in der Arbeit dargestellt?
Die Arbeit beschreibt die römische Mitgift (dos) umfassend, einschließlich ihrer Funktion innerhalb der römischen Ehe, ihres Verhältnisses zum Scheidungsrecht, der verschiedenen Ehetypen (manus- und gewaltfreie Ehe) und deren vermögensrechtlicher Implikationen, der Gründe für die Entwicklung eines Dotalrechts, der Bestellung der Mitgift (Besteller, Gegenstände, Art der Bestellung, Funktionen) und der Abschirmung des Dotalrechts gegen störende Einflüsse. Die Restitution der Mitgift nach Scheidung oder Tod eines Ehepartners wird detailliert erörtert, inklusive der verschiedenen Klagemöglichkeiten und Retentionsrechte.
Welche Bedeutung hat die Digestenstelle D. 23, 4, 4?
Die Digestenstelle D. 23, 4, 4 (Ulpian 31 ad Sabinum) steht im Zentrum der Analyse. Das Kapitel analysiert den Text, seine Übersetzung, den Autor Ulpian, die systematische und historische Einordnung der Stelle, die einzelnen Textpassagen und die Besonderheiten des beschriebenen Falles. Die Arbeit erklärt die verschiedenen Fallalternativen und deren dotalrechtliche Besonderheiten und bewertet die Bedeutung dieser Digestenstelle für die Entwicklung des römischen Rechts.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Römische Mitgift (dos), Nebenabreden, Dotalrecht, Ehevertrag, Scheidungsrecht, manus-Ehe, gewaltfreie Ehe, Restitution, Actio rei uxoriae, Actio ex stipulatu, Digestenstelle D. 23, 4, 4 (Ulp. 31 ad Sab.), Ulpian, Römisches Privatrecht, Rechtsentwicklung.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet einen methodischen Ansatz, der die Analyse der Digestenstelle D. 23, 4, 4 mit einer umfassenden Darstellung der Funktionsweise der römischen Mitgift verbindet. Die Struktur der Arbeit ist klar und systematisch, um den Leser durch die komplexen juristischen Zusammenhänge zu führen.
- Arbeit zitieren
- Nadine Schlierkamp (Autor:in), 2009, Definition und Funktionsweise der römischen Mitgift. Besonderheiten in der Digestenstelle D. 23, 4, 4, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/300242