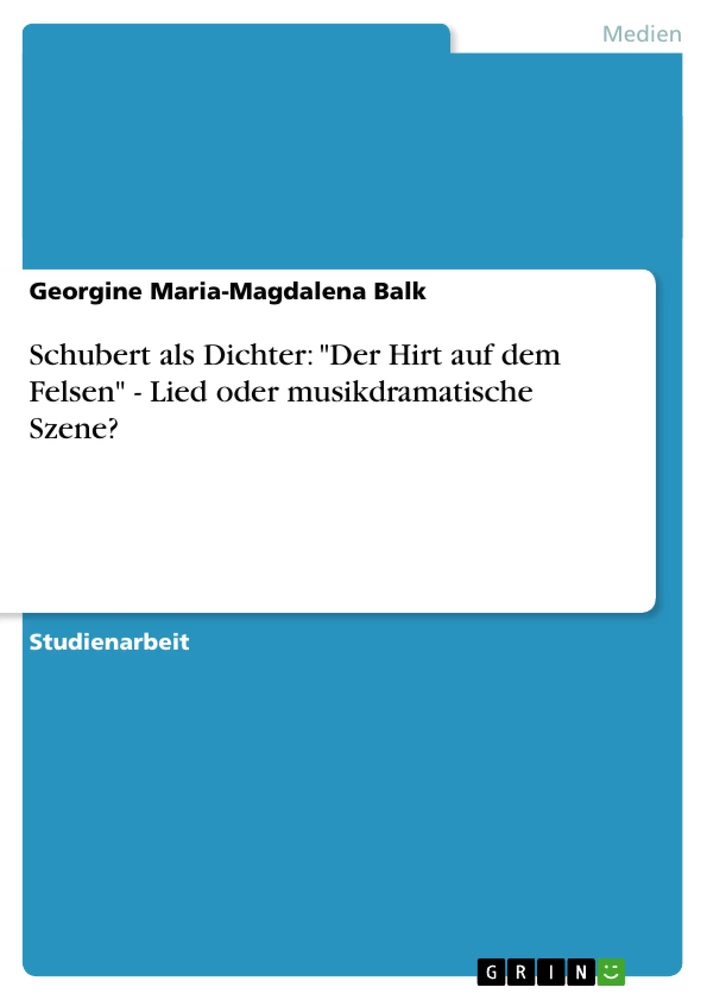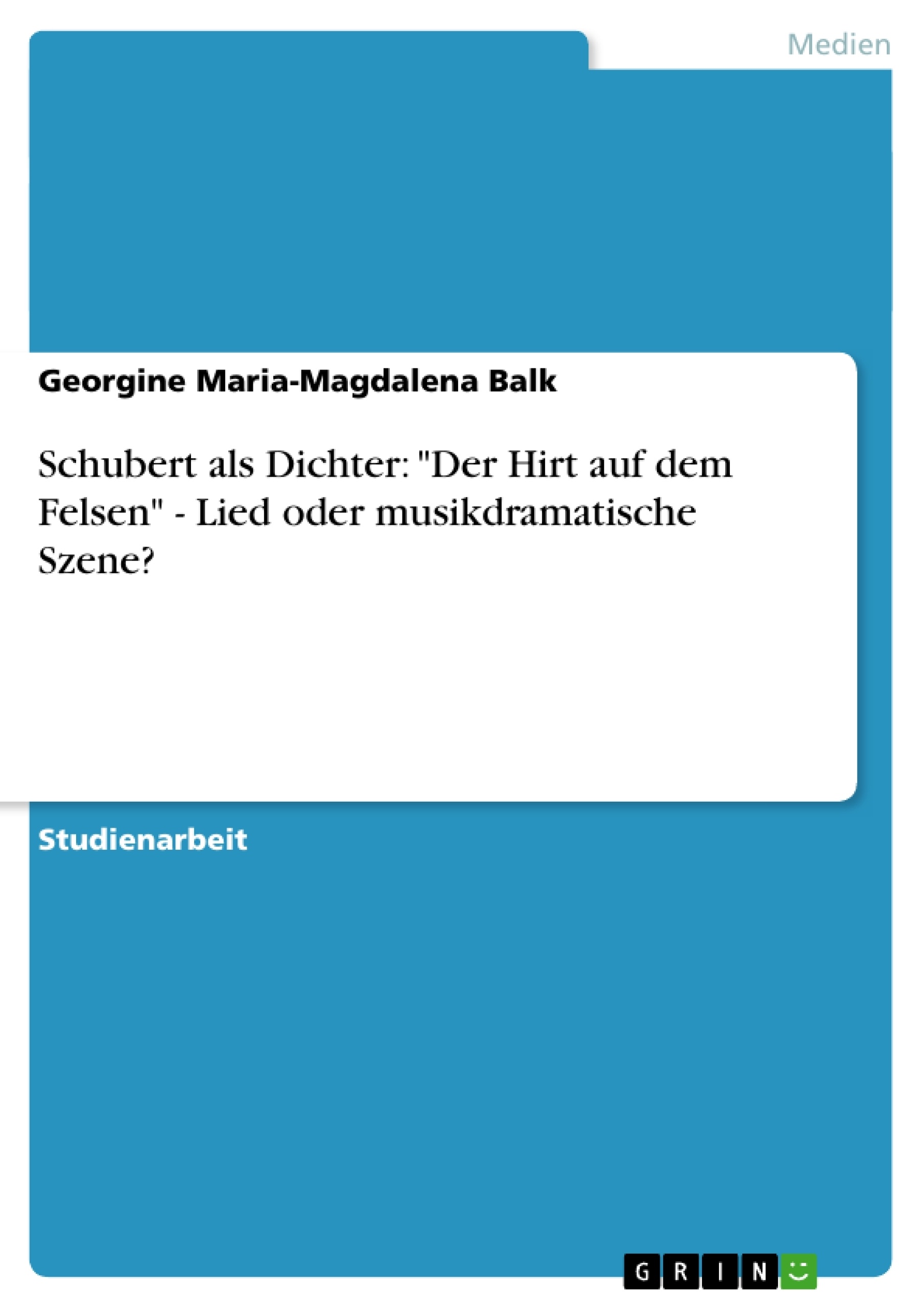Das obligate Lied Schuberts „Der Hirt auf dem Felsen“ für Klavier, Gesang und Klarinette ist neben dem etwas früher komponierten „Auf dem Strom“ ein Sonderling im Liedschaffen des Komponisten. Es verdankt seine Entstehung wie auch seine Form der Welt des Theaters, im Konkreten der Anregung der Opernsängerin Anna Milder-Hauptmann. In der Fachliteratur wird Der Hirt auf dem Felsen als „durchkomponiert in kantatenhafter Form“ umschrieben. Dies trifft zwar zu, denn eine Kantate gestaltet sich in der Regel wechselweise rezitativisch, arios und kantabel und die Besetzung der Solokantate ist gerne durch konzertierende Instrumente erweitert, doch ist eine weit differenziertere formale Beschreibung nötig. Der Struktur und Stimmumfang nach handelt es sich bei „Der Hirt auf dem Felsen“ nämlich um eine Opernarie, der als Formschema zum einen eine zweisätzige italienische Arie mit vorhergehender Szene zugrunde liegt und die sich gegen Ende zu einem klassischen Duett auswächst. Doch allein im Rahmen dieses Grobrasters lässt sich dieser Gesang nicht voll begreifen. So dürfen zum anderen die formalen Kennzeichen der Da-capo-Arie nicht ganz außer Acht gelassen werden, denn nur mit den Termi beider Gattungen lässt sich dieses komplexe Gebilde gänzlich umschreiben. Auch dramaturgisch entspricht der Gesang der Funktion, die einer Arie im musikdramatischen Kontext einer Oper zukommt. Leicht lässt sich „Der Hirt auf dem Felsen“ als ein konzentrierter Moment der Wende innerhalb eines größeren Handlungszusammenhangs vorstellen.
Um sich dem vielfältigen Charakter des Liedes in ausreichender Weise anzunähern wurden in der vorliegenden Arbeit alle bedeutenden wissenschaftlichen Aspekte behandelt – eine germanistische, theaterwissenschaftliche und nicht zuletzt musikwissenschaftliche Fingerübung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. DAS OBLIGATE LIED
- 1.1 VERSUCH EINER DEFINITION
- 1.2 DAS OBLIGATE LIED ZUM ENDE DES 17. JAHRHUNDERTS BIS INS BEGINNENDE 19. JAHRHUNDERT
- 1.3 DAS OBLIGATE LIED IM KONZERTSAAL
- 2. DIE KLARINETTE
- 3. DIE ENTSTEHUNG DES GESANGS „DER HIRT AUF DEM FELSEN“
- 4. SCHUBERT ALS DICHTER
- 4.1 DAS AUFGREIFEN VON ROMANTISCHEM TextMATERIAL
- 4.2 SCHUBERTS UMGANG MIT DEN TEXTVORLAGEN
- 4.2.1 Der Titel
- 4.2.2 „Der Berghirt“
- 4.2.3 Chézy-Gedicht
- 4.2.4 „Liebesgedanken“
- 4.3 DIE TEXTSTRUKTUR VON „DER HIRT AUF DEM FELSEN“
- 5. DIE QUELLENLAGE
- 6. SCHUBERTS VERTONUNG
- 6.1 DIE BESETZUNG
- 6.2 DAS WORT-TON-VERHÄLTNIS
- 6.3 SATZTECHNISCHE ANLAGE
- 6.4 HARMONISCHE ANALYSE
- 6.5 VERARBEITETES MUSIKALISCHES KLISCHEE: DAS JODELN
- 6.5.1 Definition und Beschreibung des Phänomens Jodeln
- 6.5.2 Jodeln in „DER HIRT AUF DEM FELSEN“
- 7. LIED ODER MUSIKDRAMATISCHE SZENE?
- 7.1 LIED
- 7.2 SZENE
- 7.3 ERKLÄRUNGSANSATZ
- 8. SCHLUSSWORT
- 9. ANLAGEN
- 10. QUELLEN
- 11. SEKUNDÄRLITERATUR
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Franz Schuberts Lied „Der Hirt auf dem Felsen“ und beleuchtet dessen Stellung zwischen Lied und musikdramatischer Szene. Die Zielsetzung besteht darin, die Entstehungsgeschichte des Liedes zu rekonstruieren, Schuberts Umgang mit dem Textmaterial zu analysieren und die musikalischen Besonderheiten im Kontext der Gattung des obligaten Liedes zu erörtern.
- Das obligate Lied als Gattung und seine Entwicklung im 17. und 18. Jahrhundert
- Schuberts kompositorische Behandlung des Textes und die Wahl der Besetzung
- Die musikalische Struktur und harmonische Gestaltung des Liedes
- Die Rolle des Jodelns als musikalisches Klischee
- Die Frage nach der Einordnung des Werkes als Lied oder musikdramatische Szene
Zusammenfassung der Kapitel
1. Das obligate Lied: Dieses Kapitel liefert zunächst eine Definition des „obligaten Liedes“, wobei die Schwierigkeiten bei der Abgrenzung dieser Gattung betont werden. Es wird die Entwicklung vom barockzeitlichen Orchesterlied über die Begleitungsformen im 18. Jahrhundert bis hin zum Konzertsaal hin untersucht. Die Bedeutung der Instrumentierung, insbesondere der Wechsel von Orchesterbegleitung zu Soloinstrumenten mit dem Aufkommen des Hammerklaviers, wird ausführlich diskutiert. Der Fokus liegt auf der Funktion der begleitenden Instrumente und deren Rolle in der Gestaltung des musikalischen Ausdrucks.
4. Schubert als Dichter: Dieses Kapitel befasst sich mit Schuberts Umgang mit den verschiedenen Textvorlagen für „Der Hirt auf dem Felsen“. Es werden die Texte „Der Berghirt“, das Chézy-Gedicht und „Liebesgedanken“ analysiert und in Bezug zu Schuberts kompositorischer Umsetzung gesetzt. Der Fokus liegt auf der Frage, wie Schubert die romantischen Textmotive aufgreift und in seine musikalische Gestaltung integriert. Die Analyse der Textstruktur des finalen „Der Hirt auf dem Felsen“ bildet den Abschluss dieses Kapitels.
6. Schuberts Vertonung: Hier wird Schuberts musikalische Umsetzung von „Der Hirt auf dem Felsen“ im Detail untersucht. Die Besetzung, das Verhältnis von Text und Musik, die satztechnische Anlage, die harmonische Analyse und die Verwendung des Jodelns als musikalisches Klischee werden eingehend analysiert. Die Kapitelteile fügen sich zu einem umfassenden Bild von Schuberts kompositorischem Prozess und dessen Entscheidungen in Bezug auf die Gestaltung des Liedes zusammen. Die verschiedenen Aspekte werden miteinander in Beziehung gesetzt um die Gesamtkomposition zu verstehen.
Schlüsselwörter
Franz Schubert, Der Hirt auf dem Felsen, obligates Lied, Liedbegleitung, Klarinette, Romantische Dichtung, Textvertonung, Musikdrama, harmonische Analyse, Jodeln, Gattungspoetik.
Häufig gestellte Fragen zu "Der Hirt auf dem Felsen" von Franz Schubert
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Franz Schuberts Lied "Der Hirt auf dem Felsen" und untersucht dessen Positionierung zwischen Lied und musikdramatischer Szene. Es werden die Entstehungsgeschichte, Schuberts Umgang mit dem Textmaterial und die musikalischen Besonderheiten im Kontext des obligaten Liedes erörtert.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Entwicklung des obligaten Liedes, Schuberts kompositorische Behandlung des Textes und die Wahl der Besetzung, die musikalische Struktur und harmonische Gestaltung, die Rolle des Jodelns als musikalisches Klischee und die Einordnung des Werkes als Lied oder musikdramatische Szene. Es werden verschiedene Textvorlagen analysiert (u.a. "Der Berghirt", das Chézy-Gedicht und "Liebesgedanken") und deren Einfluss auf die Komposition untersucht.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit und was ist ihr jeweiliger Inhalt?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Kapitel 1 behandelt das obligate Lied, seine Definition und Entwicklung. Kapitel 4 analysiert Schuberts Umgang mit den verschiedenen Textvorlagen. Kapitel 6 untersucht Schuberts Vertonung, einschließlich Besetzung, Text-Musik-Verhältnis, Satztechnik, Harmonik und der Verwendung des Jodelns. Weitere Kapitel befassen sich mit der Quellenlage, dem Schluss, Anlagen, Quellenangaben und Sekundärliteratur. Die Kapitelzusammenfassungen bieten einen detaillierten Einblick in die jeweiligen Inhalte.
Welche Bedeutung hat das "obligate Lied" in dieser Arbeit?
Das "obligate Lied" bildet den zentralen gattungsgeschichtlichen Rahmen der Analyse. Die Arbeit untersucht die Entwicklung dieser Gattung vom Barock bis in die Zeit Schuberts und beleuchtet die Bedeutung der Instrumentierung und der Rolle der begleitenden Instrumente in der Gestaltung des musikalischen Ausdrucks.
Wie geht Schubert mit den Textvorlagen um?
Die Arbeit analysiert Schuberts Umgang mit verschiedenen Textvorlagen für "Der Hirt auf dem Felsen", darunter "Der Berghirt", das Chézy-Gedicht und "Liebesgedanken". Es wird untersucht, wie Schubert die romantischen Textmotive aufgreift und in seine musikalische Gestaltung integriert, mit Fokus auf der Textstruktur des finalen "Der Hirt auf dem Felsen".
Welche musikalischen Aspekte werden analysiert?
Die musikalische Analyse umfasst die Besetzung, das Verhältnis von Wort und Ton, die satztechnische Anlage, die harmonische Analyse und die Verwendung des Jodelns als musikalisches Klischee. Die verschiedenen Aspekte werden in Beziehung gesetzt, um die Gesamtkomposition zu verstehen.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit bezüglich der Einordnung des Werkes?
Die Arbeit diskutiert die Frage, ob "Der Hirt auf dem Felsen" eher als Lied oder als musikdramatische Szene einzustufen ist. Sie bietet einen Erklärungsansatz zu dieser Frage, welcher durch die vorangegangene Analyse fundiert ist.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Franz Schubert, Der Hirt auf dem Felsen, obligates Lied, Liedbegleitung, Klarinette, Romantische Dichtung, Textvertonung, Musikdrama, harmonische Analyse, Jodeln, Gattungspoetik.
- Quote paper
- M.A. Georgine Maria-Magdalena Balk (Author), 2004, Schubert als Dichter: "Der Hirt auf dem Felsen" - Lied oder musikdramatische Szene?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/29727