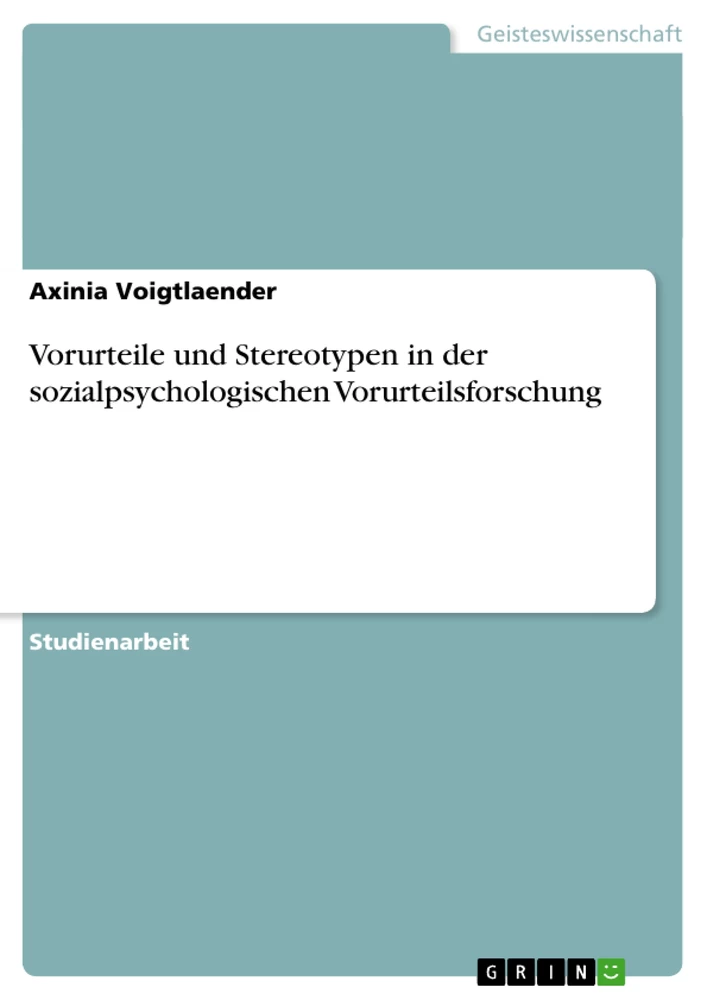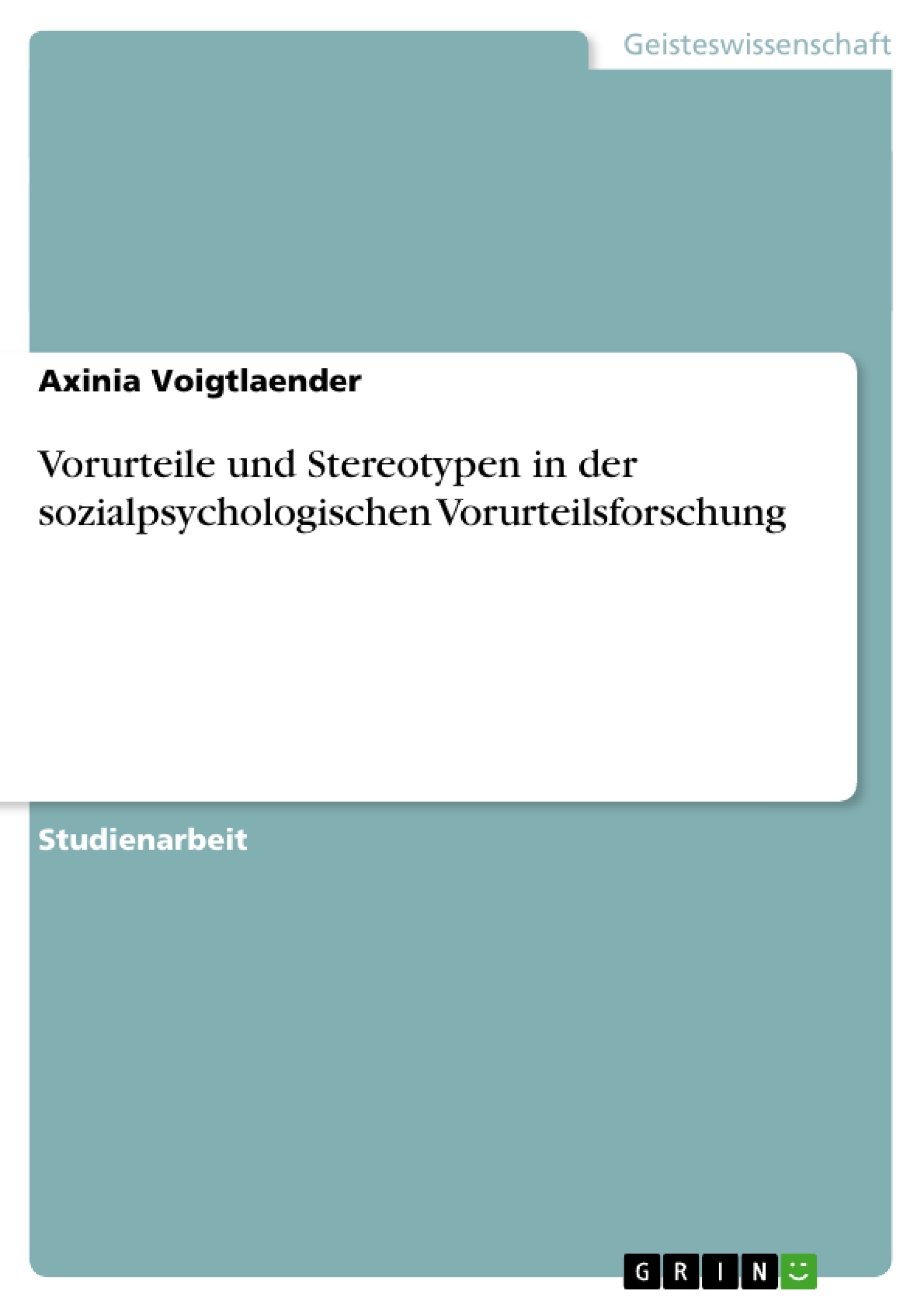Warum beschleicht mich ein merkwürdiges Gefühl, wenn ich eine blonde Frau mit einem
schwarzen Mann, wohlmöglich noch mit gemeinsamen Kindern auf der Straße
sehe? Warum haben andere eine grundsätzliche Abneigung gegen Beamte, die ihrer
Meinung nach zu sicher verdienen und sowieso nur kaffeetrinkend ihre Stunden absitzen?
Warum sind einem Waldorfkindergärten suspekt? Wieso behaupte ich einfach,
dass BMW-Fahrer rücksichtslos und immer zu schnell fahren, Busfahrer immer schlechtgelaunt
und das Dienstleistungsklima in unserem Land erbärmlich ist? Warum mögen die
einen keine Israelis und andere keine lauten Italiener und warum haben wieder andere
Angst, ihr Auto mit nach Polen zu nehmen?
Vorurteile und Stereotypen sind nahezu universell und tummeln sich in allen Schichten
und Bereichen. Manchmal rufen sie Konflikte hervor, manchmal nicht. Sie sind die Brillen
unterschiedlicher Stärke und Tönung, durch die wir uns gegenseitig betrachten. Sie tragen
Mitschuld für kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Gruppen und Staaten,
färben Konkurrenzbeziehungen und Interessenkonflikte und beeinflussen unser tägliches
Handeln immens. Jeder hat sie, jeder schiebt sie anderen zu. Wie aber entstehen sie?
Was gibt den Ausschlag dafür, dass sie so massiv unser soziales Miteinander prägen?
Antworten auf diese Fragen finden sich beispielsweise in der Entwicklungs- und Kulturgeschichte
einzelner Völker, oder der Politik und Philosophie einzelner Epochen. Gegenstand
dieser Arbeit werden jedoch unterschiedliche Erklärungsansätze aus der Sozialpsychologie
aus der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts sein. Erklärungsansätze,
die Grundsteine für die heutige Auseinandersetzung mit diesem Thema gelegt haben.
Nach einer einführenden Definition der Begriffe Vorurteil und Stereotyp , im ersten Teil,
geht es im zweiten Teil um die Erläuterung der unterschiedlichen Theorien, sowie deren
Hinterfragen. Da dieses Thema Untersuchungsgegenstand vieler verschiedener Autoren
war und ist, und zusätzlich ein Rahmen für diese Arbeit vorgegeben war, wird die Auswahl
auf die wegweisendsten Theorien beschränkt bleiben und somit kein Anspruch auf
Vollständigkeit erhoben.
Der dritte Teil wird sich um Möglichkeiten der Einstellungsänderung in vier Alltagsbereichen
bemühen und ebenso darlegen, mit welchen Schwierigkeiten sich dieses Unterfangen
konfrontiert sehen muss.
Ein zusammenfassendes und kritisches Fazit, sowie ein Quellenverweis bilden den Schluss
der Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definitionen
- 2.1. Stereotyp
- 2.2. Vorurteil
- 3. Wie entstehen Vorurteile und Stereotypen?
- 3.1. Der psychodynamische Ansatz
- 3.1.1. Frustrations-Aggressions-Hypothese
- 3.1.2. Theorie der autoritären Persönlichkeit
- 3.2. Der konflikttheoretische Ansatz
- 3.2.1. Theorie des realen Konflikts
- 3.2.2. Theorie der sozialen Identität
- 3.3. Der lerntheoretische Ansatz
- 3.3.1. Eagly und Steffen zu Geschlechterstereotypen
- 3.4. Der kognitive Ansatz
- 3.4.1. nach G. W. Allport
- 3.4.2. Theorie der illusorischen Korrelation
- 3.1. Der psychodynamische Ansatz
- 4. Ausblicke
- 4.1. Institutioneller Rahmen
- 4.2. Unterrichts- und Kursprogramme
- 4.3. Rolle des Elternhauses
- 4.4. Rolle der Massenmedien
- 5. Fazit
- 6. Quellennachweis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Entstehung von Vorurteilen und Stereotypen aus sozialpsychologischer Perspektive. Sie beleuchtet verschiedene Theorien, die im Laufe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt wurden und die Grundlage für die heutige Auseinandersetzung mit diesem Thema bilden. Die Arbeit fokussiert sich auf die Analyse verschiedener Erklärungsansätze, ohne Vollständigkeit zu beanspruchen.
- Definition und Abgrenzung von Stereotypen und Vorurteilen
- Analyse verschiedener sozialpsychologischer Erklärungsansätze für die Entstehung von Vorurteilen und Stereotypen (psychodynamisch, konflikttheoretisch, lerntheoretisch, kognitiv)
- Bewertung der jeweiligen Theorien und deren Grenzen
- Möglichkeiten der Einstellungsänderung im Hinblick auf Vorurteile und Stereotypen
- Die Rolle verschiedener gesellschaftlicher Institutionen bei der Entstehung und Aufrechterhaltung von Vorurteilen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein, indem sie alltägliche Beispiele für Vorurteile und Stereotypen nennt und deren weitverbreitete Präsenz in der Gesellschaft hervorhebt. Sie unterstreicht die Bedeutung dieser Phänomene für soziale Konflikte und das tägliche Miteinander. Die Arbeit konzentriert sich auf sozialpsychologische Erklärungsansätze aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und skizziert den Aufbau der Arbeit: Definitionen, Theorien, Möglichkeiten der Einstellungsänderung und ein Fazit.
2. Definitionen: Dieses Kapitel liefert präzise Definitionen der Begriffe „Stereotyp“ und „Vorurteil“, die als Grundlage für die weiteren Ausführungen dienen. Es differenziert zwischen den beiden Konzepten und legt die semantischen Grundlagen für das Verständnis der nachfolgenden Kapitel fest. Die klare Abgrenzung dieser Begriffe ist essentiell für die Analyse der verschiedenen Theorien und Ansätze.
3. Wie entstehen Vorurteile und Stereotypen?: Dieses Kapitel stellt verschiedene Erklärungsansätze für die Entstehung von Vorurteilen und Stereotypen vor. Es werden der psychodynamische Ansatz (Frustrations-Aggressions-Hypothese und Theorie der autoritären Persönlichkeit), der konflikttheoretische Ansatz (Theorie des realen Konflikts und Theorie der sozialen Identität), der lerntheoretische Ansatz und der kognitive Ansatz (Allport und die Theorie der illusorischen Korrelation) detailliert erläutert. Die Kapitel vergleicht die unterschiedlichen Perspektiven und analysiert deren Stärken und Schwächen. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der komplexen Mechanismen, die zur Bildung und Aufrechterhaltung von Vorurteilen beitragen.
4. Ausblicke: Dieses Kapitel befasst sich mit den Möglichkeiten der Einstellungsänderung in Bezug auf Vorurteile und Stereotypen. Es untersucht den institutionellen Rahmen, die Rolle von Unterrichts- und Kursprogrammen, den Einfluss des Elternhauses und die Wirkung der Massenmedien. Es beleuchtet die Schwierigkeiten, die mit dem Versuch der Einstellungsänderung verbunden sind, und unterstreicht die Komplexität des Themas. Die Analyse dieser Faktoren ist zentral für die Entwicklung effektiver Strategien zur Bekämpfung von Vorurteilen.
Schlüsselwörter
Vorurteile, Stereotypen, Sozialpsychologie, Erklärungsansätze, psychodynamisch, konflikttheoretisch, lerntheoretisch, kognitiv, Einstellungsänderung, Institutionen, Massenmedien, Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Entstehung von Vorurteilen und Stereotypen
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit untersucht sozialpsychologische Erklärungsansätze zur Entstehung von Vorurteilen und Stereotypen. Sie umfasst Definitionen der Schlüsselbegriffe, eine detaillierte Analyse verschiedener Theorien (psychodynamisch, konflikttheoretisch, lerntheoretisch, kognitiv), eine Betrachtung der Möglichkeiten der Einstellungsänderung und die Rolle gesellschaftlicher Institutionen.
Welche Theorien werden behandelt?
Die Arbeit analysiert verschiedene sozialpsychologische Theorien, darunter die Frustrations-Aggressions-Hypothese, die Theorie der autoritären Persönlichkeit, die Theorie des realen Konflikts, die Theorie der sozialen Identität, den lerntheoretischen Ansatz (Eagly und Steffen zu Geschlechterstereotypen) und den kognitiven Ansatz (Allport und die Theorie der illusorischen Korrelation).
Wie werden Vorurteile und Stereotype definiert?
Das Kapitel "Definitionen" liefert präzise Definitionen von "Stereotyp" und "Vorurteil" und differenziert zwischen beiden Konzepten. Diese Definitionen bilden die Grundlage für das Verständnis der dargestellten Theorien.
Welche Ansätze zur Entstehung von Vorurteilen und Stereotypen werden verglichen?
Die Hausarbeit vergleicht den psychodynamischen, konflikttheoretischen, lerntheoretischen und kognitiven Ansatz. Es werden die Stärken und Schwächen der jeweiligen Ansätze analysiert und ihre unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet.
Welche Rolle spielen gesellschaftliche Institutionen?
Der Ausblick befasst sich mit dem Einfluss verschiedener gesellschaftlicher Institutionen auf die Entstehung und Aufrechterhaltung von Vorurteilen. Es werden der institutionelle Rahmen, Unterrichts- und Kursprogramme, die Rolle des Elternhauses und der Einfluss der Massenmedien untersucht.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel mit Definitionen, ein Kapitel zur Entstehung von Vorurteilen und Stereotypen, einen Ausblick auf Möglichkeiten der Einstellungsänderung und ein Fazit. Ein Quellennachweis ist ebenfalls enthalten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Vorurteile, Stereotypen, Sozialpsychologie, Erklärungsansätze, psychodynamisch, konflikttheoretisch, lerntheoretisch, kognitiv, Einstellungsänderung, Institutionen, Massenmedien, Gesellschaft.
Wie werden Möglichkeiten der Einstellungsänderung behandelt?
Das Kapitel "Ausblicke" untersucht Möglichkeiten der Einstellungsänderung im Hinblick auf Vorurteile und Stereotypen und analysiert dabei den Einfluss von Institutionen, Bildungsprogrammen, Familie und Medien.
- Quote paper
- Axinia Voigtlaender (Author), 2002, Vorurteile und Stereotypen in der sozialpsychologischen Vorurteilsforschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/29619