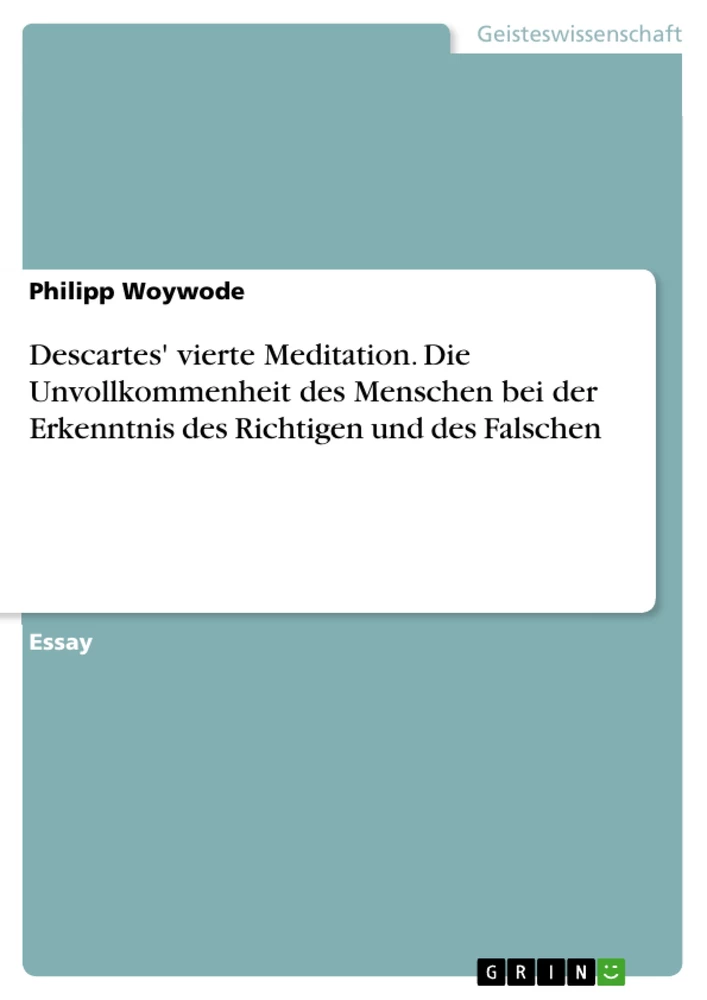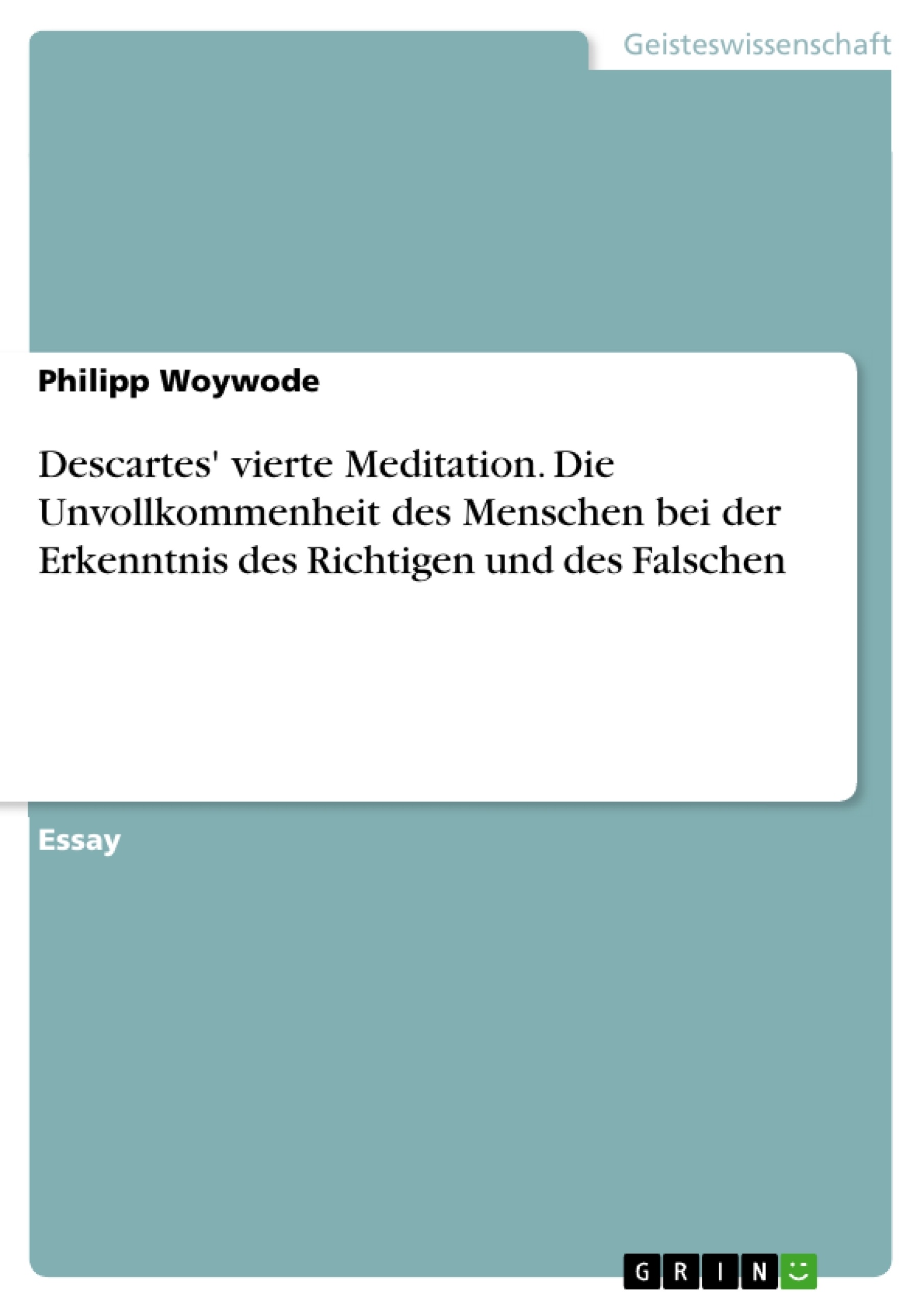Was können wir wirklich wissen und bei welchen Aussagen über die Welt sollten wir lieber Skepsis walten lassen? Was sind die Grundlagen unserer Erkenntnis und wie lassen sich diese wiederum begründen? Für René Descartes waren dies die zentralen Fragen, welchen er, in seinen 1641 erschienen Meditationes de Prima Philosophia, nachging. Dabei stellt Descartes alle seine bisherigen Annahmen über die Welt in Frage um grundlegend zu überprüfen, welche Aussagen über die Welt als unbezweifelbar angesehen werden können. Diese Aussagen würden anschließend das Fundament zur Errichtung eines umfassenden Wissensgebäudes bilden. Zu diesen unbezweifelbaren Wahrheiten gehören das cogito ergo sum – ich denke also bin ich, sowie die notwendig wahre Existenz eines nichtbetrügerischen Gottes, welcher der Schöpfer der Gesamtheit aller Dinge ist.
In der vierten Meditation versucht Descartes die Irrbarkeit des Menschen zu erklären. Aus den vorangegangen Meditationen, im speziellen der Behauptung eines nichtbetrügerischen Gottes, ergibt sich die Frage warum der Mensch irrt. Wie ist es miteinander vereinbar, dass Gott als vollkommenes Wesen, das nicht täuscht, uns als anscheinend Getäuschte geschaffen haben kann? Sind wir überhaupt Getäuschte? Oder lassen sich die Irrtümer denen wir als Menschen so oft aufliegen anders erklären? Gibt es vielleicht sogar gute Gründe für diesen Zustand? Dies sind die Fragen denen Descartes mit mehr oder weniger befriedigenden Antworten in der vierten Meditation entgegentritt.
In der vorliegenden Arbeit möchte ich die Argumentation Descartes' vierter Meditation nachzeichnen und auf diese Weise kritisch bewerten. Von der Betrachtung Gottes und dessen Unschuld an unseren Irrtümern im ersten Teil komme ich anschließend zur Erklärung des Irrtumsproblems durch den falschen Gebrauch unserer geistigen Eigenschaften. Im letzten Teil überprüfe ich das Verhältnis der Vollkommenheit des Ganzen zu der Unvollkommenheit des Menschen. Ich denke hier werde ich zeigen können, dass Descartes' Behauptungen über die Vollkommenheit des Ganzen und die Undurchschaubarkeit Gottes in Widerspruch zur These stehen, dass die unbezweifelbaren Wahrheiten in uns Gottes Werk sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Über die Betrachtung Gottes zur Erkenntnis der übrigen Dinge
- Die Ursachen des Irrtums
- Beschränktes Erkenntnisvermögen und überbordender Wille
- Die Freiheit des Menschen
- Das unvollkommene Einzelne im vollkommenen Ganzen
- Resümé
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, Descartes' Argumentation in seiner vierten Meditation nachzuzeichnen und kritisch zu bewerten. Sie beleuchtet die Frage, wie die Irrbarkeit des Menschen mit der Existenz eines nichtbetrügerischen Gottes vereinbar ist. Die Arbeit analysiert, wie Descartes den Irrtum erklärt, indem er den falschen Gebrauch unserer geistigen Fähigkeiten in den Vordergrund stellt.
- Die Rolle Gottes in der Erkenntnis des Menschen
- Die Ursachen für menschliche Irrtümer
- Die Beziehung zwischen dem unvollkommenen Menschen und der Vollkommenheit des Ganzen
- Die Frage nach der Verantwortung Gottes für menschliche Fehler
- Der Einfluss des Willens auf die Erkenntnis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentralen Fragestellungen der Arbeit vor und führt in die Argumentation Descartes' ein. Das zweite Kapitel beleuchtet die Rolle Gottes in der Erkenntnis des Menschen, wobei Descartes die Vorstellung Gottes als unbezweifelbare Basis des Wissens betrachtet. Im dritten Kapitel wird die Frage nach den Ursachen des Irrtums behandelt. Descartes argumentiert, dass der Irrtum nicht von Gott, sondern vom Menschen selbst verursacht wird. Das vierte Kapitel befasst sich mit der Beziehung zwischen der Vollkommenheit des Ganzen und der Unvollkommenheit des Menschen.
Schlüsselwörter
Descartes, Meditationes de Prima Philosophia, Irrtum, Erkenntnis, Gott, Vollkommenheit, Unvollkommenheit, Freiheit des Willens, Gottesbeweis, Wissensgrundlagen, Cogito ergo sum.
- Quote paper
- Philipp Woywode (Author), 2012, Descartes' vierte Meditation. Die Unvollkommenheit des Menschen bei der Erkenntnis des Richtigen und des Falschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/295432