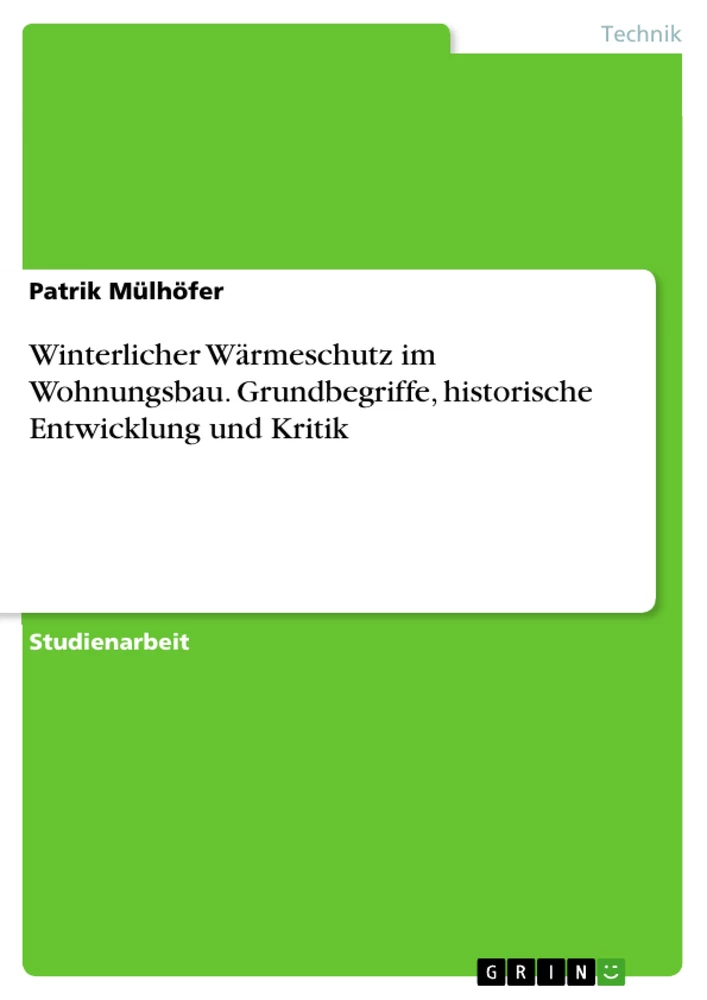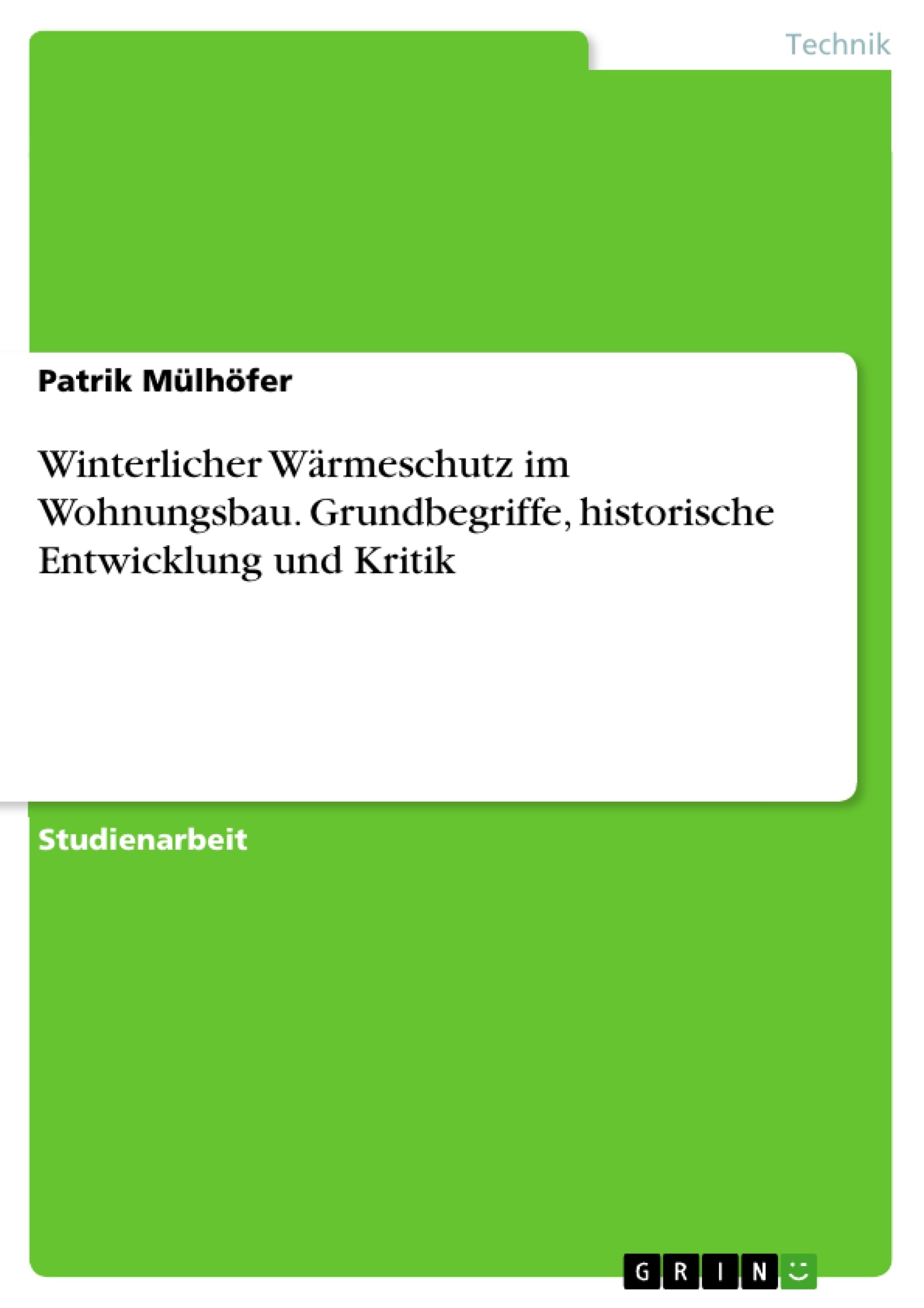Der Umweltschutz und – spätestens seit der Ölkrise – auch das Einsparen fossiler Energieträger traten in den vergangenen Jahrzehnten mehr und mehr in das Bewusstsein von Medien, Bevölkerung und Politik. Wie auf andere Wirtschafts- und Industriezweige auch hat dieses Bewusstsein durch stetig weiter verschärfte Vorgaben, insbesondere im Neubau, großen Einfluss auf die Wohnungswirtschaft.
Der wohl wichtigste Aspekt zur Erreichung der strengen Vorgaben ist im winterlichen Wärmeschutz der Gebäude zu suchen. Mit diesem beschäftigt sich die folgende Hausarbeit.
So werden zunächst wichtige Grundbegriffe und Kennwerte erläutert, anschließend wird auf diejenigen Bauteile, die für den winterlichen Wärmeschutz besondere Bedeutung ha-ben, eingegangen. Im weiteren Verlauf wird die Historie des Wärmeschutzes beleuchtet, bevor Maßnahmen zur Beseitigung energetischer Schwachpunkte von Gebäuden aufge-zeigt werden. Bei all den Vorteilen, die Energieeinsparmaßnahmen mit sich bringen, regt sich jedoch auch immer wieder Kritik, insbesondere an Wärmedämmungen. Auch auf diese wird in der Hausarbeit eingegangen.
Bei den für diese Hausarbeit genutzten Quellen handelt es sich insbesondere um einschlägige Fachliteratur, jedoch waren vereinzelt, insbesondere für den letzten Teil, auch Inter-netrecherchen nötig. Hierbei handelt es sich um Zeitungsartikel, welche die Meinungen einiger Experten zum Thema Wärmeschutz widerspiegeln.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Bauphysikalische Grundbegriffe
- 2.1 Winterlicher Wärmeschutz
- 2.2 Thermische Behaglichkeit
- 2.3 Wärmeleitfähigkeit
- 2.4 Wärmedurchgangskoeffizient/“U-Wert”
- 2.5 Wärmebrücken
- 2.5.1 Geometrisch bedingte Wärmebrücken
- 2.5.2 Konstruktiv bedingte Wärmebrücken
- 2.5.3 Wärmebrücken durch unsachgemäße Ausführung
- 2.6 Taupunkt und Tauwasserausfall
- 3. Bauteile
- 3.1 Mauerwerk
- 3.2 Fenster
- 3.3 Dach
- 3.4 Kellerdecke und Bodenplatte
- 3.5 Heizung
- 4. Historische Entwicklung
- 4.1 Frühes 20. Jahrhundert: Die 4 Klimazonen
- 4.2 1952: Mindestwärmeschutz gemäß DIN 4108
- 4.3 1976: EnEG, Wärmeschutzverordnung und Heizanlagenverordnung
- 4.4 2002: Einführung der Energieeinsparverordnung
- 4.5 2008: Einführung des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes
- 4.6 2014: Aktuellste Novellierung der EnEV
- 5. Sanierung energetischer Schwachpunkte
- 5.1 Dämmung der Außenwand
- 5.1.1 Innendämmung
- 5.1.2 Außendämmung
- 5.1.3 Kerndämmung
- 5.2 Dämmung des Daches
- 5.3 Dämmung von Kellerdecke und Bodenplatte
- 5.1 Dämmung der Außenwand
- 6. Kritik
- 6.1 Ästhetik und Stadtbild
- 6.2 Kosten und Nutzen
- 6.3 Brandschutz
- 6.4 Energieeinsparung und Umweltschutz
- 6.5 Energieverbrauch und Nutzerverhalten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht den winterlichen Wärmeschutz im Wohnungsbau, beleuchtet grundlegende bauphysikalische Begriffe und deren historische Entwicklung. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis für die Bedeutung des Wärmeschutzes zu schaffen und kritische Aspekte der Maßnahmen zu diskutieren.
- Bauphysikalische Grundlagen des Wärmeschutzes
- Historische Entwicklung der Wärmeschutzbestimmungen in Deutschland
- Sanierungsmöglichkeiten energetischer Schwachstellen
- Kosten-Nutzen-Analyse von Wärmeschutzmaßnahmen
- Kritische Betrachtung von Aspekten wie Ästhetik, Brandschutz und Nutzerverhalten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema winterlicher Wärmeschutz im Wohnungsbau ein und umreißt die Ziele und den Aufbau der Arbeit. Sie hebt die Relevanz des Themas im Kontext von Energieeffizienz und Nachhaltigkeit hervor.
2. Bauphysikalische Grundbegriffe: Dieses Kapitel definiert grundlegende Begriffe wie Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmebrücken und Taupunkt. Es erklärt deren Bedeutung für den Wärmeschutz und die Vermeidung von Schimmelbildung. Die Erklärungen werden durch Beispiele und Diagramme veranschaulicht, um ein klares Verständnis zu gewährleisten.
3. Bauteile: Das Kapitel beschreibt die Bedeutung des Wärmeschutzes in verschiedenen Bauteilen wie Mauerwerk, Fenstern, Dach, Kellerdecke und Bodenplatte. Es erläutert die spezifischen Herausforderungen und Lösungsansätze für jeden Bereich. Die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Bauteilen und deren Einfluss auf das gesamte Gebäude werden hervorgehoben.
4. Historische Entwicklung: Dieser Abschnitt verfolgt die Entwicklung des Wärmeschutzes in Deutschland von den frühen 1900er Jahren bis zur aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEV). Er beschreibt die Meilensteine und Veränderungen in den Vorschriften und Standards und zeigt auf, wie sich die Anforderungen an den Wärmeschutz im Laufe der Zeit verschärft haben.
5. Sanierung energetischer Schwachpunkte: Das Kapitel behandelt verschiedene Maßnahmen zur Sanierung energetischer Schwachpunkte, insbesondere die Dämmung von Außenwänden (Innendämmung, Außendämmung, Kerndämmung), Dach und Kellerdecke. Die jeweiligen Vor- und Nachteile der verschiedenen Methoden werden detailliert erläutert. Es werden auch praktische Beispiele und Fallstudien eingearbeitet.
6. Kritik: Dieses Kapitel widmet sich kritischen Aspekten des winterlichen Wärmeschutzes, unter anderem den Auswirkungen auf Ästhetik und Stadtbild, die Kosten-Nutzen-Relation, den Brandschutz sowie die Energieeinsparung und Umweltschutz. Es wird auch der Einfluss des Nutzerverhaltens auf den Energieverbrauch diskutiert.
Schlüsselwörter
Winterlicher Wärmeschutz, Wohnungsbau, Bauphysik, Wärmedämmung, U-Wert, Wärmebrücken, Taupunkt, Energieeinsparverordnung (EnEV), Sanierung, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, Kosten-Nutzen-Analyse, Brandschutz, Ästhetik, Nutzerverhalten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema Winterlicher Wärmeschutz im Wohnungsbau
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit zum winterlichen Wärmeschutz?
Die Hausarbeit bietet einen umfassenden Überblick über den winterlichen Wärmeschutz im Wohnungsbau. Sie behandelt bauphysikalische Grundlagen, die historische Entwicklung der Wärmeschutzbestimmungen in Deutschland, Sanierungsmöglichkeiten energetischer Schwachstellen und eine kritische Auseinandersetzung mit verschiedenen Aspekten wie Ästhetik, Brandschutz und Nutzerverhalten. Die Arbeit enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten und Schlüsselbegriffe.
Welche bauphysikalischen Grundbegriffe werden erklärt?
Die Arbeit erklärt grundlegende bauphysikalische Begriffe wie Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmebrücken und Taupunkt. Es wird erläutert, wie diese Begriffe den Wärmeschutz beeinflussen und wie Schimmelbildung vermieden werden kann. Die Erklärungen werden durch Beispiele und Diagramme veranschaulicht.
Welche Bauteile werden im Hinblick auf Wärmeschutz betrachtet?
Die Hausarbeit untersucht den Wärmeschutz verschiedener Bauteile, darunter Mauerwerk, Fenster, Dach, Kellerdecke und Bodenplatte. Sie erläutert die spezifischen Herausforderungen und Lösungsansätze für jeden Bereich und hebt die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Bauteilen hervor.
Wie wird die historische Entwicklung des Wärmeschutzes dargestellt?
Der Abschnitt zur historischen Entwicklung verfolgt die Entwicklung des Wärmeschutzes in Deutschland von den frühen 1900er Jahren bis zur aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEV). Er beschreibt wichtige Meilensteine und Veränderungen in Vorschriften und Standards und zeigt die zunehmende Verschärfung der Anforderungen an den Wärmeschutz auf.
Welche Sanierungsmöglichkeiten energetischer Schwachstellen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Maßnahmen zur Sanierung energetischer Schwachstellen, insbesondere die Dämmung von Außenwänden (Innendämmung, Außendämmung, Kerndämmung), Dach und Kellerdecke. Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Methoden werden detailliert erläutert, und es werden praktische Beispiele und Fallstudien genannt.
Welche kritischen Aspekte des winterlichen Wärmeschutzes werden diskutiert?
Die kritische Auseinandersetzung umfasst die Auswirkungen auf Ästhetik und Stadtbild, die Kosten-Nutzen-Relation, den Brandschutz, die Energieeinsparung und den Umweltschutz. Der Einfluss des Nutzerverhaltens auf den Energieverbrauch wird ebenfalls diskutiert.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Hausarbeit verwendet?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Winterlicher Wärmeschutz, Wohnungsbau, Bauphysik, Wärmedämmung, U-Wert, Wärmebrücken, Taupunkt, Energieeinsparverordnung (EnEV), Sanierung, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, Kosten-Nutzen-Analyse, Brandschutz, Ästhetik und Nutzerverhalten.
Wo finde ich ein detailliertes Inhaltsverzeichnis?
Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis mit Kapiteln und Unterkapiteln ist im Anfangsteil der Hausarbeit enthalten und listet alle behandelten Themen auf.
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Die Hausarbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis für die Bedeutung des Wärmeschutzes zu schaffen und kritische Aspekte der Maßnahmen zu diskutieren. Sie untersucht den winterlichen Wärmeschutz im Wohnungsbau, beleuchtet grundlegende bauphysikalische Begriffe und deren historische Entwicklung.
- Quote paper
- Patrik Mülhöfer (Author), 2015, Winterlicher Wärmeschutz im Wohnungsbau. Grundbegriffe, historische Entwicklung und Kritik, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/293060