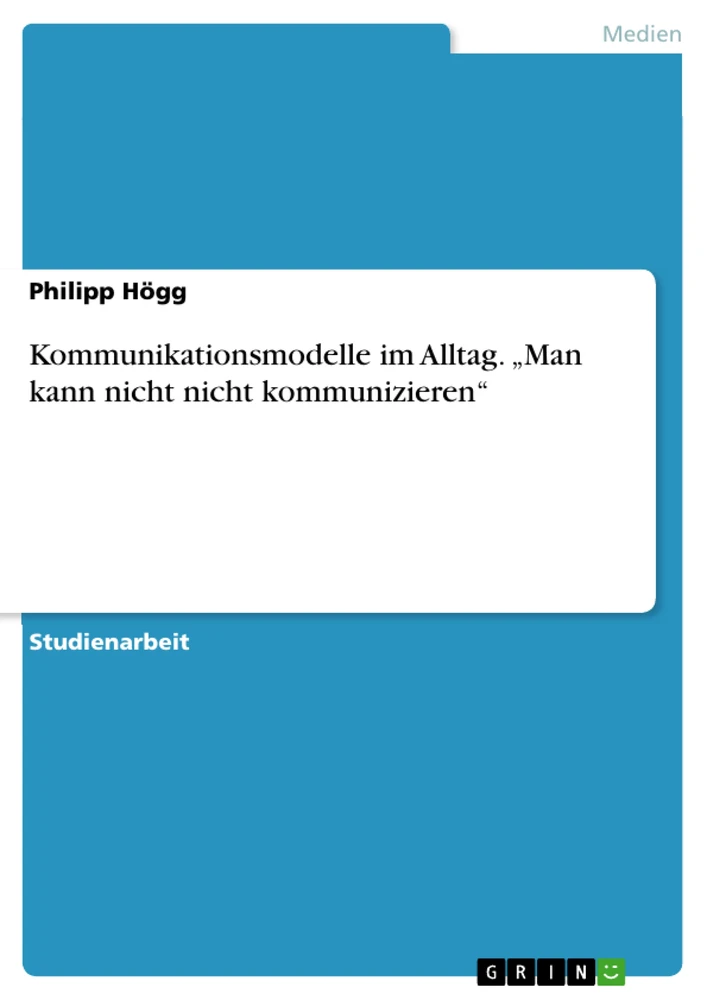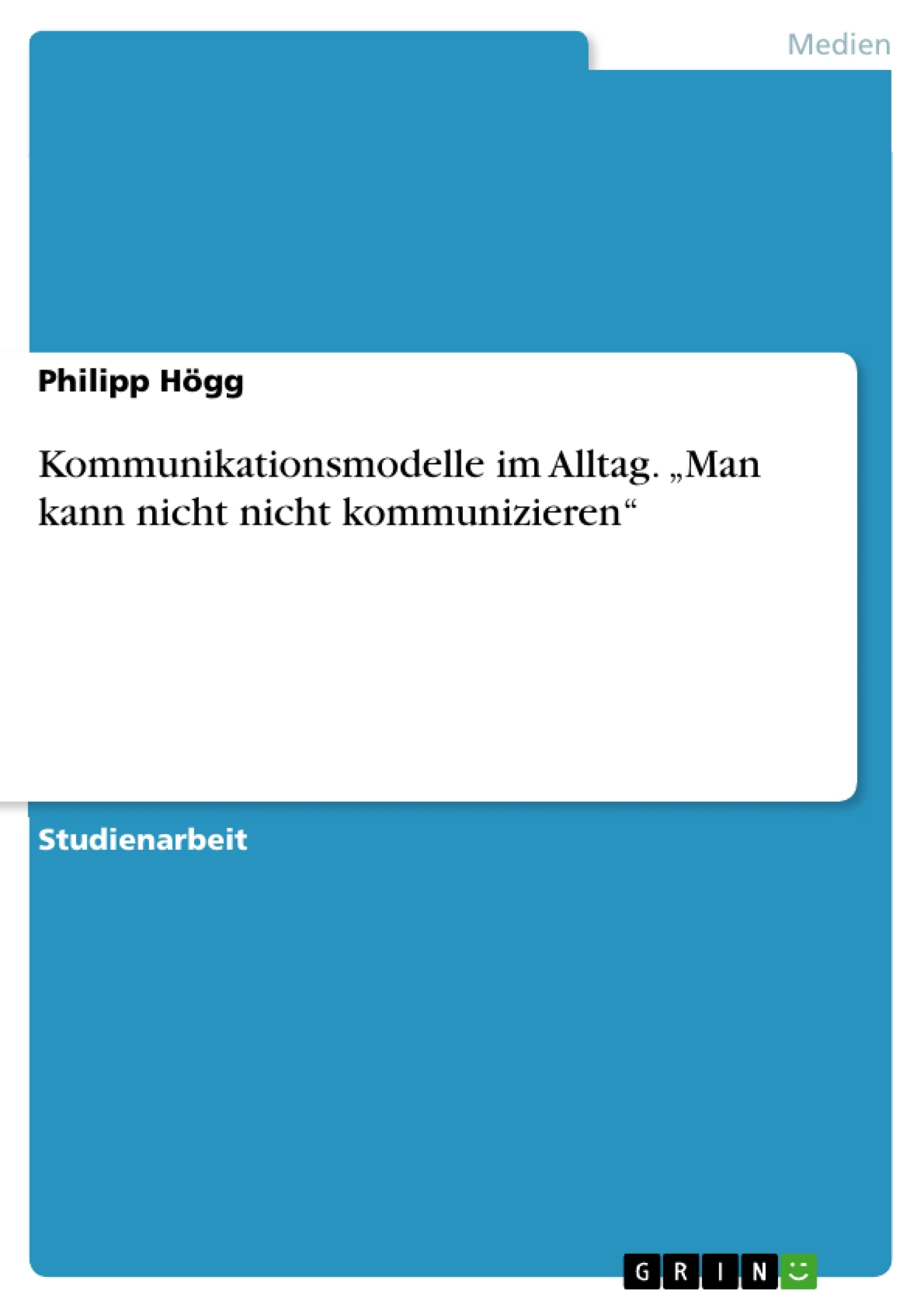Im Alltag kommt es immer wieder vor, dass man an einigen Personen genau erkennen kann, wie es Ihnen geht oder was sie gerade empfinden. Man kann alleine durch ihre Mimik, ihre Gestik und ihr Verhalten an Menschen erkennen, was sie einem vielleicht oft gar nicht sagen möchten. Dies liegt daran, dass jeder Mensch kommuniziert, auch wenn er es oft gar nicht möchte. „Man kann nicht nicht kommunizieren“. Diese Aussage stellt auch den Kern des ersten Axioms von Paul Watzlawick dar, über dessen Leben und vor allem dessen Ideen im Hauptteil der Arbeit viel erläutert werden wird. Da eine Kommunikation aber eigentlich viel komplexer ist als man denkt, und da viel mehr im Hintergrund abläuft als meist angenommen, werden anschließend die Kommunikationsmodelle von Friedemann Schulz von Thun und Sigmund Freud näher beschrieben. Dies dient erstens dem Zweck, sowohl den Begriff als auch den Ablauf der Kommunikation besser zu verstehen, aber auch um in dem Vergleich der drei Modelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten finden zu können. Im Anschluss an diesen theoretischen Teil wird die Praxis mehr in diese Arbeit miteinbezogen. Hierbei werden Zweck und Nutzen der Kommunikationsmodelle im Alltag diskutiert. Daraufhin handelt die Arbeit von einem praktischen Beispiel aus dem Alltag des Autors unter Einbezug der aus der Theorie erarbeiteten Ergebnisse. Anschließend folgt ein einerseits fachliches, andererseits persönliches Fazit über die Arbeit, sowie eine Schlussfolgerung auf das zukünftige Kommunikationsverhalten des Autors.
Inhaltsverzeichnis
- Erschließung rund um das Kernthema „Man kann nicht nicht kommunizieren“
- Hinführung zum Thema und Überblick über die kommende Arbeit
- Watzlawick und sein Kommunikationsmodell
- Watzlawick als Mensch und seine Ideen
- Definition der fünf Axiome und deren Erklärung
- Differente Modelle wie Schulz von Thun und Sigmund Freud im Vergleich
- Das Modell Schulz von Thuns
- Beschreibung des Eisberg Modells von Sigmund Freud
- Vergleich der drei Modelle
- Gemeinsamkeiten
- Unterschiede
- Bezug der Kommunikationstheorien auf den praktischen Alltag
- Zweck und Nutzen dieser Modelle im Alltag
- Praxisbezogenes Beispiel aus dem Alltag
- Sachliche Schlüsse und persönliches Fazit
- Sachliche Schlüsse aus dieser Arbeit und kurzes Resümee
- Persönliches Fazit – Schlussfolgerung auf eigenes Kommunikationsverhalten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema der Kommunikation und erörtert insbesondere das Axiom "Man kann nicht nicht kommunizieren" von Paul Watzlawick. Die Arbeit analysiert Watzlawick's Leben und Ideen, beschreibt die fünf Axiome seiner Kommunikationstheorie und setzt sie in Beziehung zu anderen Modellen der Kommunikation, wie dem von Schulz von Thun und dem Eisbergmodell von Sigmund Freud. Darüber hinaus untersucht sie die Relevanz dieser Theorien für den praktischen Alltag und präsentiert ein Beispiel aus der persönlichen Erfahrung des Autors.
- Das Axiom "Man kann nicht nicht kommunizieren" von Paul Watzlawick
- Watzlawick's Kommunikationstheorie und ihre fünf Axiome
- Vergleich der Kommunikationstheorien von Watzlawick, Schulz von Thun und Sigmund Freud
- Praxisrelevanz von Kommunikationstheorien im Alltag
- Persönliche Schlussfolgerungen des Autors hinsichtlich seines Kommunikationsverhaltens
Zusammenfassung der Kapitel
- Erschließung rund um das Kernthema „Man kann nicht nicht kommunizieren“: Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und gibt einen Überblick über den Aufbau und die wichtigsten Inhalte.
- Hinführung zum Thema und Überblick über die kommende Arbeit: Dieser Abschnitt führt in das Thema „Man kann nicht nicht kommunizieren“ ein und beleuchtet die Relevanz der Thematik für den Alltag. Außerdem gibt er einen kurzen Überblick über den Aufbau der Arbeit.
- Watzlawick und sein Kommunikationsmodell: Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit dem Leben und den Ideen von Paul Watzlawick, einem wichtigen Vertreter der Kommunikationstheorie. Er beleuchtet die 5 Axiome seiner Kommunikationstheorie und deren Bedeutung.
- Differente Modelle wie Schulz von Thun und Sigmund Freud im Vergleich: Dieser Abschnitt stellt die Kommunikationsmodelle von Schulz von Thun und Sigmund Freud vor und vergleicht diese mit Watzlawick's Axiomen. Er identifiziert Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den drei Modellen.
- Bezug der Kommunikationstheorien auf den praktischen Alltag: Dieser Abschnitt erörtert den praktischen Nutzen von Kommunikationstheorien im Alltag und beleuchtet die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten der vorgestellten Modelle.
- Sachliche Schlüsse und persönliches Fazit: Dieser Abschnitt fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und zieht sowohl sachliche als auch persönliche Schlussfolgerungen aus den gewonnenen Erkenntnissen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit wichtigen Schlüsselbegriffen der Kommunikationspsychologie wie Kommunikation, Kommunikationstheorie, Axiome, nonverbaler Kommunikation, Modell von Schulz von Thun, Eisbergmodell, systemisches Denken, praktische Anwendung und persönliches Fazit. Sie untersucht insbesondere die Theorie von Paul Watzlawick, seine fünf Axiome und deren Relevanz für das Verständnis von Kommunikation im Alltag. Die Arbeit legt einen Schwerpunkt auf die Analyse von Kommunikationsmodellen und deren praktische Bedeutung.
- Quote paper
- Philipp Högg (Author), 2014, Kommunikationsmodelle im Alltag. „Man kann nicht nicht kommunizieren“, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/293045