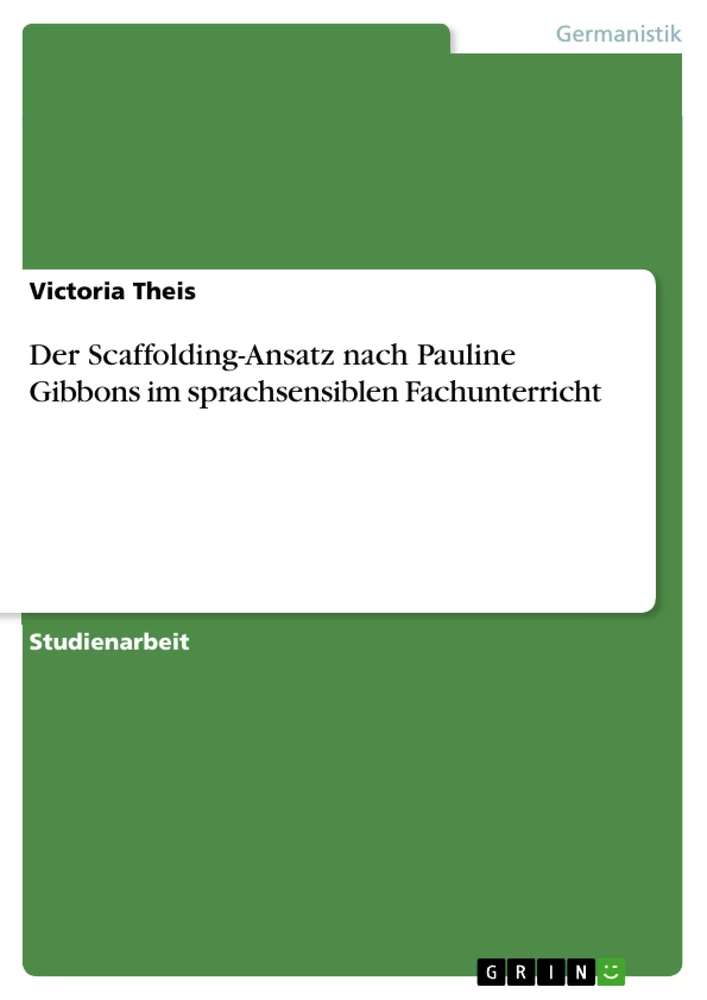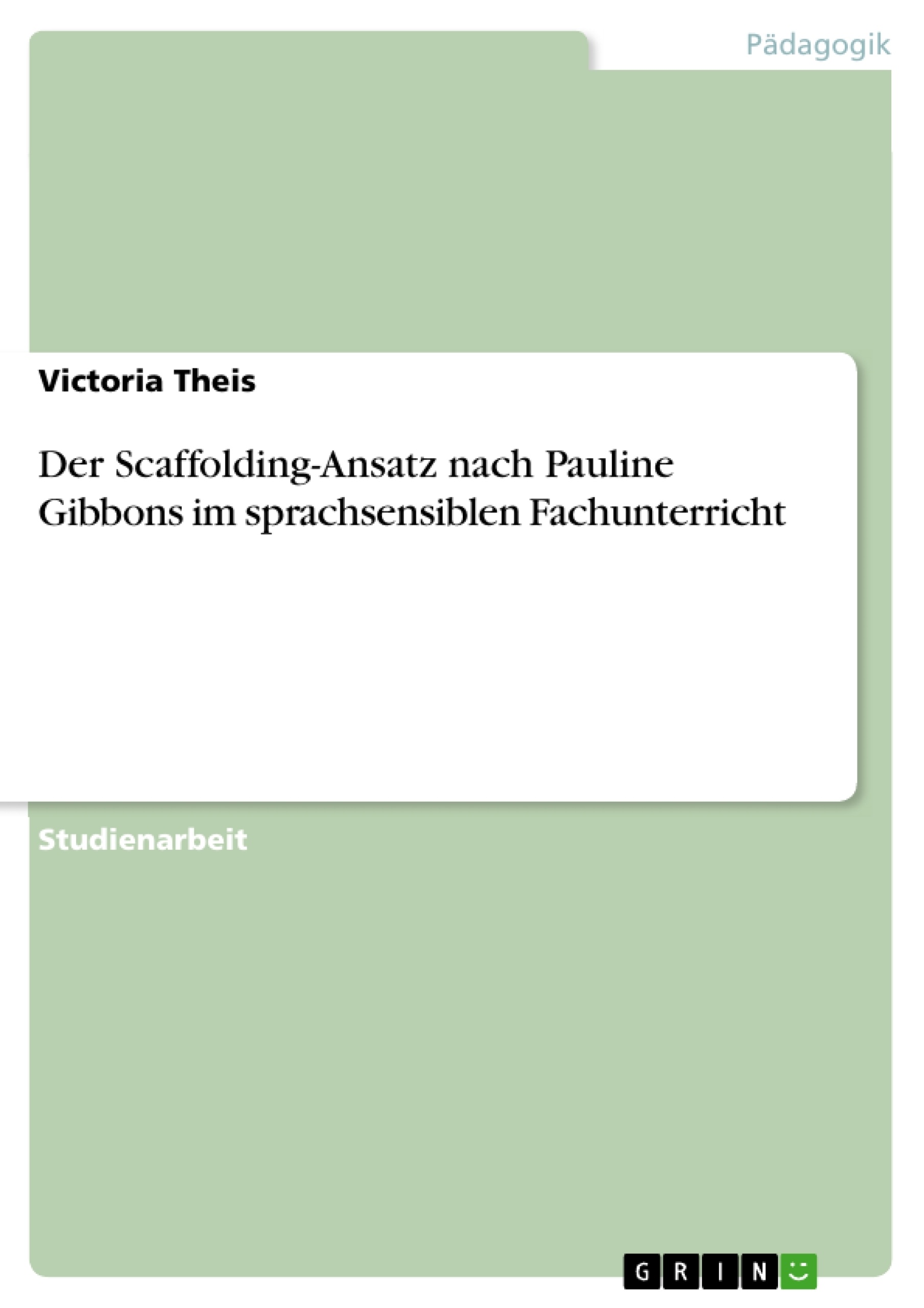Eine Möglichkeit zur Realisierung eines sprachsensiblen Fachunterrichts bietet Pauline Gibbons mit Hilfe ihres Scaffolding-Ansatzes. Dieser Ansatz wird in der vorliegenden Arbeit näher betrachtet und es wird versucht, auf folgende Fragen eine Antwort zu bekommen: Welche Probleme tauchen bei der Aneignung einer Fachsprache von DaZ/DaF-SuS auf und welche Merkmale müssen beachtet werden, um einen sprachsensiblen Fachunterricht im Sinne des Scaffolding nach Gibbons zu konzipieren?
Zunächst wird in Kapitel 2 auf die sprachlichen Varietäten eingegangen, mit denen SuS in der Institution Schule konfrontiert werden. Besonderes Augenmerk wird hier auf die sprachlichen Anforderungen an DaZ/DaF-SuS gerichtet.
In Kapitel 3 wird als erstes die Alltagssprache von der Fachsprache abgegrenzt, um in einem zweiten Schritt die Merkmale der Fachsprache auf der Wort-, Satz- und Textebene herauszustellen und diese mit den Erwerbsschwierigkeiten der SuS in Beziehung zu setzen.
Die Definition von Scaffolding sowie die theoretischen Grundgedanken werden im darauffolgenden Kapitel behandelt. Zudem werden hier auch Vygotskis soziale Lerntheorie und Hallidays funktionale Sprachtheorie mit einbezogen, da diese, wie aufgezeigt wird, einen wichtigen Beitrag zum Scaffolding- Ansatz nach Gibbons leisten.
In Kapitel 6 werden die drei Kategorien des Scaffolding-Ansatzes genau betrachtet und Kriterien aufgestellt, mit deren Hilfe ein sprachsensibler Fachunterricht im Sinne des Scaffolding-Ansatzes nach Gibbons durchgeführt werden kann.
Das darauf folgende Kapitel bietet eine Übersicht über empirische Studien, welche die Effektivität des Scaffolding belegt.
Um eine Umsetzungsmöglichkeit des Scaffolding zu verdeutlichen, wird in Kapitel 7.2 eine Unterrichtsstunde für den Religionsunterricht beschrieben, welche nach den Kriterien eines sprachsensiblen Fachunterrichts im Sinne des Scaffolding kreiert wurde.
Das Resümee fasst noch einmal die wichtigsten Erkenntnisse zusammen und bietet einen Ausblick über die zukünftige Entwicklung eines sprachbewussten Fachunterrichts.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Sprachliche Kompetenzen im Fachunterricht
- 3. Auftretende Probleme bei der Aneignung der Fachsprache
- 3.1 Definition Fachsprache
- 3.2 Merkmale von Fachsprachen
- 3.2.1 Morphologie und Syntax
- 3.2.2 Fachtypische Sprachstrukturen
- 3.2.3 Fachinhalte
- 3.2.4 Struktur von Fachtexten
- 4. Begriffsbestimmung des Scaffolding
- 5. Theoretische Grundlagen zum Scaffolding - Ansatz
- 5.1 Vygotskis soziale Lerntheorie
- 5.2 Hallidays funktionale Sprachtheorie
- 6. Scaffolding-Arten
- 6.1 Mikro- und Makro-Scaffolding
- 6.1.1 Bedarfsanalyse
- 6.1.2 Lernstandserfassung
- 6.1.3 Unterrichtsplanung
- 6.1.4 Unterrichtsinteraktion – Mikro-Scaffolding
- 6.1 Mikro- und Makro-Scaffolding
- 7. Merkmale und Prinzipien des Scaffolding-Unterrichts
- 7.1 Effektivität des Scaffolding
- 7.2 Mögliche Umsetzung des Scaffolding - Ansatzes im Rahmen des Religionsunterrichts
- 8. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Scaffolding-Ansatz nach Pauline Gibbons im Kontext des sprachsensiblen Fachunterrichts für Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache (DaZ/DaF). Ziel ist es, die Herausforderungen bei der Aneignung von Fachsprache zu beleuchten und die Merkmale eines sprachsensiblen Unterrichts nach Gibbons zu definieren.
- Herausforderungen beim Erwerb von Fachsprache durch DaZ/DaF-Schüler
- Merkmale von Fachsprache auf verschiedenen Ebenen (Wort, Satz, Text)
- Theoretische Grundlagen des Scaffolding-Ansatzes (Vygotsky, Halliday)
- Kriterien für einen sprachsensiblen Fachunterricht nach dem Scaffolding-Ansatz
- Empirische Belege für die Effektivität von Scaffolding
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung veranschaulicht die Schwierigkeiten beim Gebrauch von Fachsprache für DaZ/DaF-Schüler anhand eines alltäglichen Beispiels (Wegbeschreibung in einer Fremdsprache). Sie hebt die Diskrepanz zwischen dem vorhandenen Wissen und der Fähigkeit, dieses sprachlich im Fachunterricht auszudrücken hervor und führt in die Thematik des sprachsensiblen Fachunterrichts und des Scaffolding-Ansatzes ein. Das Zitat eines Schülers verdeutlicht die emotionale Belastung, die mit diesem Sprachdefizit einhergeht. Die Arbeit fokussiert auf die Probleme beim Erwerb von Fachsprache und die Konzeption eines sprachsensiblen Unterrichts nach Gibbons.
2. Sprachliche Kompetenzen im Fachunterricht: Dieses Kapitel unterscheidet zwischen der alltagssprachlichen dialogischen Kompetenz (BICS) und der kognitiv-akademischen Sprachkompetenz (CALP) nach Cummins. Es betont die hohen sprachlichen Anforderungen an SuS im Fachunterricht, insbesondere die Notwendigkeit, Fachinhalte über sprachliche und textliche Inputs zu verarbeiten. Die Fachsprache wird als konzeptionell schriftliche Varietät beschrieben, die sich durch konzentrierte Lexik, komplexe Satzstrukturen und spezifische Fachtermini auszeichnet, im Gegensatz zur eher informellen und merkmalsarmen Alltagssprache (BICS).
3. Auftretende Probleme bei der Aneignung der Fachsprache: Dieses Kapitel grenzt die Alltagssprache von der Fachsprache ab und analysiert die spezifischen Merkmale der Fachsprache auf Wort-, Satz- und Textebene. Es stellt einen Zusammenhang zwischen diesen Merkmalen und den Lernschwierigkeiten von DaZ/DaF-SuS her. Die Kapitel 3.1 und 3.2 gehen detailliert auf die Definition und die verschiedenen Merkmale von Fachsprache ein, einschließlich morphologischer und syntaktischer Besonderheiten, fachspezifischer Sprachstrukturen, Fachinhalte und der Struktur von Fachtexten.
4. Begriffsbestimmung des Scaffolding: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs "Scaffolding" und seinen theoretischen Grundlagen. Es werden die relevanten Beiträge von Vygotskys sozialer Lerntheorie und Hallidays funktionaler Sprachtheorie eingebunden und deren Relevanz für den Scaffolding-Ansatz nach Gibbons erläutert, um ein solides Verständnis des zugrunde liegenden Konzepts zu schaffen.
5. Theoretische Grundlagen zum Scaffolding - Ansatz: Dieses Kapitel vertieft die theoretischen Grundlagen des Scaffolding-Ansatzes. Es erläutert im Detail, wie Vygotskys soziale Lerntheorie und Hallidays funktionale Sprachtheorie die Konzeption und Umsetzung des Scaffolding-Ansatzes beeinflussen. Die beiden Theorien werden eingehend beschrieben und ihre praktische Bedeutung für den sprachsensiblen Fachunterricht wird herausgearbeitet.
6. Scaffolding-Arten: Das Kapitel 6 fokussiert auf die verschiedenen Arten von Scaffolding, insbesondere die Unterscheidung zwischen Mikro- und Makro-Scaffolding. Es werden konkrete Kriterien vorgestellt, die für die Planung und Durchführung eines sprachsensiblen Fachunterrichts nach dem Scaffolding-Ansatz relevant sind. Die Unterkapitel 6.1.1 bis 6.1.4 gehen detailliert auf die einzelnen Aspekte der Planung und Umsetzung von Scaffolding ein.
7. Merkmale und Prinzipien des Scaffolding-Unterrichts: Kapitel 7 beleuchtet die Merkmale und Prinzipien eines effektiven Scaffolding-Unterrichts und präsentiert empirische Studien, die dessen Wirksamkeit belegen. Kapitel 7.2 beschreibt exemplarisch eine konkrete Unterrichtsstunde im Religionsunterricht, die nach den Prinzipien des sprachsensiblen Fachunterrichts gestaltet wurde, um die praktische Anwendung des Ansatzes zu veranschaulichen.
Schlüsselwörter
Scaffolding, sprachsensibler Fachunterricht, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Deutsch als Fremdsprache (DaF), Fachsprache, kognitiv-akademische Sprachkompetenz (CALP), alltagssprachliche dialogische Kompetenz (BICS), Vygotsky, Halliday, sprachliche Unterstützung, Unterrichtsplanung, Interaktion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Sprachsensibler Fachunterricht mit Scaffolding
Was ist das zentrale Thema des Dokuments?
Das Dokument behandelt den Scaffolding-Ansatz im sprachsensiblen Fachunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache (DaZ/DaF). Es untersucht die Herausforderungen beim Erwerb von Fachsprache und zeigt, wie der Scaffolding-Ansatz diese Herausforderungen bewältigen kann.
Welche Probleme beim Erwerb von Fachsprache werden behandelt?
Das Dokument beleuchtet die Schwierigkeiten von DaZ/DaF-Schülern beim Verstehen und Anwenden von Fachsprache. Es analysiert die Unterschiede zwischen Alltagssprache und Fachsprache auf verschiedenen Ebenen (Wort, Satz, Text) und erklärt, wie diese Unterschiede zu Lernschwierigkeiten führen können. Spezifische Merkmale der Fachsprache wie Morphologie, Syntax und fachtypische Sprachstrukturen werden detailliert untersucht.
Was ist Scaffolding und welche theoretischen Grundlagen liegen ihm zugrunde?
Scaffolding ist ein Ansatz im Unterricht, der Lernende durch gezielte Unterstützung beim Erwerb neuer Fähigkeiten und Kenntnisse begleitet. Die theoretischen Grundlagen des im Dokument behandelten Scaffolding-Ansatzes basieren auf Vygotskys sozialer Lerntheorie und Hallidays funktionaler Sprachtheorie. Diese Theorien erklären, wie soziale Interaktion und sprachliche Unterstützung das Lernen fördern.
Welche Arten von Scaffolding werden unterschieden?
Das Dokument unterscheidet zwischen Mikro- und Makro-Scaffolding. Mikro-Scaffolding bezieht sich auf die unmittelbare Unterstützung im Unterricht, während Makro-Scaffolding die langfristige Planung und Gestaltung des Unterrichts umfasst. Konkrete Beispiele für die Planung und Umsetzung von Scaffolding (Bedarfsanalyse, Lernstandserfassung, Unterrichtsplanung, Unterrichtsinteraktion) werden ebenfalls erläutert.
Wie wird Scaffolding im Unterricht umgesetzt?
Das Dokument beschreibt die Merkmale und Prinzipien eines effektiven Scaffolding-Unterrichts. Es werden empirische Belege für die Wirksamkeit von Scaffolding präsentiert. Ein Beispiel für die praktische Anwendung des Scaffolding-Ansatzes im Religionsunterricht wird vorgestellt, um die Umsetzung des Ansatzes zu veranschaulichen.
Welche Schlüsselbegriffe sind im Dokument relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Scaffolding, sprachsensibler Fachunterricht, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Deutsch als Fremdsprache (DaF), Fachsprache, kognitiv-akademische Sprachkompetenz (CALP), alltagssprachliche dialogische Kompetenz (BICS), Vygotsky, Halliday, sprachliche Unterstützung, Unterrichtsplanung und Interaktion.
Wie ist der Aufbau des Dokuments?
Das Dokument ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung, Sprachliche Kompetenzen im Fachunterricht, Probleme bei der Aneignung der Fachsprache, Begriffsbestimmung des Scaffolding, Theoretische Grundlagen zum Scaffolding-Ansatz, Scaffolding-Arten, Merkmale und Prinzipien des Scaffolding-Unterrichts und Resümee. Jedes Kapitel fasst seine Inhalte in einer Zusammenfassung zusammen.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für Lehrende, die im Fachunterricht mit DaZ/DaF-Schülern arbeiten. Es bietet wertvolle Informationen und praktische Tipps für die Gestaltung eines sprachsensiblen Unterrichts, der den individuellen Bedürfnissen der Schüler gerecht wird.
- Arbeit zitieren
- Victoria Theis (Autor:in), 2015, Der Scaffolding-Ansatz nach Pauline Gibbons im sprachsensiblen Fachunterricht, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/292843