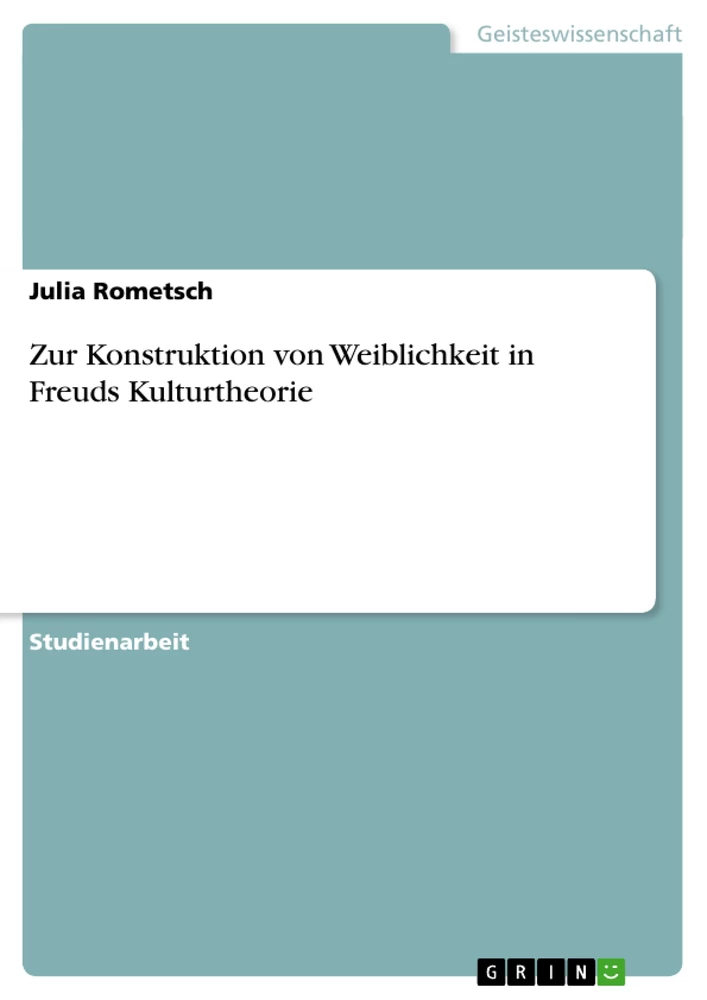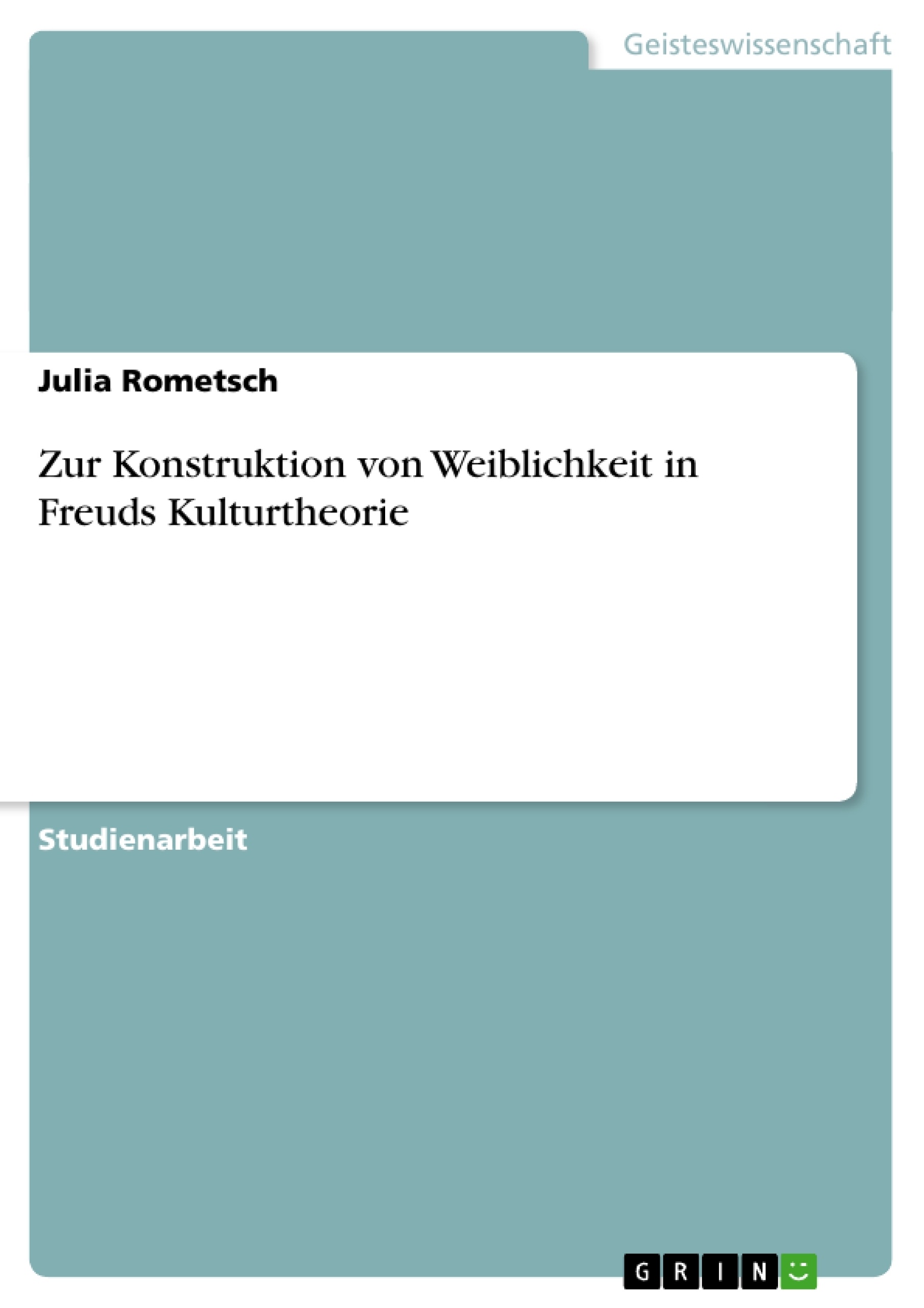Weibliche Geschichtslosigkeit – das ist die Problematik Silvia Bovenschens. Oder,
um Virginia Woolfs Bild aufzugreifen, wir können uns nicht auf die Couch legen, und
sagen: „Freud entdeckte den Penisneid, und Freud war eine Frau.“ Suchen wir in den
Geschichtsbüchern nach weiblichen Heldentaten, so werden wir nicht fündig, und
auch im Bereich der Kultur sind die (sichtbaren) Leistungen von Frauen eher
marginal. Der Bereich der weiblichen Tätigkeit war für Geschichtsschreiber nicht
interessant, war dieser Bereich doch auch recht begrenzt. Auf Grund der Spärlichkeit
historischer Quellen müssen Versuche, die Geschichte der Frauen zu rekonstruieren,
schnell auf Grenzen stoßen. So gilt es vielmehr, folgen wir Silvia Bovenschen, die
Geschichtslosigkeit des Weiblichen sichtbar zu machen, weniger anhand der
wenigen Dokumente über das Leben realer Frauen, sondern mit Hilfe der
Bilderwelten, den Präsentationen des Weiblichen in den unterschiedlichen Diskursen.
Silvia Bovenschen schlägt hier den literarischen Diskurs vor, nicht ohne darauf
hinzuweisen, das die machtvolle Präsenz des Weiblichen in der Fiktion in
umgekehrten Verhältnis zur Machtlosigkeit realer Frauen steht. Im
psychoanalytischen Diskurs, den ich in dieser Arbeit aufsuchen möchte, ist die
Auseinandersetzung mit Geschlechterdifferenzen, und deren Begründung in Natur
und Kultur fast ebenso präsent. Inge Stephan, deren Thesen ich hier kurz
wiedergeben will, bezeichnet die Psychoanalyse als kulturelles Deutungsmuster, auf
das die Literatur immer wieder, bewusst oder unbewusst, Bezug nimmt1. Umgekehrt
nimmt aber auch Freud immer wieder Bezug auf Literatur, weist er doch darauf hin,
man ( bzw. hier tatsächlich: Mann) solle sich auf der Suche nach der Lösung des
‚Rätsels Weib’ an die Dichter wenden. Dies tut er auch selbst: vor allem Mythen dienen Freud zur Erklärung psychischer Entwicklungen. Die Geschichte des Ödipus
wird hierbei zum Schlüsselmythos, der die Entwicklungslinien beider Geschlechter
erklären soll2. Dichterische Phantasie und psychoanalytische Arbeit werden auf der
gleichen Ebene angesiedelt, so das ein Bestätigungszusammenhang entsteht. So
kann, wo die eine Argumentationslinie versagt, die andere hinzutreten3. [...]
1 Inge Stephan, Musen und Medusen. Mythos und Geschlecht in der Literatur des 20. Jahrhunderts, Köln, 1997,
S.9
2 Ebd., S. 19
3 Ebd., S.21
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die imaginierte Weiblichkeit in Literatur und Psychoanalyse
- Das Weib als Ergänzungsbestimmung
- Ehefrau und Dirne
- Für wen ist die Kultur unbehaglich?
- Ist Kultur Schicksal?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Konstruktion von Weiblichkeit in Sigmund Freuds Kulturtheorie. Ziel ist es, die Bilder des Weiblichen in wissenschaftlichen und literarischen Texten zu analysieren und ihre Bedeutung für die Identität realer Frauen zu beleuchten. Die Arbeit beleuchtet die historischen und kulturellen Kontexte, die zur Entstehung dieser Bilder führten.
- Die Darstellung des Weiblichen als Ergänzung zum Männlichen
- Die Rolle der psychoanalytischen Theorie in der Konstruktion von Weiblichkeit
- Die Beziehung zwischen literarischen Bildern und psychoanalytischen Konzepten
- Die Bedeutung der Imagination von Weiblichkeit für die Identität realer Frauen
- Die Frage nach der Möglichkeit einer "realen" Weiblichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Der Text stellt die Problematik der weiblichen Geschichtslosigkeit und die Notwendigkeit in Frage, die Konstruktion von Weiblichkeit in unterschiedlichen Diskursen zu untersuchen. Insbesondere wird der Fokus auf die Psychoanalyse als kulturelles Deutungsmuster gelegt, das sowohl von der Literatur beeinflusst wird als auch selbst Literatur verwendet, um psychologische Entwicklungen zu erklären. Die Bedeutung der imaginierten Weiblichkeit für die Rekonstruktion des „realen Lebens“ der Frauen wird als zentrale Fragestellung formuliert.
Die imaginierte Weiblichkeit in Literatur und Psychoanalyse
Der Text analysiert die Position des Weiblichen in der Kultur des 20. Jahrhunderts, wobei das Männliche als allgemein-menschliches dargestellt wird. Silvia Bovenschen argumentiert, dass das Weibliche als Ergänzung zum Männlichen gedacht wird, seine Funktion durch den „Dienst am Mann“ bestimmt wird. Diese Vorstellung führt zu einer Verengung der weiblichen Rolle auf die des „Muse“ und negiert eine eigenständige künstlerische oder literarische Tätigkeit der Frau. Claudia Honegger untersucht den wissenschaftlichen Diskurs über die Totaldifferenz des weiblichen Geschlechts zwischen 1750 und 1850. Die Untersuchung zeigt, wie der weibliche Körper als „beseelte Maschine“ dargestellt wird, die geistige Fähigkeiten der Frau auf die Mutterschaft beschränkt und eine wissenschaftliche Tätigkeit ausschließt. Der Text beleuchtet die Rolle der „Zurichtung“ der Frau im Bürgertum und die Veränderung im Geschlechterverhältnis durch die veränderte Arbeitsteilung. Beispielhaft werden Zitate von J.G. Fichte und J.F. Fries angeführt, die die Vorstellung vom Weib als Ergänzung zum Mann und seine natürliche Bestimmung zur Mutterschaft verdeutlichen. Diese „natürlichen“ Gegebenheiten werden als unveränderlich dargestellt, was zu einer Verdoppelung der Bilder von Weiblichkeit und einer Vermischung von Phantasie und Realität führt. Die Inszenierung von Weiblichkeit am Beispiel des Dramas „Lulu“ von Frank Wedekind wird als Projektionsfeld für Weiblichkeitsmythen beschrieben.
Schlüsselwörter
Weiblichkeit, Kulturtheorie, Psychoanalyse, Geschlechterdifferenz, Imaginationen, Literatur, Mythen, Freud, Bovenschen, Honegger, Duden, Männlichkeit, Ergänzungstheorie, bürgerliche Gesellschaft, Mutterschaft, Geschichtslosigkeit
- Quote paper
- Julia Rometsch (Author), 2004, Zur Konstruktion von Weiblichkeit in Freuds Kulturtheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/29153