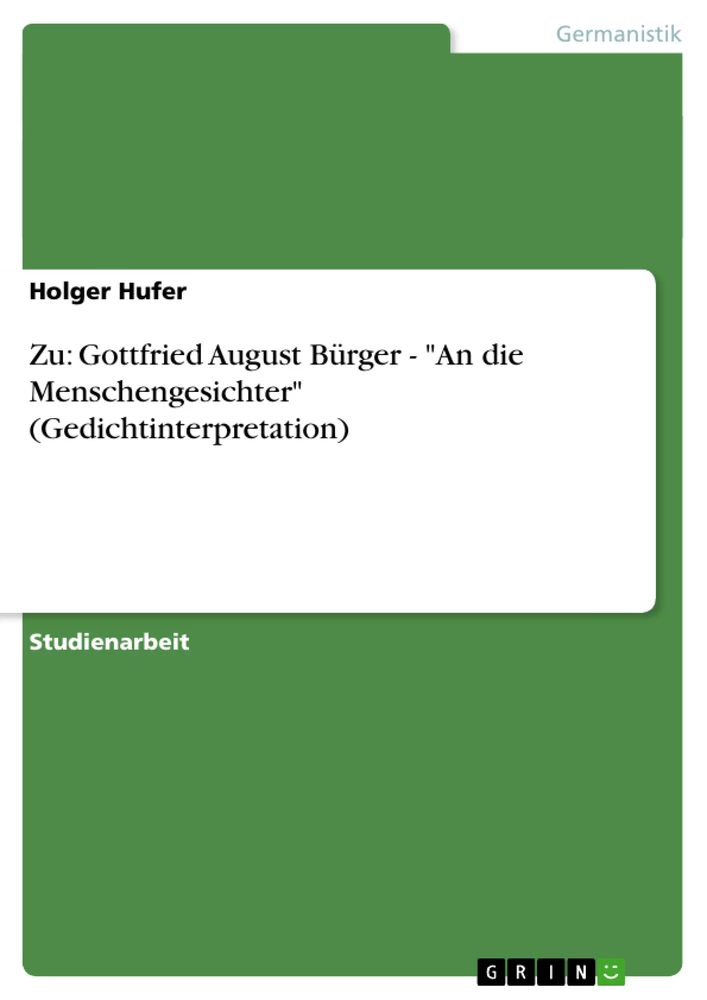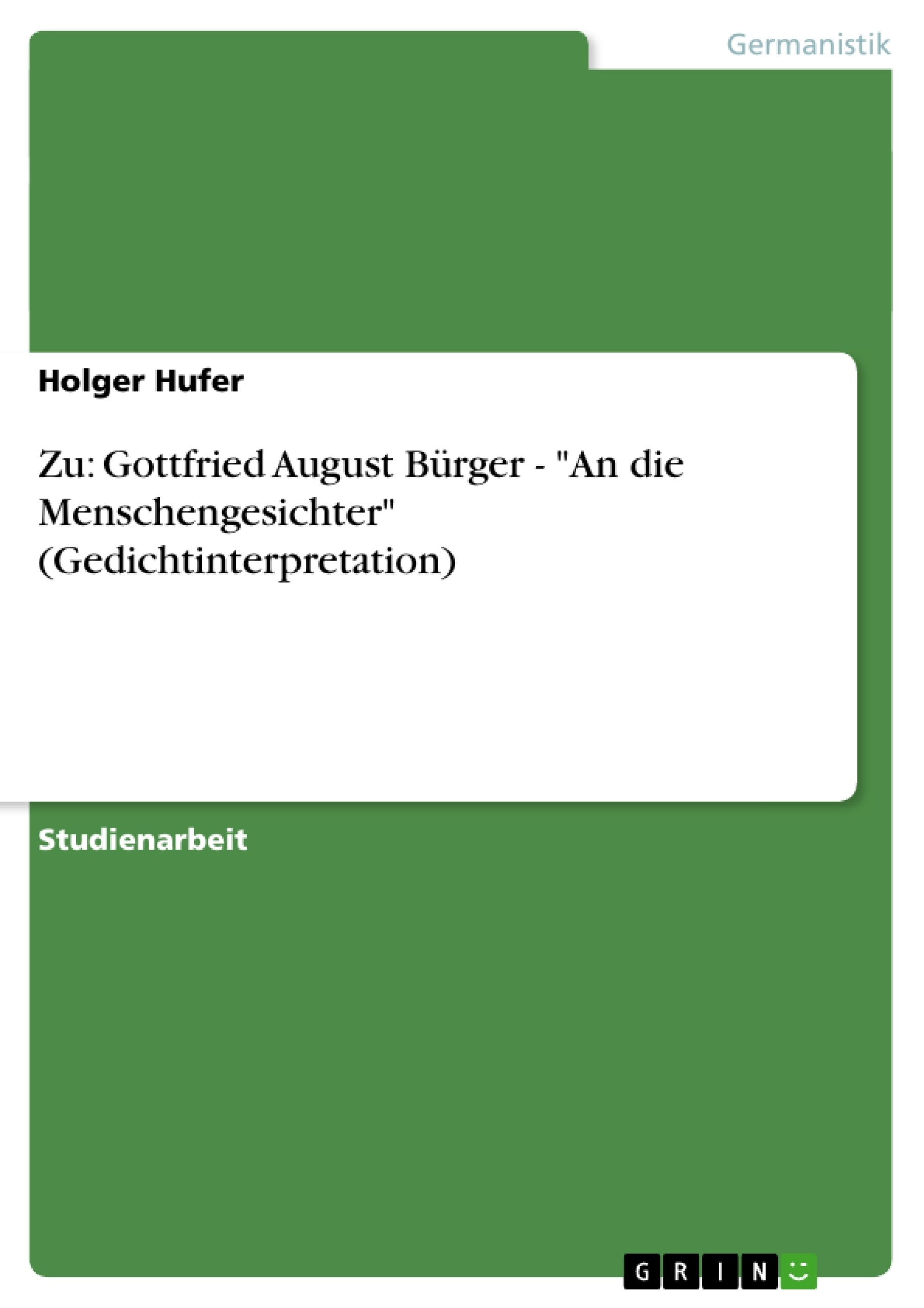I. Einleitung
Zum Forschungsstand bzw. zur Sekundärliteratur ist zu vermerken, dass vorgefertigte
Interpretationen als auch weiterführende Sekundärliteratur, die sich explizit mit Gottfried
August Bürgers Gedicht An die Menschengesichter auseinandersetzt, nicht vorliegen, d.h.
fortan will ich versuchen, den Text sowohl in Zusammenhang zu anderen Gedichten des
Autors zu stellen, eventuelle gattungs-oder epochentypische Merkmale bzw. Motive
herauszuarbeiten und daneben nicht zuletzt anhand eigener interpretatorischer Ansätze
Erkenntnisse aus dem Text selber zu ziehen, wobei ich mir der Tatsache bewusst bin, dass
derartige Erkenntnisse nicht von allen, die sich wissenschaftlich mit poetischen Texten
befassen, geteilt werden. Die Entstehung des Werkes selbst ist auf das Jahr 1778 datiert, der
vorliegende Text in der uns vorliegenden Fassung geht auf einen Druck im Jahr 1789 zurück,
erschienen im selben Jahr in der zweiten Bürgerschen Gedichtsausgabe.
Bei dem folgenden Versuch einer Interpretation will ich mich im Wesentlichen auf den
Textinhalt beschränken, formale Aspekte will ich lediglich, sofern nicht nötig bzw. der
Untermalung des Inhaltes verdeutlichend, einer untergeordneten Betrachtung zukommen
lassen. Gerade die Liebeslyrik des Sturm und Drang-Poeten G. A. Bürger wird
wissenschaftlich immer wieder in eine Linie zu stellen versucht mit subjektiven Erfahrungen
des Dichters, der unter seinen schärfsten Kritikern noch zu dessen Lebzeiten als Bigamist
verrufen war.1 Darüber hinaus zeigt ein Teil seiner Liebeslyrik frivole, obszöne oder gar
pornographische Ansätze, was in der strengen Moral des Bürgertums Widerstreben auslöste.2
Dennoch will ich versuchen – soweit möglich – subjektive Erfahrungen des Dichters außen
vor zu lassen, um die poetische Wahrheit in erster Linie im Werk und weniger in
biographischen Daten und Anmerkungen zu suchen.
Vorneweg sei angemerkt, dass das fortan im Mittelpunkt der Beleuchtung stehende
Bürgersche Gedicht den Titel An die Menschengesichter trägt, ein Titel, mit dem der Leser
sofort eine Briefanrede assoziiert. Der Text selber beinhaltet wenige briefartige Elemente,
eher ist der Gedichtstitel zu werten als eine Adressierung an die zeitgenössische Gesellschaft,
die dem lyrischen Ich ungewogen ist aufgrund dessen sexueller Exzesse, wie der Text es
vermuten lässt. In Bitten und Appellen versucht das lyrische Ich,...
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung
- II Interpretation des Gedichtes An die Menschengesichter von Gottfried August Bürger
- III Stilistik, Sprachstil und Verständlichkeit des „Volksdichters“
- IV Das Hauptmotiv der „,unkonventionellen“ Liebe als epochentypisches Merkmal
- V Naturrecht und Der versetzte Himmel - Thematische Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- VI Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit Gottfried August Bürgers Gedicht "An die Menschengesichter". Der Text wird unter Berücksichtigung von gattungs- und epochentypischen Merkmalen interpretiert und in den Kontext der Liebeslyrik des Sturm und Drang gestellt. Dabei wird die Frage nach der Rolle von moralischen Konventionen und den Grenzen von Sinnlichkeit in der Gesellschaft des 18. Jahrhunderts untersucht.
- Interpretation von "An die Menschengesichter"
- Analyse des Sprachstils und der Stilmittel in Bürgers Werk
- Die "unkonventionelle" Liebe als Merkmal des Sturm und Drang
- Bezüge zum Naturrecht und zur gesellschaftlichen Moral
- Die Rolle von Konventionen und Freiheit im Gedicht
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet den Forschungsstand und die Sekundärliteratur zum Gedicht. Zudem wird der historische Kontext der Entstehung des Werkes und die Rezeption des Autors durch die Zeitgenossen skizziert.
- II. Interpretation des Gedichtes An die Menschengesichter von Gottfried August Bürger: Diese Kapitel analysiert die zentralen Motive des Gedichts und interpretiert die Sprache und die Bildsprache. Dabei wird insbesondere auf die Beziehung des lyrischen Ichs zu den "Menschengesichtern" und die Rolle der Liebe und des Leidens eingegangen.
- III. Stilistik, Sprachstil und Verständlichkeit des „Volksdichters“: Der dritte Teil beleuchtet den Sprachstil des Autors und untersucht seine Bedeutung für die Verständlichkeit des Gedichts. Dabei werden die stilistischen Mittel und deren Wirkung auf den Leser analysiert.
- IV. Das Hauptmotiv der „,unkonventionellen“ Liebe als epochentypisches Merkmal: Hier wird die "unkonventionelle" Liebe als zentrales Motiv des Gedichts und des Sturm und Drang untersucht. Die gesellschaftliche Bedeutung des Motivs und dessen Relevanz für die damalige Zeit werden beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt Themen wie die Interpretation von Gedichten, die Liebeslyrik des Sturm und Drang, Gottfried August Bürger, "An die Menschengesichter", Sprachstil, Stilmittel, Moral, Konventionen, Freiheit, Sinnlichkeit, und die Rolle der Gesellschaft.
- Quote paper
- Holger Hufer (Author), 2003, Zu: Gottfried August Bürger - "An die Menschengesichter" (Gedichtinterpretation), Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/29050