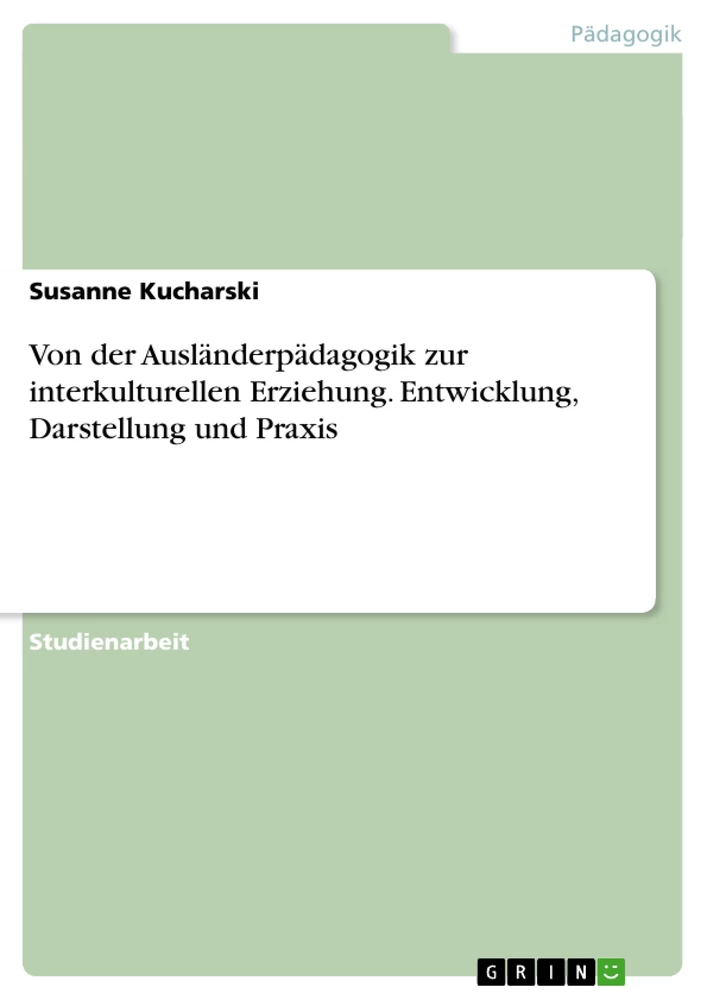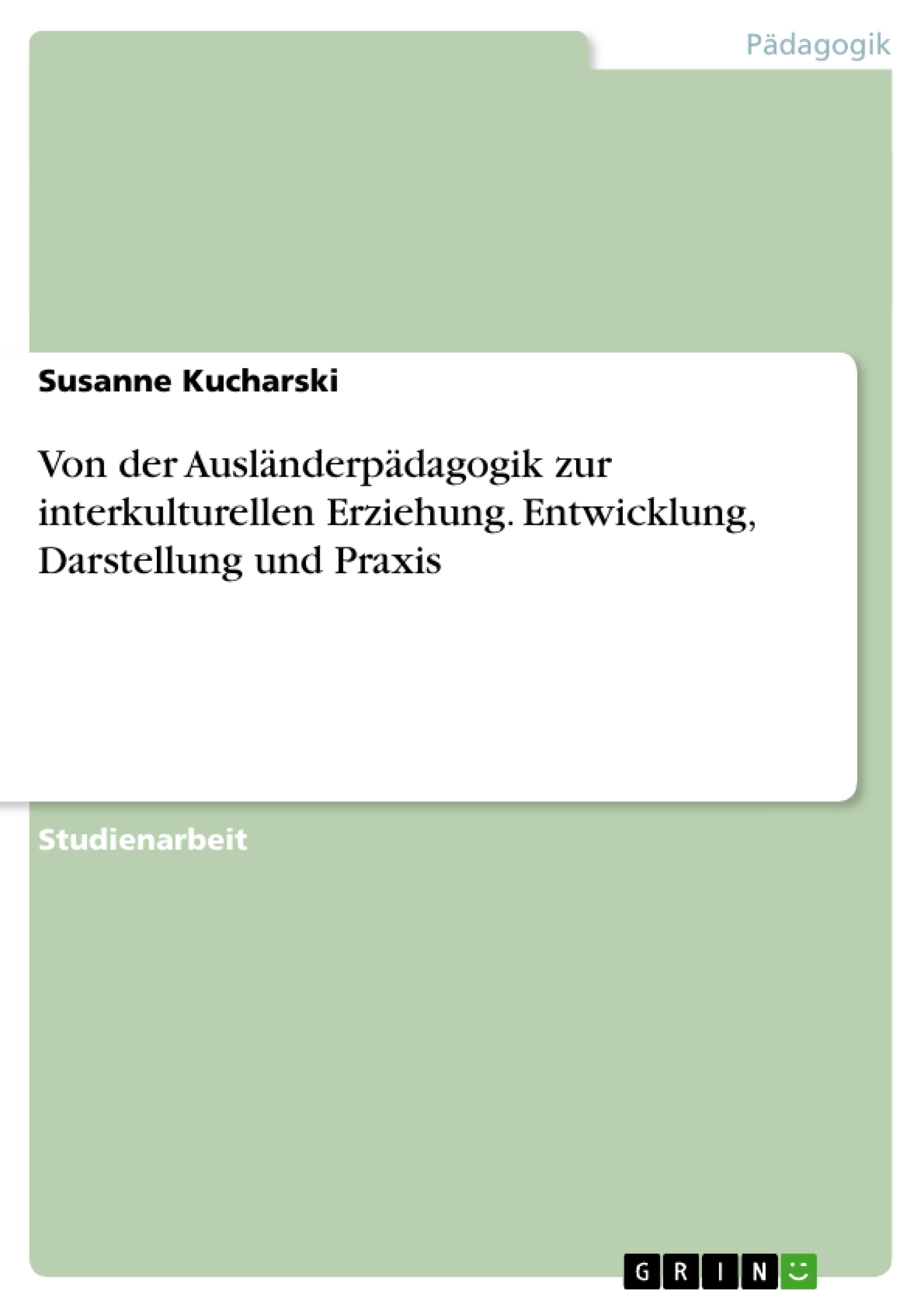Seit Ende des zweiten Weltkrieges hat die BRD eine enorm ethnisch-kulturelle Pluralisierung der Bevölkerung erfahren. Deutschland zählt seitdem zu den Industrieländern, die die höchste Einwanderungsquote aufweisen. Während der 60er Jahre wurden ArbeiterInnen aus den süd- und südosteuropäischen Ländern von der BRD angeworben. Die Politik, Gesellschaft sowie auch Institutionen sahen über die Herausforderungen, die durch die Einwanderung der „Gastarbeiter“ entstanden, hinweg. Die GastarbeiterInnen waren zum größten Teil jung, meist ledig oder ließen ihre Familie in der Heimat zurück. Die GastarbeiterInnen, aber auch staatliche Instanzen und Betriebe gingen von einem auf eine absehbare Zeit befristeten Aufenthalt in der BRD aus.1 Da die Anzahl der schulpflichtigen Kinder aus den Gastarbeiter-Familien nicht groß war, sah die Schulverwaltung noch keine Notwendigkeit besonderer Maßnahmen für die Integration dieser Kinder in der Schule. Erst zu Beginn der 70er Jahre wurde das Problem seitens der Wissenschaft reflektiert.2 In meiner Hausarbeit möchte ich den Schwerpunkt auf die Entwicklung von der Ausländerpädagogik hin zur interkulturellen Pädagogik legen. Zunächst werde ich die Gründe dieser Entwicklung näher betrachten und anschließend sowohl die Merkmale der Ausländerpädagogik als auch die der interkulturellen Pädagogik beschreiben. Zuletzt präsentiere ich Beispiele von verschiedenen Autoren wie und ob die interkulturelle Erziehung heute verwirklicht wird. Anbei möchte ich hinzufügen, dass ich in der Hausarbeit die neue Rechtschreibregelung anwende und zur Vereinfachung die männliche und weibliche Form bei Personen immer mit dem Anhängsel „-Innen“ zusammenfasse. Beispielsweise verbinde ich „Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter“ zu dem einen Begriff „GastarbeiterInnen“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Von der Ausländerpädagogik zur interkulturellen Erziehung
- Drei Phasen der Theoriebildung
- Die Ausländerpädagogik
- Zielsetzungen der Bildungskonzepte
- Muddling Through
- Kritik an der Ausländerpädagogik
- Die interkulturelle Pädagogik
- Zielsetzungen der interkulturellen Erziehung
- Grundprinzipien der interkulturellen Erziehung im Elementarbereich
- Praxisbeispiele
- Beispielhafte Ansätze für interkulturelle Erziehung
- Geringe Realisierung interkultureller Aspekte in der Schule
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Entwicklung der Pädagogik in Bezug auf die Herausforderungen der Einwanderung in Deutschland. Sie analysiert den Wandel von der Ausländerpädagogik zur interkulturellen Pädagogik und beleuchtet die jeweiligen Zielsetzungen und Kritikpunkte. Die Arbeit präsentiert außerdem Praxisbeispiele und diskutiert die Umsetzung interkultureller Erziehung in der Schule.
- Entwicklung der Pädagogik im Kontext der Einwanderung
- Vergleich zwischen Ausländerpädagogik und interkultureller Pädagogik
- Kritik an der Ausländerpädagogik
- Zielsetzungen interkultureller Erziehung
- Praxisbeispiele und deren Umsetzung in der Schule
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit, indem sie die zunehmende ethnisch-kulturelle Pluralisierung der deutschen Bevölkerung seit dem Zweiten Weltkrieg und die damit verbundenen Herausforderungen für das Bildungssystem beleuchtet. Sie skizziert den Fokus der Arbeit auf die Entwicklung von der Ausländerpädagogik zur interkulturellen Pädagogik und kündigt die Betrachtung der Merkmale beider Ansätze sowie die Präsentation von Praxisbeispielen an. Die Autorin erklärt auch ihre Verwendung der neuen Rechtschreibung und die Vereinfachung der Geschlechterdarstellung.
Von der Ausländerpädagogik zur interkulturellen Erziehung: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung der pädagogischen Ansätze im Umgang mit der Einwanderung anhand der von Nieke (1986) vorgeschlagenen Dreiteilung. Die erste Phase (Ausländerpädagogik als kompensatorische Erziehung und Assimilationspädagogik) fokussiert auf die Behebung von Sprachdefiziten bei Kindern aus Einwandererfamilien, mit dem Ziel der Integration und der Möglichkeit der Rückkehr in das Herkunftsland. Die zweite Phase kennzeichnet eine selbstkritische Auseinandersetzung mit den Grenzen und Defiziten der Ausländerpädagogik, die mit wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Faktoren in Verbindung gebracht werden. Die dritte Phase beschreibt den Wandel hin zur interkulturellen Erziehung in einer multikulturellen Gesellschaft, geprägt von Debatten um Kulturrelativismus und Universalismus.
Die Ausländerpädagogik: Dieses Kapitel befasst sich mit den Zielen der Bildungskonzepte der Ausländerpädagogik. Es untersucht die Strategien zur Integration von Kindern aus Einwandererfamilien, die sich vor allem auf die Kompensation von Sprachdefiziten konzentrierten. Die Kritik an diesem Ansatz wird ebenfalls beleuchtet, einschließlich der Diskussion um Assimilation und die unzureichende Berücksichtigung der kulturellen Hintergründe der Kinder. Der Abschnitt „Muddling Through“ impliziert vermutlich ein pragmatisches, aber unstrukturiertes Vorgehen, welches die tieferliegenden gesellschaftlichen Herausforderungen nicht umfassend adressiert.
Die interkulturelle Pädagogik: Dieses Kapitel beschreibt die Ziele und Grundprinzipien der interkulturellen Erziehung, besonders im Elementarbereich. Im Gegensatz zur Ausländerpädagogik legt sie einen stärkeren Fokus auf die Anerkennung und Wertschätzung verschiedener Kulturen. Sie zielt auf eine inklusive Bildung ab, die die kulturelle Vielfalt als Bereicherung versteht und auf einen Dialog zwischen den Kulturen setzt. Die Kapitel erläutert die Konzepte einer multikulturellen Bildung, die weit über die reine Sprachförderung hinausgeht.
Schlüsselwörter
Ausländerpädagogik, Interkulturelle Erziehung, Migration, Integration, Assimilation, Multikulturalität, Bildungskonzepte, Sprachförderung, Kulturrelativismus, Universalismus, Einwanderung, gesellschaftliche Integration.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Von der Ausländerpädagogik zur interkulturellen Erziehung
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Entwicklung der Pädagogik in Bezug auf die Herausforderungen der Einwanderung in Deutschland. Sie analysiert den Wandel von der Ausländerpädagogik zur interkulturellen Pädagogik und beleuchtet deren Zielsetzungen und Kritikpunkte. Die Arbeit präsentiert außerdem Praxisbeispiele und diskutiert die Umsetzung interkultureller Erziehung in der Schule.
Welche Phasen der Theoriebildung werden in der Hausarbeit unterschieden?
Die Arbeit folgt der von Nieke (1986) vorgeschlagenen Dreiteilung: Phase 1 (Ausländerpädagogik als kompensatorische Erziehung und Assimilationspädagogik), Phase 2 (selbstkritische Auseinandersetzung mit den Grenzen der Ausländerpädagogik) und Phase 3 (Wandel hin zur interkulturellen Erziehung in einer multikulturellen Gesellschaft).
Was sind die Zielsetzungen der Ausländerpädagogik?
Die Ausländerpädagogik konzentrierte sich auf die Kompensation von Sprachdefiziten bei Kindern aus Einwandererfamilien, mit dem Ziel der Integration und der Möglichkeit der Rückkehr in das Herkunftsland. Kritikpunkte waren die Assimilation und die unzureichende Berücksichtigung der kulturellen Hintergründe.
Was sind die Zielsetzungen und Grundprinzipien der interkulturellen Erziehung?
Die interkulturelle Erziehung betont die Anerkennung und Wertschätzung verschiedener Kulturen. Sie zielt auf inklusive Bildung ab, die kulturelle Vielfalt als Bereicherung versteht und auf einen Dialog zwischen den Kulturen setzt. Sie geht über reine Sprachförderung hinaus.
Welche Praxisbeispiele werden behandelt?
Die Hausarbeit präsentiert beispielhafte Ansätze für interkulturelle Erziehung und diskutiert die (geringe) Realisierung interkultureller Aspekte in der Schule. Konkrete Beispiele werden jedoch nicht im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgeführt.
Wie wird die Ausländerpädagogik kritisiert?
Die Kritik an der Ausländerpädagogik richtet sich gegen die Assimilationsbestrebungen, die unzureichende Berücksichtigung kultureller Hintergründe und ein möglicherweise pragmatisches, aber unstrukturiertes Vorgehen ("Muddling Through"), das die gesellschaftlichen Herausforderungen nicht umfassend adressiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Ausländerpädagogik, Interkulturelle Erziehung, Migration, Integration, Assimilation, Multikulturalität, Bildungskonzepte, Sprachförderung, Kulturrelativismus, Universalismus, Einwanderung, gesellschaftliche Integration.
Wie ist der Aufbau der Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur Entwicklung von der Ausländerpädagogik zur interkulturellen Erziehung, Kapitel zur Ausländerpädagogik und interkulturellen Pädagogik, Praxisbeispiele und abschließende Schlüsselwörter. Die Einleitung beschreibt den Kontext und den Fokus der Arbeit.
Welche Aspekte der Einwanderung werden im Kontext der Pädagogik beleuchtet?
Die Hausarbeit beleuchtet die zunehmende ethnisch-kulturelle Pluralisierung der deutschen Bevölkerung seit dem Zweiten Weltkrieg und die damit verbundenen Herausforderungen für das Bildungssystem. Der Fokus liegt auf dem pädagogischen Umgang mit Einwanderung und der Entwicklung verschiedener pädagogischer Ansätze.
Wie wird der Begriff "Muddling Through" im Kontext der Arbeit verwendet?
Der Begriff "Muddling Through" beschreibt vermutlich ein pragmatisches, aber unstrukturiertes Vorgehen in der Ausländerpädagogik, das die tieferliegenden gesellschaftlichen Herausforderungen nicht umfassend adressiert.
- Quote paper
- Susanne Kucharski (Author), 2003, Von der Ausländerpädagogik zur interkulturellen Erziehung. Entwicklung, Darstellung und Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/28937