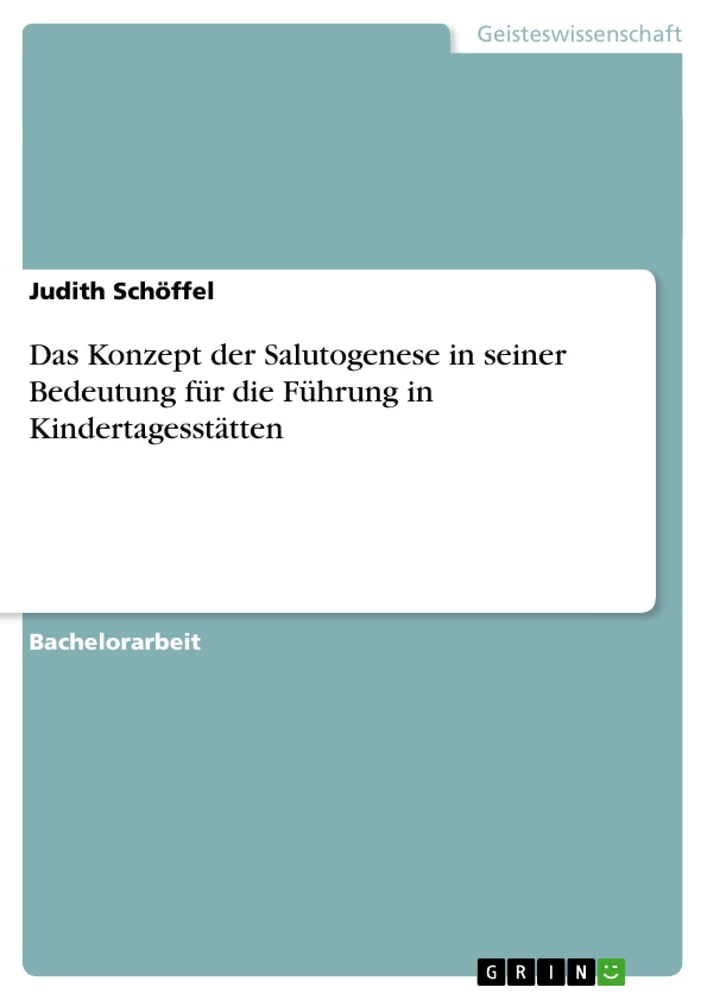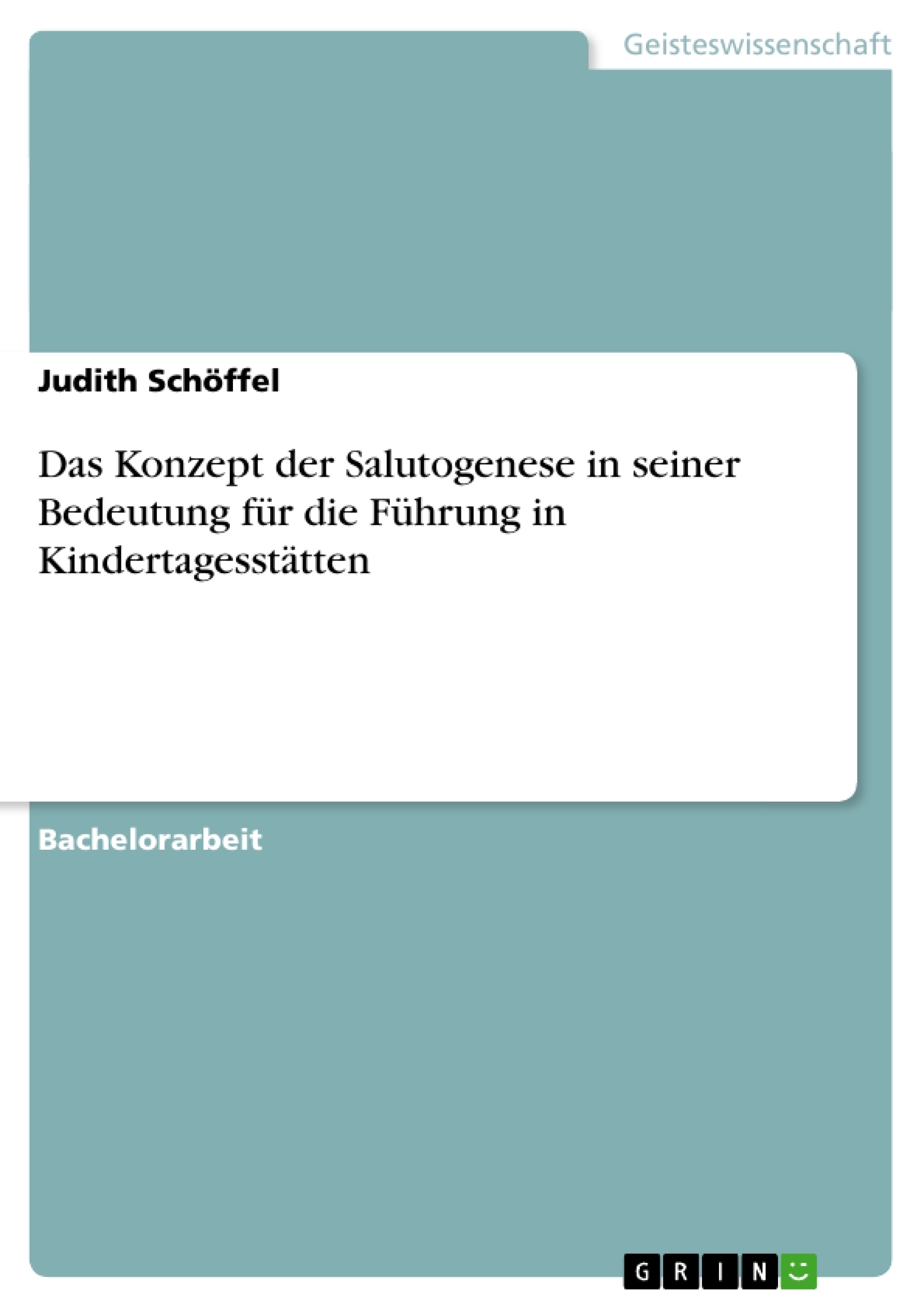Die Berufsgruppe der Erzieherinnen und Erzieher ist derzeit in zunehmendem Maß von berufsbedingten Erkrankungen betroffen. Der wachsende Anspruch an die in den Einrichtungen tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem seitens des Gesetzgebers und die zunehmende Arbeitsverdichtung, zusätzlich zu den schon bestehenden komplexen Anforderungen, wirken sich negativ auf den Gesundheitszustand aus. Krankheitsbedingte Ausfälle mindern die Qualität der pädagogischen Arbeit. Zudem verschärft sich dadurch die Situation des Fachkräftemangels in dieser Branche, der sich, insbesondere seit dem Rechtsanspruch auf Betreuung von Kindern unter 3 Jahren, eingestellt hat. Es ist äußerst schwierig, für längerfristig erkrankte Kolleginnen und Kollegen einen vorübergehenden Ersatz zu finden. Dies wiederum stellt die Einrichtungen vor große Schwierigkeiten, da diese durch gesetzliche Neuerungen nun verpflichtet sind, die Anwesenheit des Personals nachzuweisen und sicherzustellen. Gelingt das nicht drohen Förderkürzungen, was viele Einrichtungen vor existentielle Probleme stellt.
Durch die eigene Tätigkeit als Leitung einer Kindertagesstätte hat die Autorin einen persönlichen und praktischen Zugang zur Thematik. So konnte sie diese Entwicklung und die Auswirkungen im Alltag über einen längeren Zeitraum beobachten.
Arbeit macht nicht per so krank. Im Gegenteil belegen viele Studien, dass vor allem Arbeitslosigkeit eine gesundheitsschädigende Wirkung hat.
Nichtsdestotrotz ist die Problematik der berufsbedingten Erkrankungen bei Erzieherinnen und Erziehern einer Betrachtung würdig und eine lösungsorientierte Auseinandersetzung damit notwendig.
Mit dem Konzept der Salutogenese soll im Rahmen dieser Arbeit eine Möglichkeit beleuchtet werden. Salutogenese stellt die Frage nach der Entstehung von Gesundheit und danach, wie eine Person in ihren Ressourcen und Fähigkeiten gestärkt werden kann, damit sie resistenter gegen negative Umwelteinflüsse ist bzw. werden kann. In Zeiten, in denen Gesundheitsförderung, vor allem auch in betrieblichen Kontexten immer mehr an Bedeutung gewinnen, wird das Konzept der Salutogenese zunehmend interessant, da es wichtige Impulse und Anregungen hierfür bieten kann. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Vorgehen und Methodik
- 3. Das Konzept der Salutogenese.
- 3.1 Entstehungsgeschichte
- 3.2 Theorie der Salutogenese
- 3.2.1 Salutogenese und Pathogenese
- 3.2.2 Gesundheits-Krankheits-Kontinuum
- 3.2.3 Widerstandsressourcen - Widerstandsdefizite
- 3.2.4 Kohärenzgefühl
- 3.2.5 Entwicklung und Modifikation des SOC
- 3.3 Zusammenfassung
- 4. Arbeit in Kindertagesstätten und die Mitarbeiter/-innengesundheit
- 4.1 Aktueller Stand der Forschung zur Gesundheit und Arbeitszufriedenheit im Erzieher/-innenberuf
- 4.1.1 Fehlzeitenreport
- 4.1.2 BGW-DAK Stress-Monitoring
- 4.1.3 Kita-Studie der GEW
- 4.2 Das Arbeitsfeld im Wandel
- 4.2.1 Allgemeine Veränderungen der Arbeit in Kindertageseinrichtungen
- 4.2.2 Zur Lage in Bayern
- 4.3 Zusammenfassung
- 5. Die Mitarbeiter/-innengesundheit in Kindertagesstätten unter salutogenetischer Perspektive
- 6. Umsetzung der Salutogenese als Führungsansatz in Kindertageseinrichtungen
- 6.1 Salutogenese zum Thema machen
- 6.2 Neue Fehlerkultur entwickeln
- 6.3 Salutogenetisches Mitarbeitergespräch
- 6.4 Gegenseitige soziale Unterstützung im Team fördern
- 6.5 Salutogenese-Training für pädagogische Fachkräfte
- 6.6 HEDE-Training
- 6.7 Salutogenese und Gewerkschaft?
- 6.8 Kritische Betrachtung der Umsetzungsmöglichkeiten
- 6.9 Chancen und Grenzen salutogenetischer Führung in Kitas
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht das Konzept der Salutogenese und seine Bedeutung für die Führung in Kindertagesstätten. Sie analysiert die aktuelle Forschung zu Gesundheitszustand und Arbeitszufriedenheit von Erzieherinnen und Erziehern, beleuchtet die Auswirkungen der veränderten Arbeitsbedingungen auf diese Berufsgruppe und untersucht die Möglichkeiten der Implementierung salutogenetischer Prinzipien in die Führung von Kindertagesstätten.
- Gesundheitszustand und Arbeitszufriedenheit von Erzieherinnen und Erziehern
- Das Konzept der Salutogenese und seine Anwendung in der Führung
- Herausforderungen und Chancen der Implementierung salutogenetischer Prinzipien in Kindertagesstätten
- Entwicklung eines salutogenetischen Führungsansatzes für Kindertagesstätten
- Steigerung der Mitarbeitergesundheit und Reduktion krankheitsbedingter Ausfälle
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der berufsbedingten Erkrankungen bei Erzieherinnen und Erziehern dar und führt in das Konzept der Salutogenese ein. Kapitel 2 beschreibt die Methodik der Arbeit. Kapitel 3 präsentiert die Theorie der Salutogenese mit ihren zentralen Aspekten. Kapitel 4 beleuchtet den aktuellen Forschungsstand zum Gesundheitszustand und der Arbeitszufriedenheit von Erzieherinnen und Erziehern, sowie die Veränderungen im Arbeitsfeld der Kindertagesstätten. Kapitel 5 setzt sich mit der Mitarbeitergesundheit in Kindertagesstätten unter salutogenetischer Perspektive auseinander. Kapitel 6 beschäftigt sich mit der konkreten Umsetzung der Salutogenese als Führungsansatz in Kindertageseinrichtungen, wobei verschiedene Möglichkeiten, wie die Entwicklung einer neuen Fehlerkultur und die Förderung der sozialen Unterstützung im Team, vorgestellt werden. Abschließend werden die Chancen und Grenzen des salutogenetischen Führungsansatzes in Kitas beleuchtet.
Schlüsselwörter
Salutogenese, Führung, Kindertagesstätten, Mitarbeitergesundheit, Arbeitszufriedenheit, Erzieherinnen und Erzieher, Arbeitsbedingungen, Gesundheitsförderung, Kohärenzgefühl, Widerstandsfähigkeit, Stressmanagement, Fehlerkultur, soziale Unterstützung.
- Arbeit zitieren
- Judith Schöffel (Autor:in), 2014, Das Konzept der Salutogenese in seiner Bedeutung für die Führung in Kindertagesstätten, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/288337