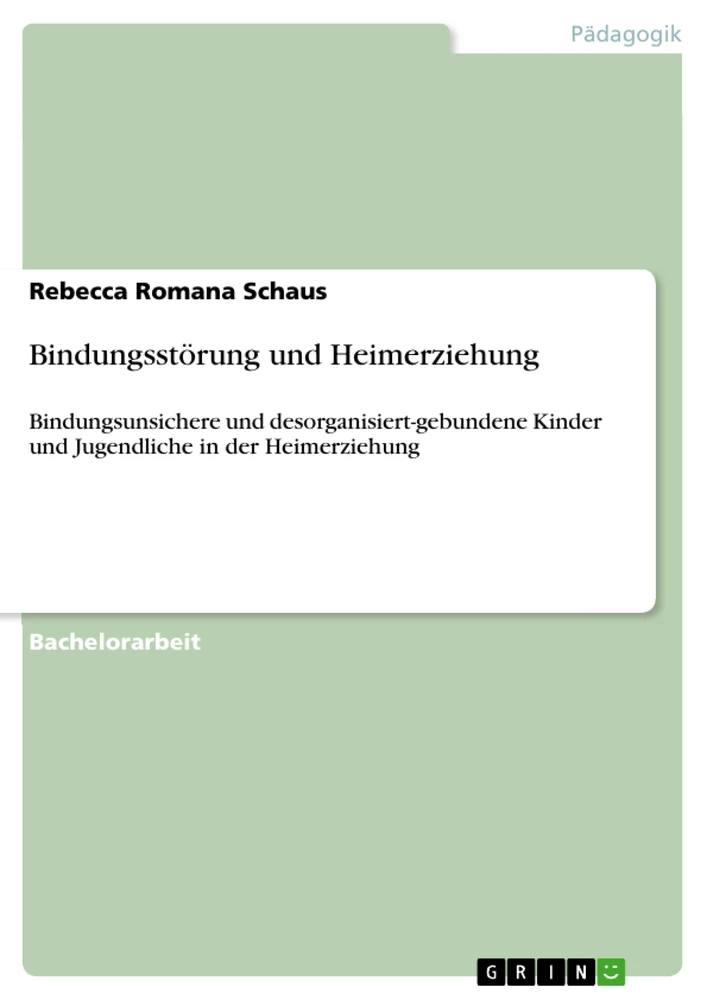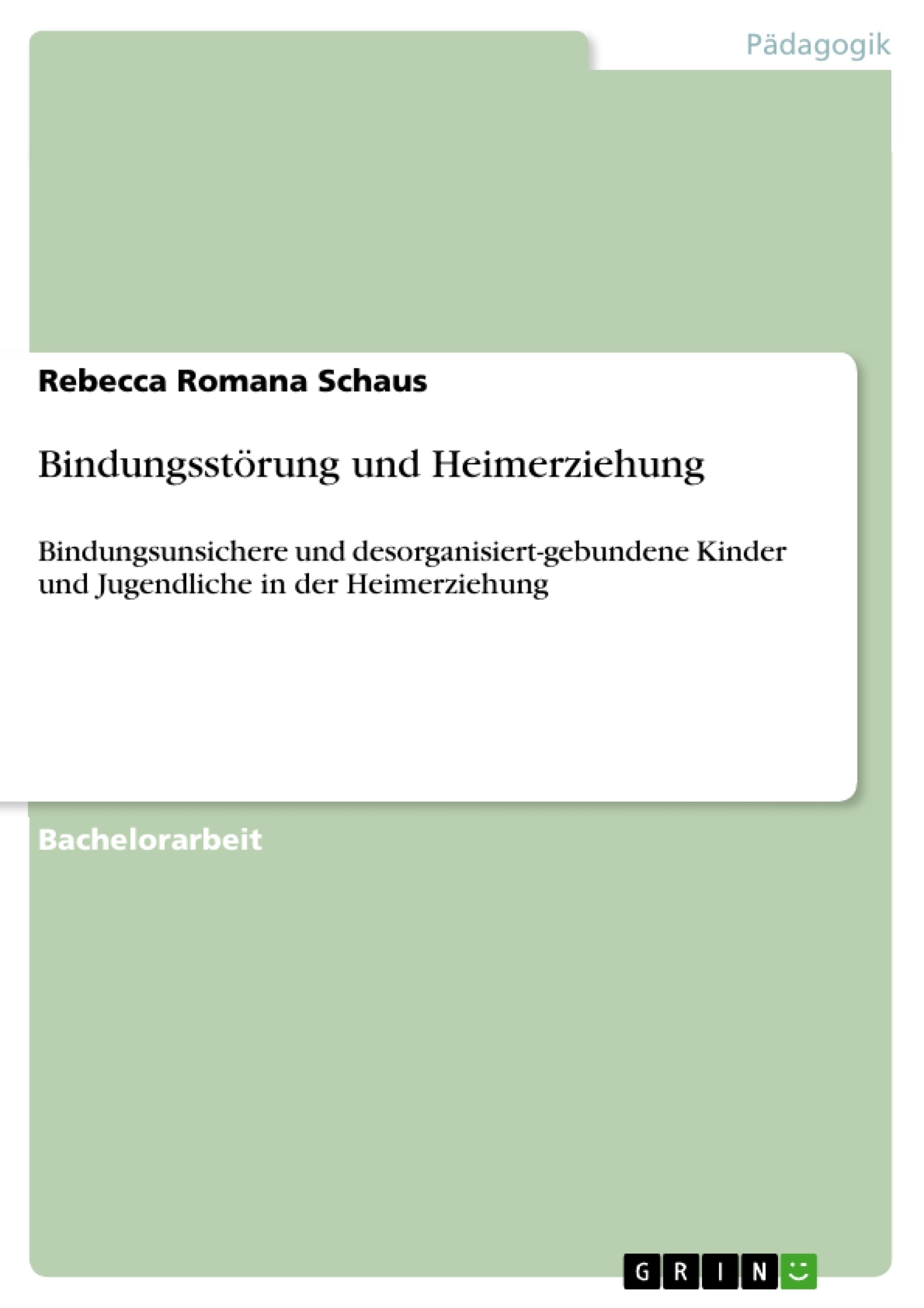„Eine sichere Bindungsentwicklung und das damit verbundene Urvertrauen wirken wie ein großer Schatz auf seiner anstehenden Reise“ (Brisch, 2010, zitiert nach Leitner und Schmieder, 2013, S. 2).
Leider kann ein Kind nicht immer auf den von Brisch erwähnten Schatz zurückgreifen. Vor allem Heimkinder haben vielmals negative Bindungserfahrungen erleben müssen. Durch Vernachlässigung und Zurückweisung, aber auch Missbrauch war es ihnen nicht möglich dieses Urvertrauen aufzubauen. Statt in wohlbehüteten Verhältnissen wuchsen sie größtenteils in einer traumatisierender Umwelt auf, in der Sicherheit nicht zu finden war. Aus diesen oder weiteren Gründen, welche meist auf Negativerfahrungen beruhen, wurden diese Kinder und Jugendlichen in einem Heim untergebracht.
Aus bindungstheoretischer Sicht sind diese Kinder und Jugendlichen in vielen Fällen als unsicher gebunden oder auch bindungsdesorganisiert einzustufen. Bedingt durch die Erlebnisse der Vergangenheit sind sie misstrauisch und angstvoll ihrer Umwelt, aber insbesondere Erwachsenen gegenüber. Sie erwarten nicht einmal mehr von neuen zur Verfügung stehenden Bezugspersonen Gutes, sondern rechnen immer wieder damit, in ihren Wünschen und Bedürfnissen zurückgewiesen und enttäuscht zu werden. Hier finden sich Aspekte der Bindungstheorie wieder. Diese beschreibt die zwischenmenschliche Beziehung zwischen Kind und primärer Bezugsperson, welche meist die Mutter ist, und erörtert, wie diese Erfahrungen das kindliche Verhalten, sowie die inneren Erwartungen an die Bindungsperson beeinflussen.
Die Heimerziehung soll Kindern und Jugendlichen eine neue, verbesserte Lebensumwelt bereitstellen und sie bestmöglich in ihrer Entwicklung fördern. Doch dies ist in der Praxis immer wieder mit Schwierigkeiten verbunden. Die BetreuerInnen im Heim sollen im Rahmen von Schichtdienst und hoher Fluktuation zu einer Bezugsperson für ein Kind werden, welches Feinfühligkeit und ein Eingehen auf seine Bedürfnisse kaum oder nie erlebt hat. Es stellt sich deshalb die Frage, wie genau pädagogisch auf diese bindungsunsicheren oder sogar bindungsgestörten Kinder und Jugendlichen in der Heimerziehungspraxis eingegangen werden kann, um ihnen einen Weg zu einem sicheren Bindungskonzept aufzuzeigen und welche Rahmenbedingungen dafür zu beachten sind.
Damit verbunden sollten jedoch zunächst grundlegende Aspekte der Bindungstheorie beleuchtet werden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Bindungstheoretische Grundlagen
- 2.1 Die Bindungstheorie nach John Bowlby
- 2.1.1 Bindung
- 2.1.2 Bindungsverhalten
- 2.1.3 Die sichere Basis
- 2.1.4 Bindungsentwicklung
- 2.1.5 Das innere Arbeitsmodell
- 2.2 Bindungsqualität
- 2.2.1 Die sichere Bindung
- 2.2.2 Die unsicher-vermeidende Bindung
- 2.2.3 Die unsicher-ambivalente Bindung
- 2.2.4 Die desorganisierte/desorientierte Bindung
- 3 Bindungsstörungen
- 3.1 Klassifikation von Bindungsstörungen nach dem ICD-10-GM
- 3.2 Diagnostik und Typologie von Bindungsstörungen nach Brisch
- 4 Heimerziehung
- 4.1 Definitionen der Begriffe „Heim“ und „Heimerziehung“
- 4.2 Betreuungsformen der Heimerziehung
- 4.3 Rechtliche Grundlagen
- 5 Bindungsstörungen und Heimerziehung
- 5.1 Die Rolle des Erziehers
- 5.2 Pädagogisches Handeln in Abhängigkeit der verschiedenen Bindungstypen
- 5.2.1 Zur Korrigierbarkeit innerer Arbeitsmodelle
- 5.2.2 Unterbringungsempfehlung
- 5.2.3 Umgang mit bindungsunsicheren Kindern und Jugendlichen
- 5.2.4 Umgang mit bindungsdesorganisierten Kindern und Jugendlichen
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Bindungsstörungen und Heimerziehung. Ziel ist es, die Herausforderungen der pädagogischen Arbeit mit bindungsunsicheren und desorganisiert-gebundenen Kindern und Jugendlichen in Heimen zu beleuchten und mögliche Handlungsansätze zu entwickeln.
- Bindungstheorie nach Bowlby und verschiedene Bindungstypen
- Klassifikation und Diagnostik von Bindungsstörungen
- Rahmenbedingungen und rechtliche Grundlagen der Heimerziehung
- Die Rolle der Erzieher in der Arbeit mit bindungsgestörten Kindern
- Pädagogische Handlungsansätze für den Umgang mit verschiedenen Bindungstypen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Bindungsstörungen bei Heimkindern ein. Sie stellt die Problematik dar, dass Heimkinder oft negative Bindungserfahrungen gemacht haben, die zu Misstrauen und Angst führen. Die Arbeit untersucht, wie pädagogisch auf diese Kinder eingegangen werden kann, um ihnen zu einem sicheren Bindungskonzept zu verhelfen, und beleuchtet die relevanten Aspekte der Bindungstheorie und die Rahmenbedingungen der Heimerziehung.
2 Bindungstheoretische Grundlagen: Dieses Kapitel erläutert die Bindungstheorie nach John Bowlby, inklusive der Konzepte von Bindung, Bindungsverhalten, sicherer Basis, Bindungsentwicklung und dem inneren Arbeitsmodell. Es beschreibt detailliert die verschiedenen Bindungsqualitäten (sicher, unsicher-vermeidend, unsicher-ambivalent, desorganisiert/desorientiert) und deren Auswirkungen auf das kindliche Verhalten und die Beziehungen im Laufe des Lebens. Die Bedeutung des inneren Arbeitsmodells als prägendes Element für zukünftige Beziehungen wird hervorgehoben.
3 Bindungsstörungen: Kapitel 3 befasst sich mit der Klassifizierung von Bindungsstörungen, zunächst anhand des ICD-10-GM. Da diese Klassifizierung als zu allgemein angesehen wird, konzentriert sich der Text anschließend auf die detailliertere Diagnostik und Typologie von Bindungsstörungen nach Karl-Heinz Brisch. Dieser Abschnitt liefert ein vertieftes Verständnis der verschiedenen Ausprägungen von Bindungsstörungen und deren Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes.
4 Heimerziehung: Dieses Kapitel definiert die Begriffe „Heim“ und „Heimerziehung“ und gibt einen Überblick über verschiedene Betreuungs- und Wohnformen in der Heimerziehung. Es beleuchtet die rechtlichen Grundlagen und Rahmenbedingungen, die die Arbeit in Heimen prägen. Die Vielseitigkeit und Entwicklung der Heimerziehung in den letzten Jahren bezüglich der Wohnformen wird thematisiert.
5 Bindungsstörungen und Heimerziehung: Kapitel 5 analysiert die Rolle der Erzieher in der Arbeit mit bindungsgestörten Kindern und Jugendlichen. Es untersucht, wie pädagogisches Handeln an die verschiedenen Bindungstypen angepasst werden muss und diskutiert die Korrigierbarkeit innerer Arbeitsmodelle. Der Abschnitt bietet konkrete Handlungsempfehlungen für den Umgang mit bindungsunsicheren und bindungsdesorganisierten Kindern und Jugendlichen, unter Berücksichtigung der Herausforderungen des Heimaltages und der notwendigen Qualifikationen und Kompetenzen der pädagogischen Fachkräfte.
Schlüsselwörter
Bindungstheorie, Bowlby, Bindungsqualität, Bindungsstörung, Heimerziehung, ICD-10-GM, Brisch, innere Arbeitsmodelle, pädagogisches Handeln, Bezugsperson, sichere Bindung, unsicher-vermeidende Bindung, unsicher-ambivalente Bindung, desorganisierte Bindung, Kinder, Jugendliche.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Bindungsstörungen und Heimerziehung
Was ist der Inhalt dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Bindungsstörungen und Heimerziehung. Sie beleuchtet die Herausforderungen der pädagogischen Arbeit mit bindungsunsicheren und desorganisiert-gebundenen Kindern und Jugendlichen in Heimen und entwickelt mögliche Handlungsansätze. Die Arbeit umfasst die Bindungstheorie nach Bowlby, die Klassifizierung und Diagnostik von Bindungsstörungen, die rechtlichen Grundlagen der Heimerziehung und pädagogische Handlungsansätze für den Umgang mit verschiedenen Bindungstypen.
Welche Bindungstheorien werden behandelt?
Die Arbeit basiert hauptsächlich auf der Bindungstheorie von John Bowlby. Sie erklärt die Konzepte von Bindung, Bindungsverhalten, sicherer Basis, Bindungsentwicklung und dem inneren Arbeitsmodell. Die verschiedenen Bindungsqualitäten (sicher, unsicher-vermeidend, unsicher-ambivalent, desorganisiert/desorientiert) werden detailliert beschrieben und deren Auswirkungen auf das kindliche Verhalten und die Beziehungen im Laufe des Lebens erläutert.
Wie werden Bindungsstörungen klassifiziert und diagnostiziert?
Die Arbeit beschreibt die Klassifizierung von Bindungsstörungen anhand des ICD-10-GM. Da diese Klassifizierung als zu allgemein erachtet wird, wird die detailliertere Diagnostik und Typologie von Bindungsstörungen nach Karl-Heinz Brisch genauer betrachtet. Dies ermöglicht ein vertieftes Verständnis der verschiedenen Ausprägungen von Bindungsstörungen und deren Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes.
Welche Aspekte der Heimerziehung werden behandelt?
Die Arbeit definiert die Begriffe „Heim“ und „Heimerziehung“ und gibt einen Überblick über verschiedene Betreuungs- und Wohnformen. Sie beleuchtet die rechtlichen Grundlagen und Rahmenbedingungen der Heimerziehung und thematisiert die Vielseitigkeit und Entwicklung der Heimerziehung in den letzten Jahren bezüglich der Wohnformen.
Welche Rolle spielen Erzieher in der Arbeit mit bindungsgestörten Kindern?
Die Arbeit analysiert die Rolle der Erzieher in der Arbeit mit bindungsgestörten Kindern und Jugendlichen. Sie untersucht, wie pädagogisches Handeln an die verschiedenen Bindungstypen angepasst werden muss und diskutiert die Korrigierbarkeit innerer Arbeitsmodelle. Konkrete Handlungsempfehlungen für den Umgang mit bindungsunsicheren und bindungsdesorganisierten Kindern und Jugendlichen werden gegeben, unter Berücksichtigung der Herausforderungen des Heimaltages und der notwendigen Qualifikationen und Kompetenzen der pädagogischen Fachkräfte.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bindungstheorie, Bowlby, Bindungsqualität, Bindungsstörung, Heimerziehung, ICD-10-GM, Brisch, innere Arbeitsmodelle, pädagogisches Handeln, Bezugsperson, sichere Bindung, unsicher-vermeidende Bindung, unsicher-ambivalente Bindung, desorganisierte Bindung, Kinder, Jugendliche.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Bindungstheoretische Grundlagen, Bindungsstörungen, Heimerziehung, Bindungsstörungen und Heimerziehung, Fazit.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Herausforderungen der pädagogischen Arbeit mit bindungsunsicheren und desorganisiert-gebundenen Kindern und Jugendlichen in Heimen zu beleuchten und mögliche Handlungsansätze zu entwickeln.
- Quote paper
- Rebecca Romana Schaus (Author), 2014, Bindungsstörung und Heimerziehung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/287535