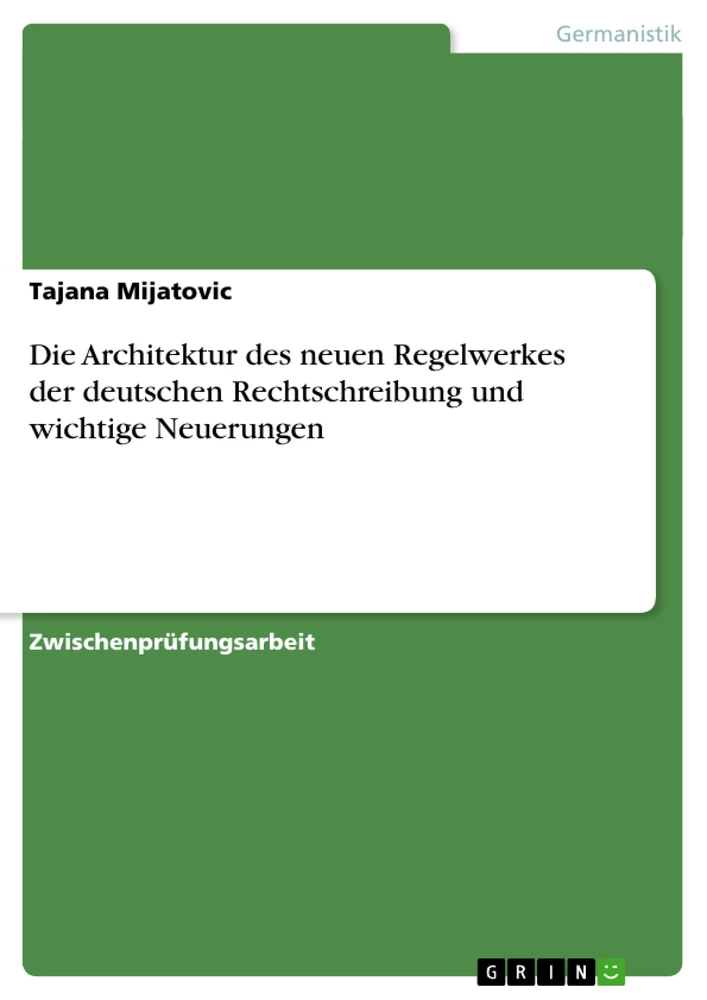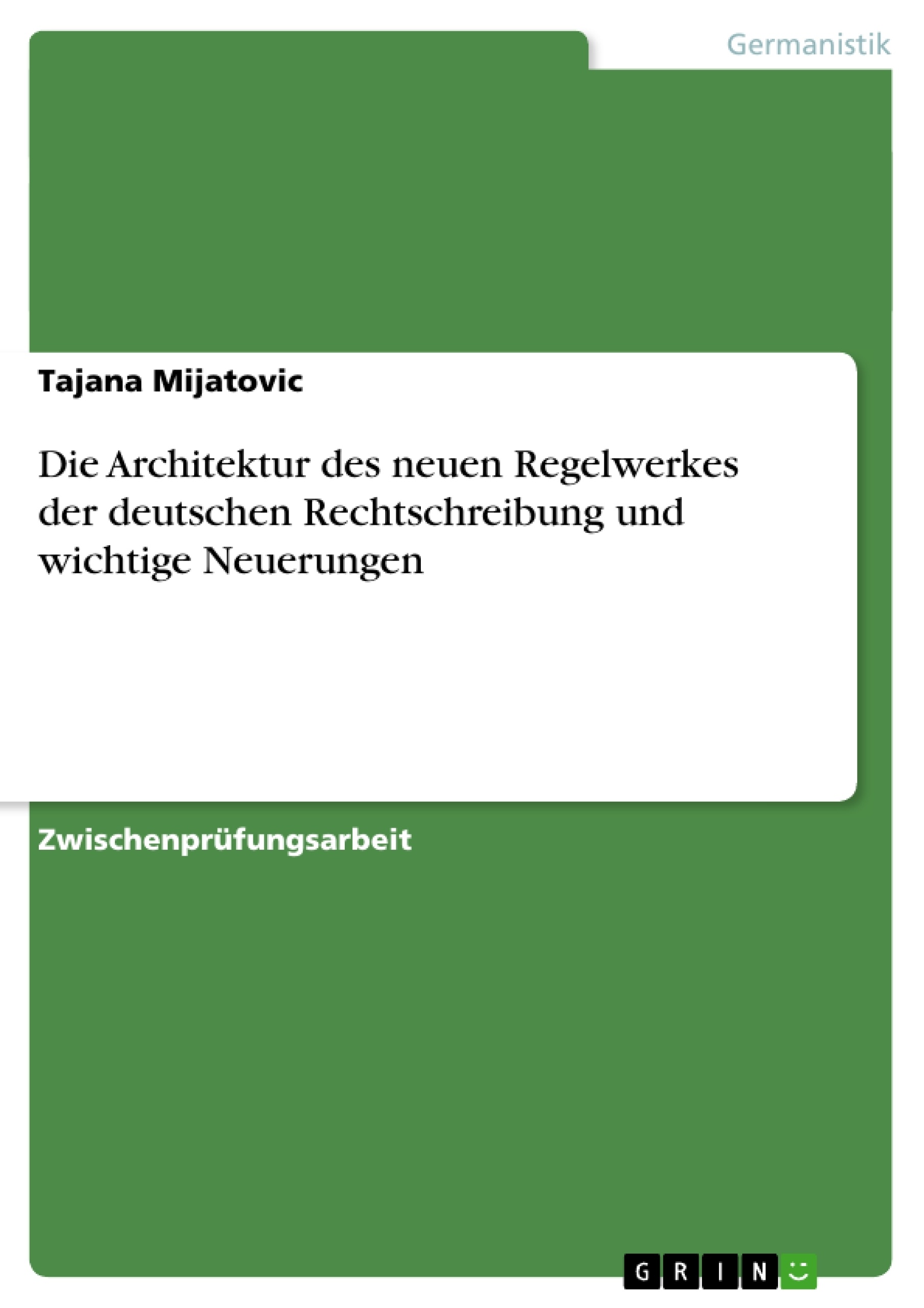1901 fand die II. Orthographische Konferenz auf Einladung der damaligen Reichsregierung
in Berlin statt, welche für die Validität der bisherigen Rechtschreibregelung
verantwortlich war. Ihr Ziel war es eine einheitliche deutsche Orthographie für das
deutsche Reich zu schaffen. Man einigte sich auf einen einheitlichen Regeltext, der
jedoch nur wenige inhaltliche Änderungen gegenüber der vorher angewandten Schreibung
beinhaltete. Die wichtigsten Änderungen waren die Abschaffung des Konsonanten
h nach t als Merkmal der Vokallänge in Wörtern (vorher z.B.: Thal, Thräne,
Thugend) und die Ersetzung des c durch k oder z ent-sprechend der Aussprache
(vorher z.B.: Cultur, Candidat, Medicin, Officier).
Sowohl die Getrennt- und Zusammenschreibung, als auch die Interpunktion berücksichtigte
die Regelung nicht. Das von der Konferenz beschlossene Regelwerk wurde
schließlich von Österreich, später auch von der Schweiz und den jeweiligen deutschen
Bundesländern für Schulen und Behörden erlassen.
Seit jener festgesetzten Norm hat es keine offizielle Änderung mehr gegeben, trotz
Kritiken beispielsweise seitens Konrad Duden:“Daß die so enstandene deutsche
Recht-schreibung weit davon entfernt ist, ein Meisterwerk zu sein, das weiß niemand
besser, als wer daran mitzuarbeiten berufen war.“1 Die nun offizielle
Rechtschreibregelung wurde von Konrad Duden in der 7. Auflage seines
„Orthographischen Wörterbuches der deutschen Sprache“ (1902) übertragen, womit es
ihrer Verbreitung nachhalf. Da die möglichen Schreibungsvarianten in seinem
Nachschlagewerk sehr vielfältig waren, baten die Buchdruckereiverbände
Deutschlands, Österreichs und der Schweiz Konrad Duden ein Wörterbuch zu
erstellen, in dem er sich möglichst auf nur eine Schreibungs-variante beschränken
sollte. Somit entstand der sogenannte „Buchdruckerduden“ (1. Auflage 1903, 2.
Auflage 1907), in dem man sich auf nur eine Schreibungsmöglichkeit spezialisierte. [...]
1Konrad Duden, Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Leipzig und Wien, 1902, S. 4
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Der Enstehungsverlauf der deutschen Rechtschreibreform
- 1.1.1 Die einheitliche deutsche Rechtschreibung und ihre Veränderungsbemühungen
- 1.1.2 Beschluss der Rechtschreibreform
- 2. Hauptteil
- 2.1 Laut-Buchstaben-Zuordnungen
- 2.1.1 Die s-Schreibung
- 2.1.2 Das Zusammentreffen von drei gleichen Buchstaben
- 2.1.3 Verdopplung von Konsonanten nach kurzem Vokal
- 2.1.4 Die Umlautschreibung/Einzelfälle
- 2.1.5 Sonstige Einzelfälle
- 2.1.6 Fremdwörter
- 2.2 Groß- und Kleinschreibung
- 2.2.1 Der Satzanfang
- 2.2.2 Das Anredepronomen
- 2.2.3 Eigennamen und feste Begriffe
- 2.2.4 Substantive und Substantivierungen
- 2.3 Getrennt- und Zusammenschreibung
- 2.4 Zeichensetzung
- 2.5 Worttrennung am Zeilenende
- 3. Schlussteil
- 3.1 Die öffentliche Diskussion um die Rechtschreibreform
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Entstehungsprozess der deutschen Rechtschreibreform und erläutert die wichtigsten Neuerungen des neuen Regelwerks. Der Fokus liegt auf der Darstellung des historischen Kontextes, der verschiedenen Reformbemühungen und der finalen Implementierung der neuen Rechtschreibung.
- Der historische Verlauf der deutschen Rechtschreibreform
- Die wichtigsten Änderungen in der Laut-Buchstaben-Zuordnung
- Die Neuerungen in der Groß- und Kleinschreibung
- Die Anpassungen bei der Getrennt- und Zusammenschreibung
- Die öffentliche Diskussion und die Kontroversen um die Reform
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der deutschen Rechtschreibreform ein und gibt einen Überblick über die Struktur der Arbeit. Sie skizziert den langen und komplexen Prozess der Reform, der von frühen Bemühungen um eine einheitliche Rechtschreibung bis zum endgültigen Beschluss reicht. Die Einleitung legt den Grundstein für die detaillierte Analyse der Reform im Hauptteil der Arbeit.
2. Hauptteil: Dieser Teil bildet den Kern der Arbeit und befasst sich eingehend mit den einzelnen Aspekten der neuen Rechtschreibung. Er analysiert die Veränderungen in der Laut-Buchstaben-Zuordnung, die Neuerungen in der Groß- und Kleinschreibung, die Anpassungen bei der Getrennt- und Zusammenschreibung sowie die Regeln der Zeichensetzung und Worttrennung. Der Hauptteil geht detailliert auf die einzelnen Regeln ein und illustriert diese mit Beispielen. Die verschiedenen Unterkapitel bauen aufeinander auf und bieten einen umfassenden Überblick über die Änderungen im Vergleich zur vorherigen Rechtschreibung.
Schlüsselwörter
Deutsche Rechtschreibung, Rechtschreibreform, Orthographie, Laut-Buchstaben-Zuordnung, Groß- und Kleinschreibung, Getrennt- und Zusammenschreibung, Zeichensetzung, Worttrennung, Sprachwissenschaft, Reformgeschichte.
FAQ: Deutsche Rechtschreibreform - Eine umfassende Übersicht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen detaillierten Überblick über die deutsche Rechtschreibreform. Sie beleuchtet den Entstehungsprozess, die wichtigsten Änderungen im Regelwerk und die öffentliche Diskussion um die Reform.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: den historischen Verlauf der Rechtschreibreform, Änderungen in der Laut-Buchstaben-Zuordnung (inkl. s-Schreibung, dreifache Konsonanten, Konsonantenverdopplung, Umlaute und Fremdwörter), die Neuerungen in der Groß- und Kleinschreibung (Satzanfang, Anredepronomen, Eigennamen, Substantive), die Getrennt- und Zusammenschreibung, die Zeichensetzung, die Worttrennung und die öffentliche Diskussion um die Reform.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Einleitung, Hauptteil und Schlussteil. Die Einleitung liefert einen Überblick über den Entstehungsprozess der Reform. Der Hauptteil analysiert die einzelnen Aspekte der neuen Rechtschreibung detailliert. Der Schlussteil befasst sich mit der öffentlichen Diskussion um die Reform.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in ihnen?
Kapitel 1 (Einleitung): Einführung in das Thema und Überblick über den langen und komplexen Prozess der Rechtschreibreform. Kapitel 2 (Hauptteil): Detaillierte Analyse der Änderungen in der Laut-Buchstaben-Zuordnung, Groß- und Kleinschreibung, Getrennt- und Zusammenschreibung, Zeichensetzung und Worttrennung. Kapitel 3 (Schlussteil): Zusammenfassung und Diskussion der öffentlichen Kontroversen um die Rechtschreibreform.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Entstehungsprozess der deutschen Rechtschreibreform und erläutert die wichtigsten Neuerungen. Der Fokus liegt auf dem historischen Kontext, den verschiedenen Reformbemühungen und der finalen Implementierung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Deutsche Rechtschreibung, Rechtschreibreform, Orthographie, Laut-Buchstaben-Zuordnung, Groß- und Kleinschreibung, Getrennt- und Zusammenschreibung, Zeichensetzung, Worttrennung, Sprachwissenschaft, Reformgeschichte.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich für die deutsche Rechtschreibung, ihre Geschichte und die Reform interessieren, insbesondere für Studierende der Sprachwissenschaft und des Deutschunterrichts.
Wo finde ich mehr Informationen?
(Hier könnten weitere Quellen oder Links eingefügt werden)
- Arbeit zitieren
- Tajana Mijatovic (Autor:in), 2004, Die Architektur des neuen Regelwerkes der deutschen Rechtschreibung und wichtige Neuerungen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/28721