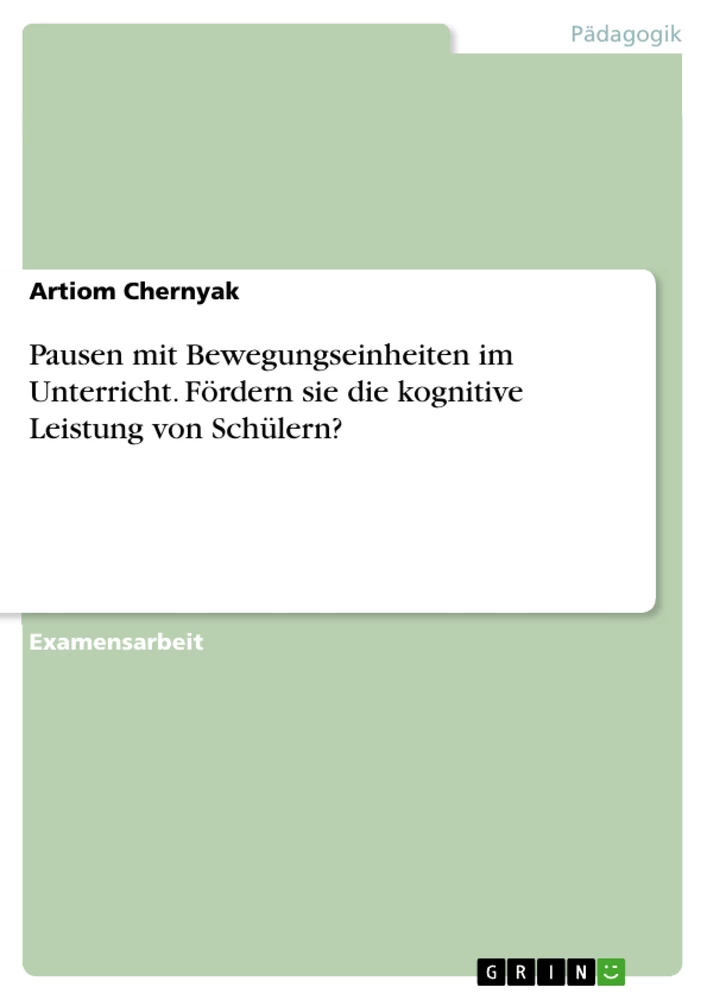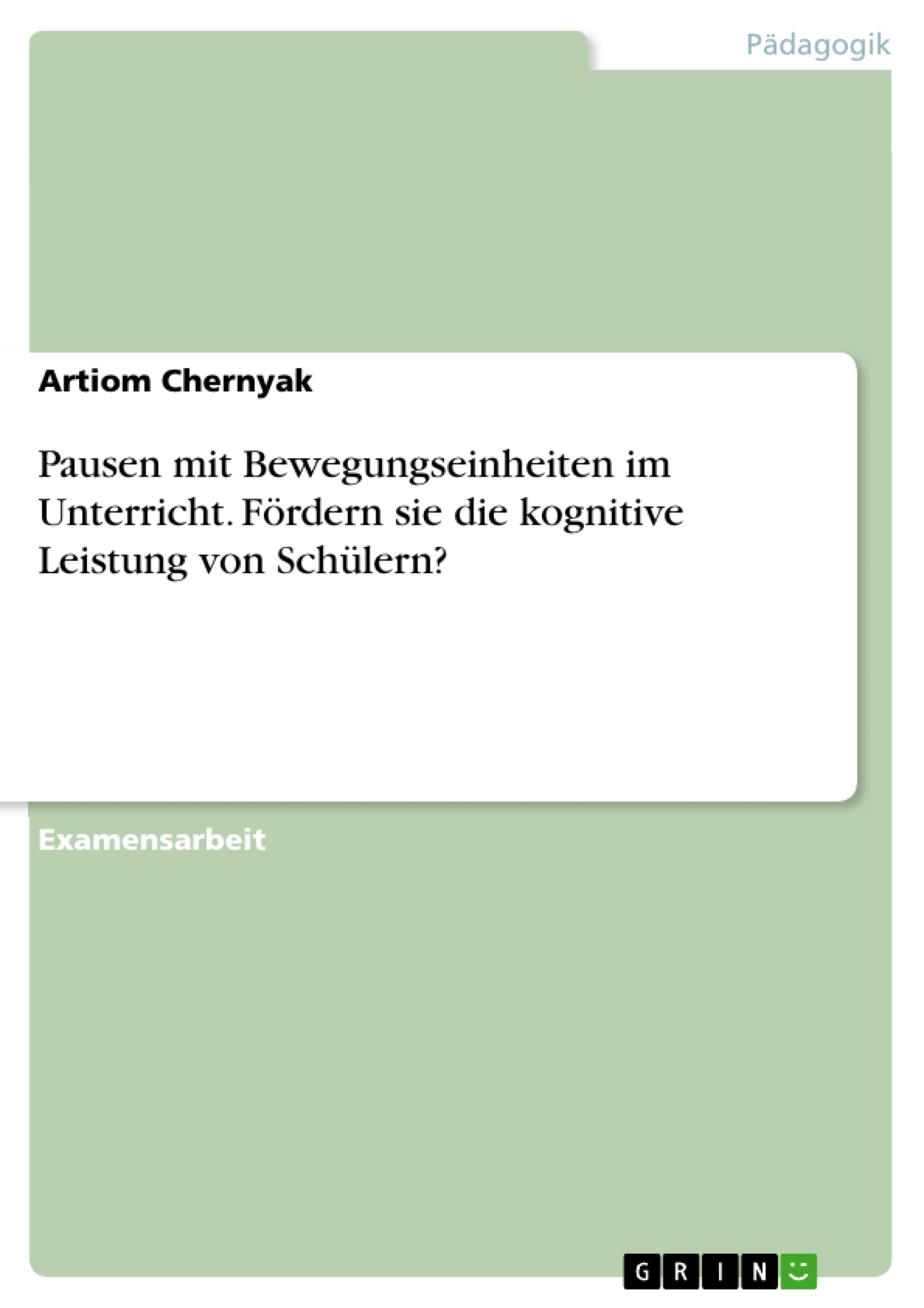Unkonzentrierte Schülerinnen und Schüler im Unterricht sind für viele Lehrerinnen und Lehrer ein bekanntes Problem. Über 87% der Lehrer klagen über wachsende Konzentrationsschwächen, vermehrte Unruhe und Nervosität unter den Schülern.
Auch die Erfahrungen des Verfassers haben gezeigt, dass Unaufmerksamkeit, Unruhe und Lustlosigkeit zu verminderten Leistungen und einer Verschlechterung des Lernklimas führen. Dies stellt für Lehrer, Schüler und Eltern eine relevante Problematik dar. Die
Konfrontation mit dieser Thematik hat zur Auseinandersetzung mit folgender
Fragestellung geführt. Kann Bewegung das Lernen von Schülern im Schulalltag positiv
beeinflussen? Zahlreiche Studien legen diesen Schluss nahe.
Bewegung ist ein wesentlicher Bestandteil eines Menschenlebens und vor allem bei Kindern und
Jugendlichen bedeutsam für die motorische, kognitive und soziale Entwicklung. Das
traditionelle Schulverständnis grenzt die notwendige Bewegung der Kinder jedoch ein und
versucht diese zu unterdrücken. „Bewegung ist etwas, was nicht sein soll, was den
Unterricht stört“. Somit wird die Institution Schule zumeist dem Drang der Schüler nach
Bewegung und Selbsterfahrung des Körpers nicht gerecht.
Bereits seit Anfang der 90er Jahre erfährt diese Thematik eine zunehmend breite
schulpädagogische und bildungspolitische Aufmerksamkeit im Rahmen des Begriffs
„Bewegte Schule“.
Zunehmend wird dieser Begriff in die Tat umgesetzt,
indem immer mehr Schulen versuchen, mehr Bewegung in den Schulalltag zu integrieren
und somit den körperlichen und emotionalen Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden.
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einem Teilaspekt des Konzepts „Bewegte Schule“,
der Bewegungspause im Unterricht. Da die Konzentration der Schüler im Verlauf eines
Schultages Schwankungen unterliegt, entstand die Motivation die Bewegungspause im
„Nicht-Sport“-Unterricht zur Anwendung zu bringen und im Rahmen der vorliegenden
Arbeit zu evaluieren und auszuwerten. Anhand einer Versuchsreihe soll untersucht
werden, ob und inwieweit eine Bewegungspause während der Unterrichtszeit die
kognitive Leistungsfähigkeit der Schüler verbessern kann. Zur Anwendung kommen zwei
unterschiedliche Arten der Bewegungspause, welche entweder den Schwerpunkt auf die Aktivierung des Herz-Kreislauf-Systems oder die Koordination legen und miteinander verglichen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Didaktische Analyse
- 2.1. Begründung der Arbeit
- 2.2. Zielsetzung
- 3. Theoretische Grundlagen
- 3.1. „Bewegte Schule“
- 3.2. Die Bewegungspause als Baustein der „Bewegten Schule“
- 3.3. Zusammenhang zwischen motorischer Aktivität und kognitiver Leistungssteigerung
- 4. Versuchsgruppenanalyse
- 5. Konkretisierte Darstellung der Versuchsreihe
- 5.1. Angewendete Bewegungspausen
- 5.1.1. Bewegungsgeschichte „Riese, Mensch, Zwerg“
- 5.1.2. Bewegungspause „Spiegelbild“
- 5.2. Methodik
- 5.3. Durchführung der d2-Tests
- 5.1. Angewendete Bewegungspausen
- 6. Auswertung
- 6.1. Reflexion der Bewegungspausen
- 6.1.1. Bewegungsgeschichte „Riese, Mensch, Zwerg“
- 6.1.2. Bewegungspause „Spiegelbild“
- 6.2. Testergebnisse
- 6.2.1. Bewegungsgeschichte „Riese, Mensch, Zwerg“
- 6.2.2. Bewegungspause „Spiegelbild“
- 6.3. Interpretation der Testergebnisse
- 6.1. Reflexion der Bewegungspausen
- 7. Fazit und Ausblick
- 8. Literaturverzeichnis
- 9. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss von Bewegungspausen im Unterricht auf die kognitive Leistungsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern. Ziel ist es, die Effektivität von Bewegungspausen als Maßnahme zur Verbesserung der Konzentration und Lernmotivation zu evaluieren.
- Der Zusammenhang zwischen Bewegung und kognitiver Leistung
- Die „Bewegte Schule“ als pädagogisches Konzept
- Die Rolle von Bewegungspausen im Schulalltag
- Die Gestaltung und Durchführung von Bewegungspausen
- Die Auswertung der Ergebnisse einer Versuchsreihe
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Problem von Konzentrationsschwächen und Unruhe im Unterricht dar und leitet die Forschungsfrage nach dem Einfluss von Bewegung auf das Lernen ab. Kapitel 2 analysiert die didaktische Relevanz der Thematik und definiert die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel 3 beleuchtet die theoretischen Grundlagen, insbesondere das Konzept der „Bewegten Schule“ und den wissenschaftlichen Nachweis des Zusammenhangs zwischen Bewegung und kognitiver Leistung. Kapitel 4 beschreibt die Versuchsgruppen und die Methodik der Untersuchung. Kapitel 5 erläutert die konkreten Bewegungspausen, die in der Versuchsreihe eingesetzt wurden, sowie die Durchführung der d2-Tests. Kapitel 6 analysiert die Ergebnisse der Tests und reflektiert die Effektivität der Bewegungspausen. Das Fazit und der Ausblick fassen die Ergebnisse zusammen und skizzieren mögliche zukünftige Forschungsansätze.
Schlüsselwörter
Bewegungspausen, kognitive Leistungsfähigkeit, Konzentration, Lernmotivation, „Bewegte Schule“, motorische Aktivität, Unterrichtsgestaltung, d2-Test, Versuchsreihe.
- Quote paper
- Artiom Chernyak (Author), 2012, Pausen mit Bewegungseinheiten im Unterricht. Fördern sie die kognitive Leistung von Schülern?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/287040