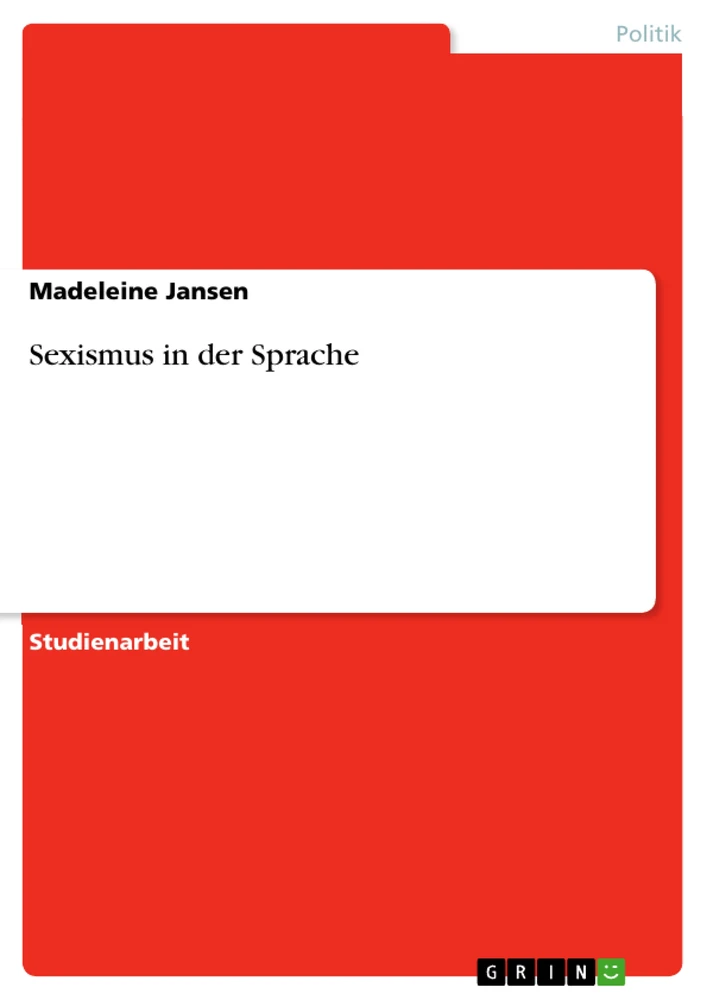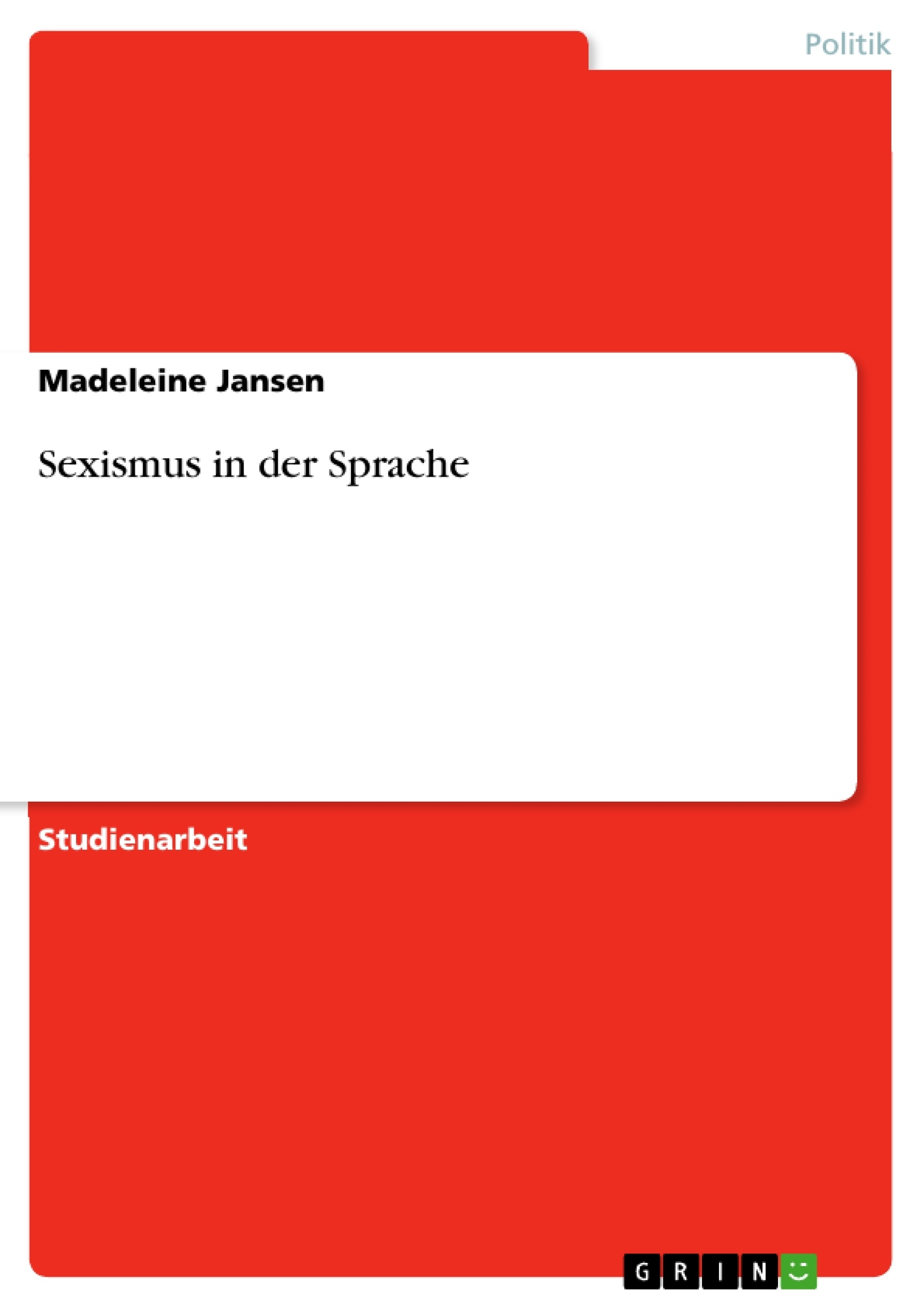„Sie können ein Dirndl auch ausfüllen.“ Dieser Satz erscheint als Einleitung für eine wissenschaftliche Hausarbeit zunächst einmal befremdlich. Tatsächlich handelt es sich um ein Zitat, das Anfang letzten Jahres in Deutschland eine Debatte ungeahnten Ausmaßes ausgelöst hat. Die Rede ist von der sogenannten „Sexismus-Debatte“, entfacht durch den Stern-Artikel „Der Herrenwitz“ der Journalistin Laura Himmelreich, in dem es ursprünglich darum ging, den damaligen Spitzenkandidaten der FDP Rainer Brüderle anlässlich der Bundestagswahl zu porträtieren. Plötzlich waren jedoch alle Augen auf diese eine Aussage des Politikers gerichtet und niemand interessierte sich mehr für das Porträt. Stattdessen folgten wochenlange Diskussionen in Fernseh-Talkshows, im Radio und Online-Plattformen, wobei besonders der Hashtag #aufschrei auf Twitter großes Aufsehen erregte und sogar mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet wurde.
Angesichts der Tatsache, dass es Sexismus schon immer gibt, ein recht später Aufschrei. Haben wir uns einfach schon zu sehr daran gewöhnt, uns blöde Sprüche auf Kosten von Geschlechterdifferenzen anhören zu müssen? Ist es uns egal oder trauen wir uns nur schlichtweg nicht, uns zu wehren? Fragen über Fragen, von denen viele im Rahmen der Forschung beantwortet werden konnten. Insbesondere Sexismus ist ein sehr interessantes, aber auch umfangreiches Gebiet, sodass das Hauptaugenmerk der folgenden Hausarbeit auf dem konkreten Thema „Sexismus in der Sprache“ liegt. Dabei soll es nicht um Beschimpfungen oder wenig durchdachte Äußerungen wie die von Rainer Brüderle gehen. Vielmehr besteht das Ziel darin, sprachlichen Sexismus auf einer strukturellen Ebene zu betrachten, wobei vor allem das weibliche Geschlecht als „Empfänger(in)“ dieser Form der Diskriminierung im Vordergrund steht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen des Begriffs „Sexismus“
- Sexismus in der Sprache
- Begriffsdefinition und Erscheinungsformen
- Bereiche sexistischer Sprachverwendung
- Feministische Sprachpolitik
- Abschließende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Thema „Sexismus in der Sprache“, insbesondere mit der strukturellen Ebene der Diskriminierung, die sich im Sprachgebrauch zeigt. Der Fokus liegt auf der Betrachtung der Auswirkungen auf das weibliche Geschlecht. Die Arbeit untersucht verschiedene Definitionen von Sexismus und beleuchtet die vielfältigen Formen sexistischer Sprachverwendung, die zu einer Degradierung von Frauen führen können.
- Definitionen von Sexismus
- Sexismus in der Sprache als Form der Diskriminierung
- Erscheinungsformen von sprachlichem Sexismus
- Strukturelle sprachliche Gewalt und das Generische Maskulinum
- Feministische Sprachpolitik und Alternativen zur männlichen Sprachform
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik „Sexismus in der Sprache“ ein und beleuchtet die aktuelle Debatte um Sexismus im Kontext des Politikers Rainer Brüderle. Sie unterstreicht die Bedeutung des Themas und fokussiert auf die strukturelle Ebene sprachlichen Sexismus, der das weibliche Geschlecht diskriminiert.
Das zweite Kapitel widmet sich verschiedenen Definitionen des Begriffs „Sexismus“, die unterschiedliche Perspektiven auf die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts aufzeigen. Die Analyse beleuchtet sowohl den traditionellen Ansatz des Duden als auch feministische Definitionen, die auf die gesellschaftliche Konstruktion von Geschlechterrollen und die damit verbundenen Diskriminierungsmechanismen hinweisen.
Kapitel drei konzentriert sich auf den sprachlichen Sexismus, der in verschiedenen Formen im alltäglichen Sprachgebrauch vorkommt. Die Analyse untersucht die Auswirkungen dieser Sprachformen auf Frauen und beleuchtet den engen Zusammenhang zwischen sprachlichem Sexismus und sprachlicher Gewalt. Das Kapitel stellt verschiedene Formen von sprachlicher Gewalt vor und untersucht, wie sie zur Perpetuierung von Machtstrukturen zwischen den Geschlechtern beitragen.
Im vierten Kapitel wird das generische Maskulinum als Beispiel für strukturelle sprachliche Gewalt analysiert. Die Diskussion beleuchtet die Kritik an dieser Sprachform und die Auswirkungen auf die Sichtbarkeit und Repräsentation von Frauen in der Sprache. Das Kapitel untersucht verschiedene Alternativen zum generischen Maskulinum, um Diskriminierung durch sprachliche Strukturen zu vermeiden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Sexismus, Sprachliche Diskriminierung, Geschlechterverhältnisse, Sprachliche Gewalt, Generisches Maskulinum, Feministische Sprachpolitik, und Alternativen zur männlichen Sprachform. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich die Sprache als Werkzeug der Diskriminierung und Machtausübung einsetzt und wie man diese Strukturen durch sprachliche Veränderungen beeinflussen kann.
- Quote paper
- Madeleine Jansen (Author), 2014, Sexismus in der Sprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/286801