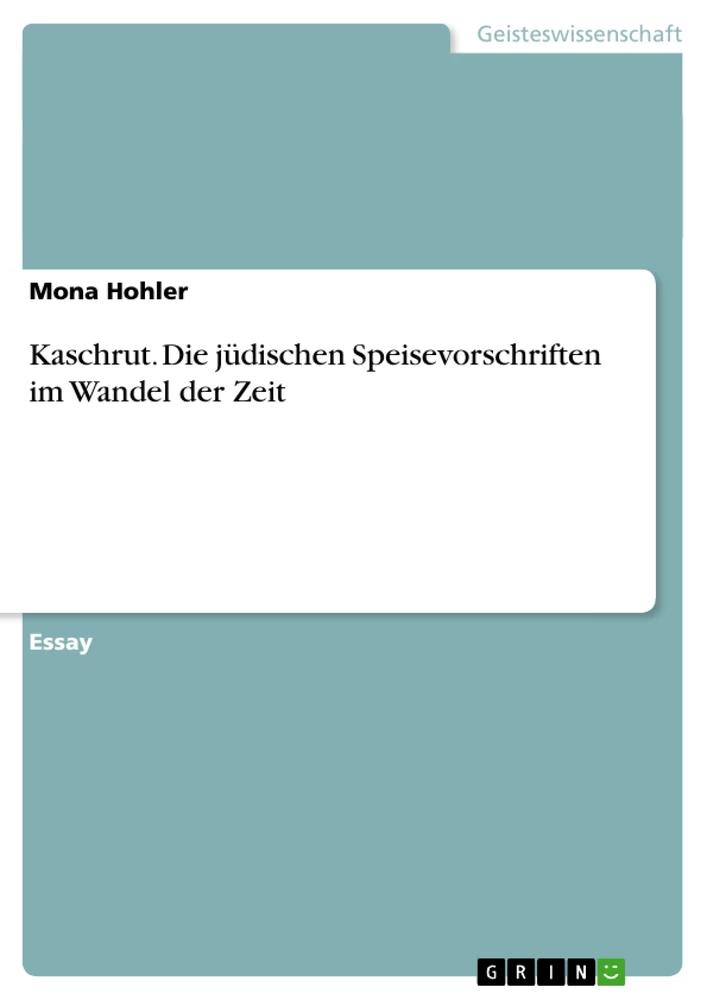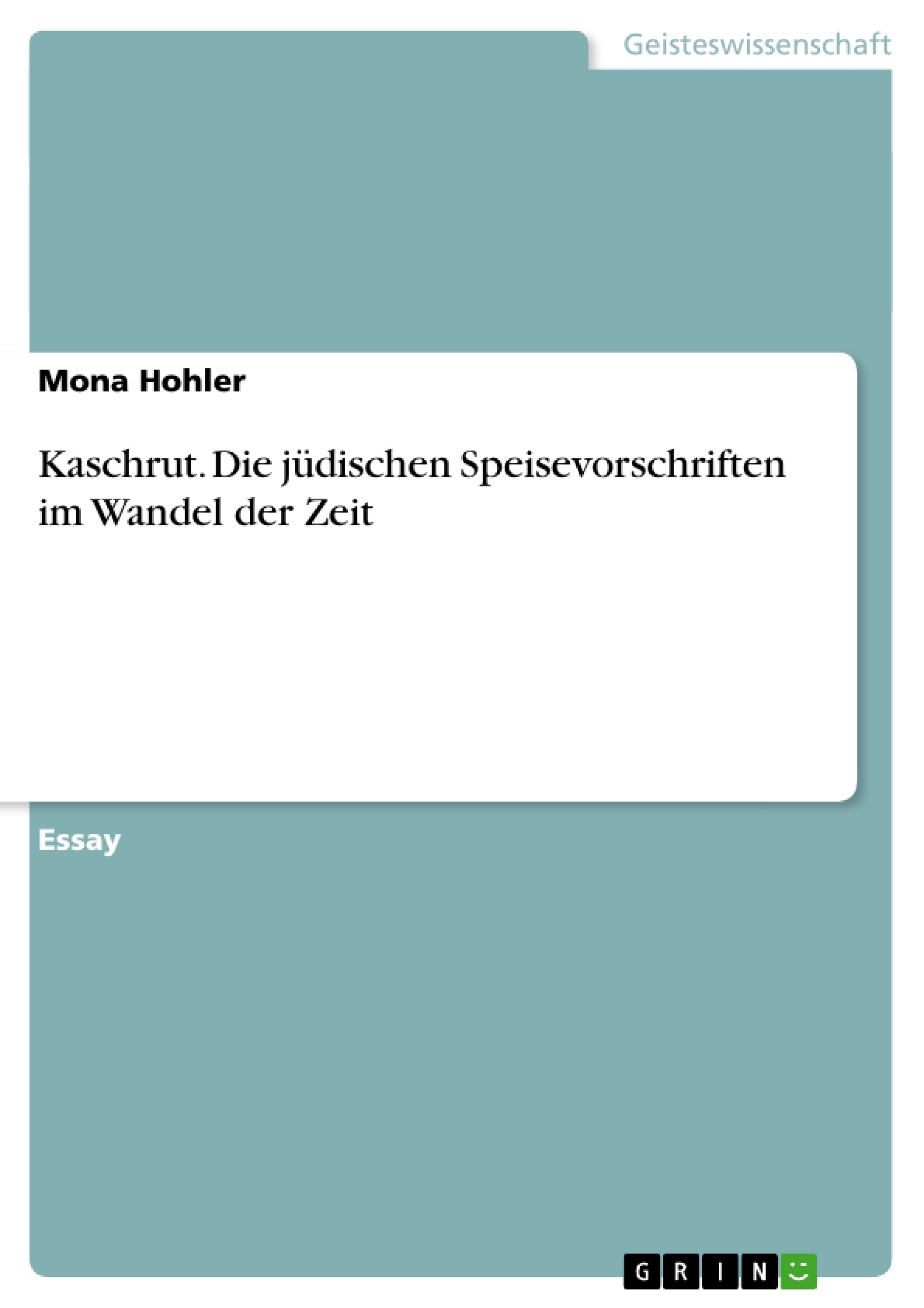Im Folgenden soll ein Blick auf die biblische Grundlage der Kaschrut geworfen und die zentralen Themen der weiteren Diskussion des Talmud dargestellt werden. Dabei steht vor allem die Bedeutung der Speisegesetze für das jüdische Selbstverständnis im Fokus. Zum Schluss sollen noch
einige aktuelle Fragestellungen beleuchtet und in einem Resümee die Chancen der Kaschrut
zusammengefasst werden.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Wurzeln der Kaschrut: Speisevorschriften im Pentateuch
3. Der Baum wächst: Kaschrutfragen im talmudischen Diskurs
4. Neue Früchte: Aktuelle Fragestellungen rund um die Kaschrut
5. Resümee
Fußnoten und Literaturverzeichnis
Einleitung
Was hat Essen mit der Hingabe für den einen G'tt zu tun? Warum haben Juden so viele Vorschriften rund um dieses säkulare Thema und halten bis heute strenge Speisevorschriften ein? Ist die Kaschrut nicht überkommen und für heutige Zeiten belanglos? Diese und ähnliche Fragen werden immer wieder gestellt. Bei der Beantwortung derselben wird in religiösen Kreisen oft auf ein Bild zurück gegriffen, welches die Rabbinen für die Torah benutzt haben: Für Juden ist sie ist der Etz Chajim - der Baum des Lebens. Ohne sie würde das jüdische Volk nicht länger existieren. Ihr Stamm wächst stetig in Form der Tradition, doch teilen alle Früchte die selbe DNA. Die Kaschrutvorschriften haben sich über Jahrtausende hinweg entwickelt und sind bis heute im ständigen Wandel, doch speisen sie alle aus der selben Quelle, nämlich den fünf Büchern Moses.
Im Folgenden soll ein Blick auf die biblische Grundlage der Kaschrut geworfen und die zentralen Themen der weiteren Diskussion des Talmud dargestellt werden. Dabei steht vor allem die Bedeutung der Speisegesetze für das jüdische Selbstverständnis im Fokus. Zum Schluss sollen noch einige aktuelle Fragestellungen beleuchtet und in einem Resümee die Chancen der Kaschrut zusammengefasst werden.
Die Wurzeln der Kaschrut: Speisevorschriften im Pentateuch
In der Torah wird das Thema der Kaschrut nicht komprimiert in einem Block abgehandelt. Vielmehr stößt man in allen fünf Büchern Moses auf einzelne Aussagen, die teils in ganz verschiedenen Zusammenhängen stehen und jeweils andere Aspekte behandeln, wobei manche Gebote auch mehrmals vorkommen. Grob gesagt befasst sich die Torah dabei mit folgenden Punkten: Die zum Verzehr geeigneten Tierarten1, ihre Schlachtung und Zubereitung, dabei vor allem die verbotenen Tierteile2. Weiterhin mit verbotenen Mischungen sowie Kreuzungen3 und Gesetzen rund um Ernte, Erstlinge sowie Opfergaben für den Tempel 4.
Nur an wenigen Stellen wird ausdrücklich gesagt, warum etwas Bestimmtes verboten beziehungsweise geboten wird: Ein solcher Fall ist der Genuss von Blut, der verboten ist, da er „das Leben“ enthalte (u.a. Gen.9:4). Daneben gibt es noch einige Edut, die an Ereignisse der jüdischen Geschichte erinnern, so beispielsweise das Verbot der Spannader wegen des Kampfes Jaakovs mit dem Malach (Gen.32:25-33) oder das Gebot, an Pessach Ungesäuertes zu essen aufgrund des hastigen Auszuges der Jisraeliten aus Ägypten (Ex.12:14-15).
Auch der formulierte Grundgedanke der Kaschrut steht dabei im Zusammenhang mit dem Exodus: כי אני יהוה אלהיכם והתקדשתם והייתם קדשים כי קדוש אני ולא תטמאו את־נפשתיכם בכל־השרץ הרמש על־ הארץ׃ מארץ מצרים להית לכם לאלהים והייתם קדשים כי קדוש אני׃ זאת תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה כי אני יהוה המעלה אתכם להבדיל בין הטמא ובין הטהר ובין החיה הרמשת במים ולכל־נפש השרצת על־הארץ׃ הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל׃
Denn Ich bin der Ew-ge, euer G'tt, demnach heiliget euch, auf dass ihr heilig seid, denn heilig bin Ich. Und verunreiniget nicht eure Seelen durch all das Getier, welches kriecht auf der Erde. Denn Ich bin der Ew-ge, der Ich euch heraufgeführt habe aus dem Lande Ä gypten, um euer G'tt zu sein - deshalb sollt ihr heilig sein, denn heilig bin Ich. Dies ist die Lehre vom Vieh, Geflügel und allem Lebendigen, das sich regt im Wasser und das wimmelt auf der Erde. Zu unterscheiden zwischen dem Unreinen und dem Reinen, und zwischen dem Getier, welches gegessen werden darf und dem Getier, welches nicht gegessen werden soll. (Lev.11:44-47)
Hier wird die der Einhaltung der Kaschrut als eine Art Gegenleistung für die Errettung des Volkes aus der ägyptischen Sklaverei dargestellt - da G'tt heilig ist und Sich das Volk als Sein Eigentum annahm, muss auch dieses nun einen Status der Heiligkeit anstreben, unter anderem durch die Einhaltung der Speisegesetze. Weiterhin tritt der Anspruch auf Heiligkeit unter anderem bei dem Schabbatgebot sowie den Gesetzen zur Sexualmoral auf.5
Das hebräische Wort für heilig kadosch, besitzt zwei Konotationen: Z um eine n lässt es sichקדושDas hebräische Wort für heilig, mit heilig als Gegensatz zum Profanen wiedergeben, zum anderen bedeutet es wörtlich gesegen absondern. Alle Gesetze zur Heilighaltung spiegeln dabei diesen Dualismus wider: Die Jisraeliten werden aufgerufen, das Reine vom Unreinen zu trennen, den Schabbat von den sechs Werktagen, die erlaubten Beziehungen von den Geächteten. Damit wird Ersterem ein gesonderter Platz mit definierten Grenzen eingeräumt, der es zu etwas Besonderem macht, etwas Heiligem.
Die bewusste Entscheidung gegen das Verbotene und der damit verbundene Verzicht demonstrieren somit den freien Willen des Menschen, weisen jedoch gleichzeitig auf seine damit einhergehende Verantwortung hin. Das Beharren auf dem Erlaubten formuliert demnach eine spezifische Identität, die sich durch ihren festen Rahmen kennzeichnet. Über die Einhaltung der Kaschrut verortet sich ein gläubiger Jude im Wertesystem seiner Tradition und weist sich dabei als bewusstes Mitglied der jüdischen Religionsgemeinschaft aus.
Um jedoch die teils sehr vage formulierten Speisevorschriften der Torah verstehen und im alltäglichen Leben umsetzen zu können, braucht es weitere Erklärungen, die sich in der Torah sche'be al peh, der Mündlichen Torah, finden. Eine erste umfassende Kodifizierung derselben bildet die Mischna, die bis zum sechsten Jahrhundert im Babylonischen Talmud weiter diskutiert und entwickelt wurde.
Der Baum wächst: Kaschrutfragen im talmudischen Diskurs
Die Lebensbedingungen der Jisraeliten haben sich drastisch verändert: Statt im verheißenen Land den Schatten des eigenen Feigenbaumes zu genießen, findet sich ein Großteil der Juden zur Zeit des Talmud in der Diaspora wieder. Die Eroberung Jerusalems durch die Römer im Jahre 70 n.Z. brachte die Zerstörung des Heiligen Tempels mit sich, der gescheiterte Bar-Kochba-Aufstand 55 Jahre später läutete das Ende des Reiches Juda und damit die Zeit des Exils ein.
Der Talmud handelt in sechs Ordnungen, aufgeteilt nach Themenblöcken, die halachischen (religionsgesetzlichen) Bestimmungen zur Torah ab. Gesetze zur Kaschrut finden sich vor allem in den Ordnungen Seraim (Saaten), Kodaschim (Heiligtümer) sowie Taharot (Reinheiten).6
Hierbei lassen sich drei Grundtendenzen ausmachen: Zum einen die massive Ausweitung sowie Verschärfung der Torahgesetze für den profanen Genuss, eine weiterhin breite Abhandlung der Themen Reinheit, Tempelabgaben sowie Opfergesetze, obwohl diese größtenteils nur noch von theoretischem Interesse sind, sowie die starke Forderung nach Abgrenzung zu Nichtjuden. Daneben treten im rabbinischen Diskurs aber auch ganz neue Aspekte rund um das Essen auf: So wird der Frage nachgegangen, welche Personen überhaupt für die Schlachtung und Essenszubereitung geeignet seien, wobei der Status von Frauen, Behinderten und Nichtjuden im Vordergrund steht.7
Die Reinheitsbestimmungen für Koch- und Aufbewahrungsgefäße werden ausgeweitet und intensiviert, besonders im Hinblick auf die Trennung von Milch und Fleisch.8 Vor dem Essen muss man sich nun rituell die Hände waschen9 und die jeweils passenden Segenssprüche über die Speisen rezitieren. Dabei wird unterschieden zwischen Baum- und Erdfrüchten, Getreideprodukten, Brot, Wein sowie den restlichen Nahrungsmitteln. Wer was am Tisch essen darf und aus welchen Gefäßen wird genau definiert und viele Einzelsituationen abgehandelt. Nach der Mahlzeit gilt es, das Tischgebet zu verrichten, welches nachträglich sogar den Status eines mosaischen Gesetzes erhält.10 Des Weiteren wird das Arbeitsverbot für Schabbat und Feiertage im Hinblick auf die Essenszubereitung behandelt und dabei präzise bestimmt, in welcher Form beispielsweise Küchengeräte zur Herrichtung sowie Erwärmung der Speisen benutzt werden dürfen.11
Insgesamt wird der Kaschrut damit ein deutlich größeres und bedeutenderes Feld im religiösen Leben eingeräumt, wobei sich der primäre Sinn der Speisevorschriften verschiebt: Die geforderte Heiligung als ein wesentliches Element in der Beziehung zu G'tt tritt bei den talmudischen Diskussionen in den Hintergrund, dafür werden der Abgrenzungsgedanke gegenüber den anderen Völkern sowie das Bewahren einer eigenen Identität zum Hauptthema. Bildete im eigenen Staat der Tempeldienst das religiöse wie geistige und politische Zentrum der Jisraeliten, so galt es im Exil, sich konzeptuell neu aufzustellen. Die Opferungen wurden durch Gebete ersetzt, die Torahrollen zur „portablen Heimat“12 erhoben, ihr Studium und Diskurs zum Mittelpunkt jüdischen Lebens, die Einhaltung des Schabbat sowie der Kaschrut zum kulturellen Schutzschild gegen die drohende Assimilation.
Somit demonstriert die Weiterentwicklung des Mosaischen Gesetzes in der Mündlichen Tradition eindrücklich sowohl die Anpassungsfähigkeit, als auch die starke eigene Identität des Judentums. Sich den Umständen von Zeit und Umgebung nicht zu verschließen und gleichzeitig die hohen Anforderungen der Tradition zu erfüllen - diese Ambivalenz prägte und prägt bis heute die innerjüdische Debatte um Kaschrut.
Neue Früchte: Aktuelle Fragestellungen rund um die Kaschrut
Gerade das 20.Jahrhundert mit seiner Flut an Neuerungen im Bereich der Nahrungsmittelherstellung stellte die jüdische Welt vor neue Fragen und entfachte zum Teil hitzige Diskussionen, die bis heute anhalten. Die moderne Massenproduktion mit ihren komplexen wie kaum durchschaubaren Erzeugungs- und Handelsketten sowie die Fülle von chemischen Stoffen, die mittlerweile zum Einsatz kommen, stellen die Kaschrut vor neue Herausforderungen, die es zu bearbeiten gilt.
Die bis ins Detail ermöglichte Nachforschung über Ingedienten sowie Herstellungsverfahren eines Produktes bringen einerseits größtmögliche Absicherung, andererseits jedoch auch neue Erschwerungen mit sich: Gilt im Talmud noch der Grundsatz, dass ein unkoscherer Bestandteil einer Speise, wenn er unabsichtlich hinein geraten ist und weniger als 1/60 des Gesamten ausmacht (beispielsweise ein Tropfen Milch in einer fleischigen Suppe), für nichtig erklärt und damit das Gericht weiterhin als koscher erachtet wird, so lässt man in orthodoxen Kreisen heute sogar Medikamente, Zahnpasten, Spülmittel und Verpackungen auf verbotenene Substanzen hin überprüfen und im Zweifelsfall als trefe (unkoscher) einstufen. Besonders weit gehen diese Vorsichtsmaßnahmen zu Pessach, wo das Verbot von Chametz (Gesäuertem) in Israel zu einer ganzen Welle an neuen Produkten mit dem Siegel koscher-le-Pessach geführt hat: Dabei wurde der Begriff des Chametz vom Essen auch auf alle anderen Haushalts- und Lebensbereiche ausgeweitet. So gibt es nun auch Kosmetik, Schuhcremes, Briefmarken und Tierstreu, die garantiert zu 100% frei von Gesäuertem sind. Halachisch ist dies in keinster Weise notwendig, doch entwickeln sich dererlei Produkte zu einem absoluten Kassenschlager.
Ein weiteres Thema in der heutigen Diskussion um Kaschrut ist die Auseinandersetzung mit neuen Trends sowie dem gestiegenen Moralbewusstsein rund ums Essen. So stellt sich beispielsweise die Frage, ob ein frommer Jude aus Tierschutzgründen vegetarisch oder sogar vegan leben kann, da viele traditionelle Schabbat- und Festtagsessen Fleisch sowie Fischspeisen enthalten und demnach zur Einhaltung derselben gehören. In diesem Zusammenhang fordern viele auch den Einbezug ethischer Gesichtspunkte bei der Vergabe von Koscherzertifikaten, sozusagen ein koscher+fair trade oder koscher+bio, was jedoch bisher nicht umgesetzt wurde.
Allerdings ist die jüdische Küche neuen Modeerscheinungen gegenüber weitestgehend offen - so gibt es mittlerweile eine beträchtliche Auswahl an koscherem Sushi, in Israel findet man Fastfoodketten mit Hechscher (Koscherzertifikat) und die Sojamilch erlaubt auch einem frommen Juden, zum fleischigen Cholent einen Latte Machiatto zu genießen.
Resümee
Seit dem Ausspruch an Noah „alles, was sich da regt, was da lebt, sei euch zur Nahrung, sowie das grüne Kraut, gebe Ich euch alles. Nur Fleisch mit seinem Leben, nämlich seinem Blut, sollt ihr nicht essen“ (Gen. 9:3-4) hat die Tradition der Kaschrut eine gewaltige Entwicklung durchlaufen.
Durch die ständige Anwendung auf die sich verändernden Lebensumstände bleiben die alten Quellen aktuell und ermöglichen so den gläubigen Juden in jeder Generation eine Balance zwischen dem Bewahren der eigenen Identität sowie dem Teilhaben an ihrer Umgebung zu finden. Die treibenden Kräfte des Etz Chajim sind also noch lange nicht erschöpft und zehren weiterhin aus den sich stetig wandelnden Gezeiten. Dabei bleibt abzuwarten, welche neuen Früchte dieser Baum auch in Zukunft hervorbringen wird.
Fußnoten
Literaturverzeichnis
Liss, Hanna, Tanach - Lehrbuch der Jüdischen Bibel, Heidelberg 3 2011.
Stemberger, Günter, Einleitung in Talmud und Midrasch, München92011.
Kramer, David, Jewish Eating and Identity Though the Ages, New York, Oxon 2007.
Heine, Heinrich, S ä mtliche Werke, Bd. IV, München21993.
Lewis, Jacob, "Kashrut Themes: Contemporary Concerns", <http://www.myjewishlearning.com/practices/Ritual/Kashrut_Dietary_Laws/Themes/Contemporar_ Themes.shtm> (14.02.2014).
[...]
1 Die zum Verzehr geeigneten Tierarten: Landtiere (Kennzeichen: Gespaltene Hufe & Wiederkäuer): Lev. 11:2-8; Lev. 11:24-27, 29-30; Deut. 14:4-8. Fische (Kennzeichen: Schuppen & Flossen): Lev. 11:9-12; Deut. 14:9-10. Geflügel: Lev. 11:13-19; Deut. 14:11-17. Insekten: Lev. 11: 20-23; Lev. 11: 41-42; Deut. 14: 19-20.
2 Schlachtung und Zubereitung, dabei vor allem die verbotenen Tierteile: - Bestimmungen zur Schlachtung Verbot eines natürlich verendeten Tieres: Lev. 11:32-40 Verbot der Schlachtung von Mutter- und Jungtier am selben Tag: Lev. 23:28 Gebot, das Blut zu bedecken: Lev.17:3 - Verbotene Tierteile Blut: Gen. 9:4; Lev.19:26 u.a. Spannader: Gen. 32:33 Verschiedene Fetteile: Lev. 7:23-24 - Weitere Bestimmungen Verbot des Kochens vom Jungtier in der Milch seiner Mutter: Ex. 23:19, 34:26 u.a.
3 Verbotene Mischungen sowie Kreuzungen Verbot der Artenkreuzung bei Pflanzen und Tieren: Lev. 19:19; Deut. 22:9 Verbot des Kochens vom Jungtier in der Milch seiner Mutter: Ex. 23:19, 34:26 u.a. Gebot, den Muttervogel fliegen zu lassen: Deut. 22:6-7 Unreinheit durch die Berührung mit Aas: Lev. 11:32-38
4 Die Gesetze rund um Ernte, Erstlinge sowie Opfergaben Erstlinge von Pflanzen und Tieren: Ex. 23:19, 34:19-20; Lev. 19:23-25; 23:14 u.a. Gebot der Feldecke für die Armen: Lev. 19:9-10, 23:22, Dtn. 24:19-21. Schmittah (Schabbatjahr): Ex.23:10ff., Lev. 25:1-7, Dtn. 15:2ff. Gesundheit von Opfertieren: Lev. 7:19; Dtn. 17:1 u.a.
5 Zum Begriff der wechselseitigen Heiligung siehe Hanna Liss, "Tanach - Lehrbuch der jüdischen Bibel", S.124. Heiligung des Schabbat: Ex.20:8-11, Lev.19:2-3 u.a. Sexualbestimmungen: Lev.12, 15, 18
6 Siehe dazu Günter Stemberger, "Einleitung in Talmud und Midrasch" und David Kraemer, "Jewish Eating and Identity Though the Ages".
7 bHul
8 bKel
9 bJad
10 bBer
11 bSchab-Hag
12 Zitat von Heinrich Heine; siehe dazu Heinrich Heine, "Sämtliche Werke".
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus der Einführung in Bezug auf die Kaschrut?
Die Einleitung fokussiert auf die Verbindung zwischen Essen und Hingabe an G'tt, die Bedeutung der Kaschrutvorschriften für Juden und die Frage, ob diese Vorschriften in der heutigen Zeit noch relevant sind. Es wird die Kaschrut als ein dynamischer "Baum des Lebens" dargestellt, der sich stetig weiterentwickelt, aber seine Wurzeln in den fünf Büchern Moses hat.
Welche Aspekte der Kaschrut werden im Pentateuch behandelt?
Im Pentateuch werden verschiedene Aspekte der Kaschrut behandelt, darunter die zum Verzehr geeigneten Tierarten, deren Schlachtung und Zubereitung (insbesondere die verbotenen Tierteile), verbotene Mischungen und Kreuzungen sowie Gesetze rund um Ernte, Erstlinge und Opfergaben für den Tempel.
Warum ist der Genuss von Blut verboten?
Der Genuss von Blut ist verboten, weil es "das Leben" enthält (Gen. 9:4).
In welchem Zusammenhang steht die Kaschrut mit dem Exodus?
Die Einhaltung der Kaschrut wird als eine Art Gegenleistung für die Errettung des Volkes aus der ägyptischen Sklaverei dargestellt. Da G'tt heilig ist und sich das Volk als Sein Eigentum annahm, muss auch dieses einen Status der Heiligkeit anstreben, unter anderem durch die Einhaltung der Speisegesetze.
Welche Bedeutung hat das Wort "kadosch" im Zusammenhang mit der Kaschrut?
Das hebräische Wort "kadosch" (heilig) hat zwei Konnotationen: es bedeutet sowohl Gegensatz zum Profanen als auch "absondern". Die Gesetze zur Heilighaltung spiegeln diesen Dualismus wider, indem sie dazu aufrufen, das Reine vom Unreinen zu trennen und Ersterem einen gesonderten Platz einzuräumen.
Welche Rolle spielt der Talmud bei der Entwicklung der Kaschrut?
Der Talmud bietet weitere Erklärungen und Interpretationen zu den vage formulierten Speisevorschriften der Torah, die für die Umsetzung im alltäglichen Leben notwendig sind. Er stellt eine umfassende Kodifizierung der Mündlichen Torah dar und wurde bis zum sechsten Jahrhundert weiter diskutiert und entwickelt.
Welche drei Grundtendenzen lassen sich im talmudischen Diskurs erkennen?
Im talmudischen Diskurs lassen sich drei Grundtendenzen ausmachen: die massive Ausweitung und Verschärfung der Torahgesetze für den profanen Genuss, eine breite Abhandlung der Themen Reinheit, Tempelabgaben und Opfergesetze (obwohl diese größtenteils nur noch von theoretischem Interesse sind) sowie die starke Forderung nach Abgrenzung zu Nichtjuden.
Welche neuen Aspekte rund um das Essen treten im rabbinischen Diskurs auf?
Im rabbinischen Diskurs werden neue Aspekte behandelt, darunter die Frage, welche Personen für die Schlachtung und Essenszubereitung geeignet sind, wobei der Status von Frauen, Behinderten und Nichtjuden im Vordergrund steht. Es werden auch Reinheitsbestimmungen für Koch- und Aufbewahrungsgefäße ausgeweitet und intensiviert, insbesondere im Hinblick auf die Trennung von Milch und Fleisch.
Welche Veränderungen in der Bedeutung der Kaschrut finden im Talmud statt?
Im Talmud verschiebt sich der primäre Sinn der Speisevorschriften: Die geforderte Heiligung als ein wesentliches Element in der Beziehung zu G'tt tritt in den Hintergrund, dafür werden der Abgrenzungsgedanke gegenüber den anderen Völkern sowie das Bewahren einer eigenen Identität zum Hauptthema.
Welche aktuellen Fragestellungen rund um die Kaschrut werden im Text angesprochen?
Aktuelle Fragestellungen betreffen die Herausforderungen der modernen Massenproduktion, die Überprüfung von Lebensmitteln, Medikamenten und Verpackungen auf unkoschere Substanzen, die Debatte über ethische Gesichtspunkte (Tierschutz, Fair Trade, Bio) bei der Vergabe von Koscherzertifikaten und die Integration neuer Trends in die jüdische Küche.
Was ist "Chametz" und welche Rolle spielt es zu Pessach?
"Chametz" bezieht sich auf Gesäuertes. Zu Pessach wird das Verbot von Chametz in orthodoxen Kreisen auf viele Haushalts- und Lebensbereiche ausgeweitet, was zu einer großen Auswahl an Produkten mit dem Siegel "koscher-le-Pessach" führt.
Welche Schlussfolgerung zieht das Resümee über die Entwicklung der Kaschrut?
Das Resümee kommt zu dem Schluss, dass die Tradition der Kaschrut seit den Aussagen an Noah eine gewaltige Entwicklung durchlaufen hat. Durch die ständige Anwendung auf die sich verändernden Lebensumstände bleiben die alten Quellen aktuell und ermöglichen es den gläubigen Juden in jeder Generation, eine Balance zwischen dem Bewahren der eigenen Identität und dem Teilhaben an ihrer Umgebung zu finden.
- Arbeit zitieren
- Mona Hohler (Autor:in), 2014, Kaschrut. Die jüdischen Speisevorschriften im Wandel der Zeit, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/286577