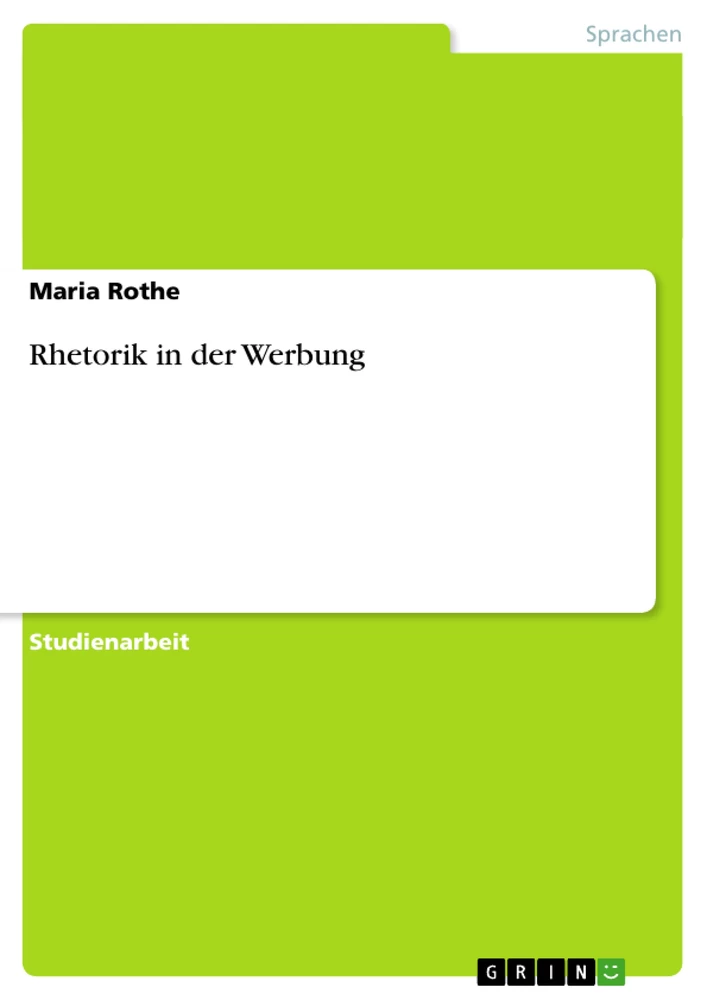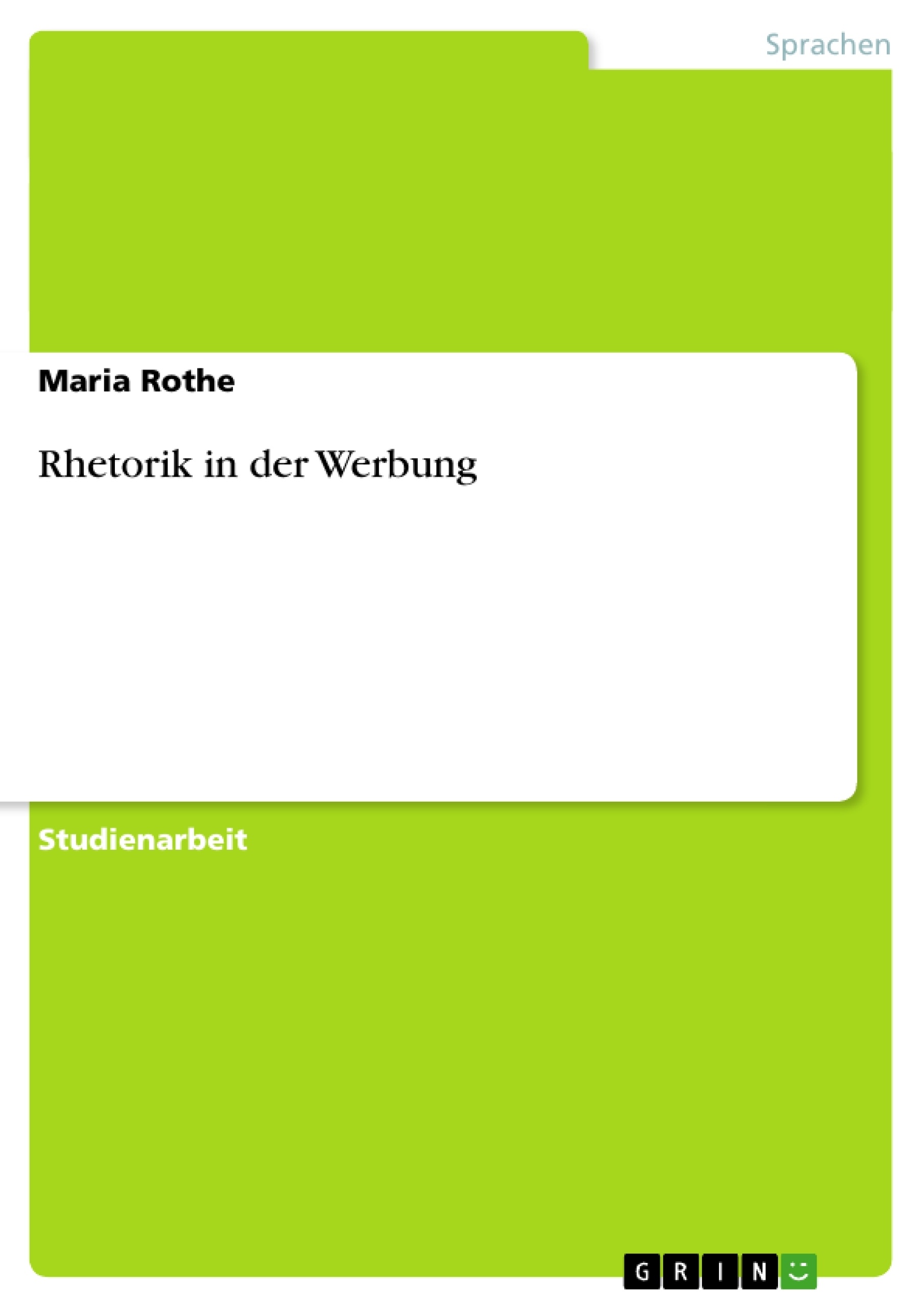1. Einleitung
Werbung ist allgegenwärtig und fest in das öffentliche und private Leben integriert. In der folgenden Arbeit soll zunächst ein Überblick über derzeitige Anwendungsbereiche gegeben werden. Außerdem werden in der Werbung Verwendung findende rhetorische Strategien aufgezeigt werden.
2. Wortgeschichte
‘Werbung’ ist die Substantivierte Form des Verbs ‘werben’. Dieses steht etymologisch in engem Zusammenhang mit ‘Wirbel’ und ‘wirbeln’. Seine grundlegende Bedeutung kann also soviel wie ‘sich drehen’ meinen. Genannt werden auch ‘hin und her gehen’, ‘sich umtun’, ‘bemühen’, ‘etwas betreiben’, ‘ausrichten’, ‘wenden’ oder ‘wandeln’. Wie hieraus ersichtlich wird, erfüllt Werbung, egal in welcher Form sie betrieben wird immer einen bestimmten Zweck. Sie soll unter Zuhilfenahme bestimmter Mittel aktiv Aufmerksamkeit erregen und den Umworbenen für eine Person, eine Sache oder ein bestimmtes Produkt begeistern. Im alltäglichen deutschen Sprachgebrauch etablierte sich das Wort ‘Werbung’ erst Anfang des 20. Jahrhunderts. Vorher wurde ‘Reklame’ benutzt, vom französischen ‘réclame’- Werbung, Anpreisung- abgeleitet. Dieses bekam im Laufe der Zeit einen plakativen, “Marktschreierischen” Bedeutungsinhalt und wurde allmählich durch das positivere und neutralere Wort ‘Werbung’ ersetzt. (vgl. Sowinski 1998, 4)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriff 'Werbung' (Wortgeschichte)
- Anwendungsbereiche
- Werbung im privaten Bereich
- Werbung für gesellschaftliche Gruppen und Vereine
- Politische Werbung
- Die Entscheidungswerbung
- Die Wahlwerbung
- Werbung für Dienstleistungen
- Warenwerbung
- Grundprinzipien
- Auffälligkeit
- Originalität
- Informativität
- Werbestrategie
- Textstrukturen in der Werbung
- Die Schlagzeile
- Der Slogan
- Der Fließtext
- Rhetorische Besonderheiten
- Argumentation in der Werbung
- Die Enthymem- Argumentation
- Die Beispiel Argumentation
- in der Werbung genutzte Schlussregeln- Topik
- Rhetorische Figuren und Stilmittel in der Werbung
- Positionsfiguren
- Wiederholungsfiguren
- Erweiterung
- Kürzung
- Appell
- Tropen
- Sprichwörter und Zitate
- Argumentation in der Werbung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Werbung, untersucht ihre verschiedenen Anwendungsbereiche und analysiert die in ihr verwendeten rhetorischen Strategien. Dabei wird ein umfassender Überblick über die Geschichte, die Funktionsweise und die Besonderheiten der Werbung gegeben.
- Die Entwicklung des Begriffs „Werbung“ und seine Bedeutung im historischen Kontext
- Die Analyse verschiedener Anwendungsbereiche der Werbung in privaten, gesellschaftlichen und politischen Bereichen
- Die Erörterung der Grundprinzipien und Werbestrategien
- Die Untersuchung rhetorischer Besonderheiten, insbesondere der Argumentationstechniken und Stilmittel, die in der Werbung Verwendung finden
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung liefert eine Einführung in das Thema Werbung und skizziert den Inhalt der Arbeit. Im zweiten Kapitel wird die Wortgeschichte des Begriffs „Werbung“ beleuchtet. Das dritte Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Anwendungsbereichen der Werbung, unterteilt in private, gesellschaftliche, politische und gewerbliche Bereiche. Dabei werden die spezifischen Formen und Ziele der Werbung in diesen Bereichen dargestellt. Das vierte Kapitel widmet sich den Grundprinzipien der Werbung, wie Auffälligkeit, Originalität und Informativität. Das fünfte Kapitel thematisiert die Werbestrategie. Das sechste Kapitel beleuchtet verschiedene Textstrukturen in der Werbung, wie die Schlagzeile, den Slogan und den Fließtext. Im siebten Kapitel werden die rhetorischen Besonderheiten der Werbung, wie Argumentationstechniken und Stilmittel, analysiert.
Schlüsselwörter
Werbung, Rhetorik, Argumentation, Stilmittel, Anwendungsbereiche, Grundprinzipien, Werbestrategie, Textstrukturen, Entscheidungswerbung, Wahlwerbung, Warenwerbung, Dienstleistungswerbung, Gesellschaftliche Gruppen, Vereine, Politische Werbung
- Arbeit zitieren
- Maria Rothe (Autor:in), 2004, Rhetorik in der Werbung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/28626