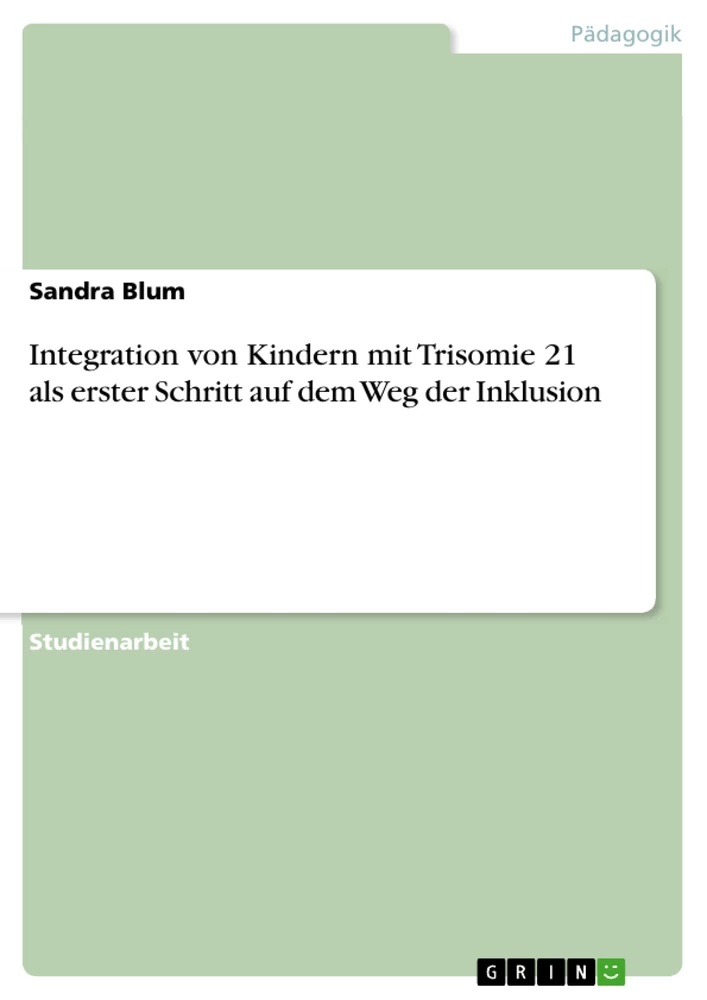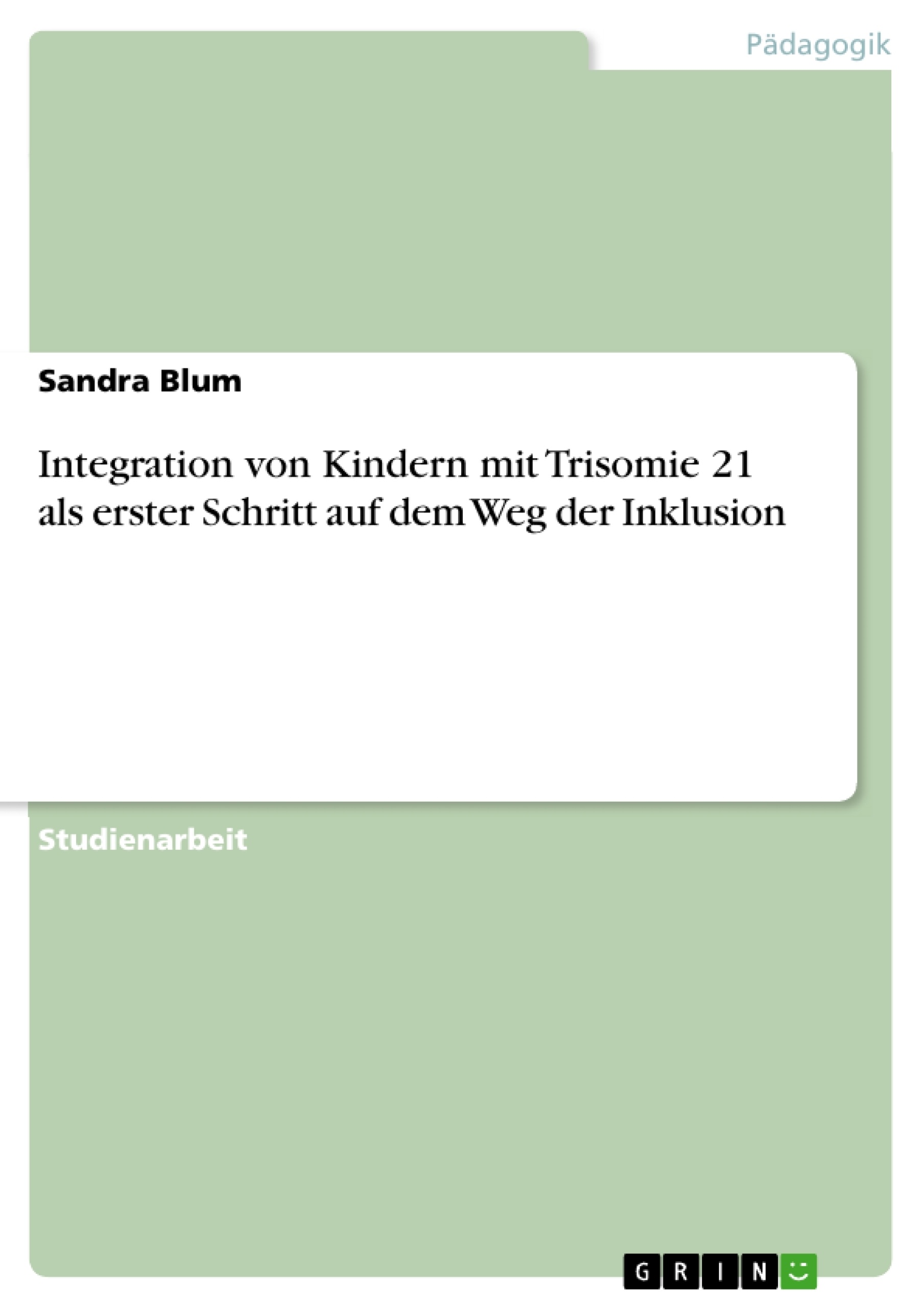In den 5 Bausteinen des Moduls "Lebenslagen und Lebenswelten von Kindern und ihren Familien" meines Studiums "Frühkindliche Bildung und Erziehung" kamen die Begriffe Integration und Inklusion fast wöchentlich in den Veranstaltungen vor. Bildlich war mir der Unterschied schnell verständlich. Doch irritierte mich die Praxis. In meinen bisherigen Praxisstellen (die ich während der Ausbildung zur Erzieherin besuchte/besichtigte) wurde immer wieder von Integrationskindern gesprochen, den „I-Kindern“. Ich konnte mir nicht erklären wie die Aufforderung zu Inklusion aus Fach- und Hochschule mit der aktuellen Situation in der Praxis einhergeht. Deshalb ging ich davon aus, dass die Einführung der „Integrationskindern“ eine vereinfachte/abgewandelte Umsetzungsform von Inklusion im frühkindlichen Bereich sein soll; praxispassend gemacht. Dass dies nicht so ist, wurde mir schon in den Vorlesungen und Seminaren von Modul 4 klar. Was Integration von Inklusion in der pädagogischen Praxis unterscheidet, und ob Integration in Kindertageseinrichtungen als Teilschritt auf dem Weg der inklusiven Kita gesehen werden kann, möchte ich innerhalb dieser Arbeit nachgehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Von Integration und Inklusion
- Die Begriffe „Integration“ und „Behinderung“
- Inklusion - Der Begriff
- Kinder mit Trisomie 21 als Integrationskinder in Regelkindergärten
- Die freie Trisomie 21 - Beschreibung
- Individuelle Einzel- Integration und ihre Folgen
- Integration von Kindern mit Trisomie 21 als erster Schritt der Inklusion
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Unterschied zwischen Integration und Inklusion im frühkindlichen Bereich, insbesondere am Beispiel der Integration von Kindern mit Trisomie 21 in Kindertageseinrichtungen. Ziel ist es, zu klären, ob Integration ein erster Schritt auf dem Weg zur Inklusion darstellt.
- Definition und Abgrenzung der Begriffe „Integration“ und „Inklusion“
- Die Praxis der Integration von Kindern mit Trisomie 21 in Regelkindergärten
- Analyse der Herausforderungen und Grenzen der Integration
- Diskussion der Frage, ob Integration ein erster Schritt zur Inklusion sein kann
- Bewertung der Einzelintegration von Kindern mit Trisomie 21 im Hinblick auf inklusive Pädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Ausgangspunkt der Arbeit: die Diskrepanz zwischen dem in der Ausbildung vermittelten Inklusionsbegriff und der Praxis der „Integrationskinder“ in Kindertageseinrichtungen. Die Autorin kündigt an, den Unterschied zwischen Integration und Inklusion zu untersuchen und dies am Beispiel der Integration von Kindern mit Trisomie 21 zu veranschaulichen, da sie selbst in diesem Kontext tätig sein wird. Die Arbeit zielt darauf ab, die gängige Praxis der Einzelintegration im Hinblick auf Inklusion zu bewerten.
Von Integration und Inklusion: Dieses Kapitel analysiert die Begriffe „Integration“ und „Behinderung“. Es beleuchtet die sprachliche Mehrdeutigkeit von „Integration“ und zeigt, wie der Begriff in der pädagogischen Praxis verwendet wird, nämlich für die Eingliederung von Kindern mit Beeinträchtigungen in Regelschulen oder -kindergärten. Der Unterschied zu Inklusion wird anhand von Abbildung 1 verdeutlicht: Integration stellt eine Eingliederung in ein bestehendes System dar, während Inklusion eine Anpassung des Systems an die individuellen Bedürfnisse aller Kinder bedeutet. Das Kapitel kritisiert die gängige Praxis der Einzelintegration, die oft zu einer Sonderbehandlung der „Integrationskinder“ führt und die eigentlichen Ziele der Inklusion verfehlt.
Kinder mit Trisomie 21 als Integrationskinder in Regelkindergärten: Dieses Kapitel beschreibt die Trisomie 21 und die Herausforderungen der individuellen Einzelintegration von Kindern mit diesem Syndrom. Es werden die Folgen dieser Form der Integration für das betroffene Kind und seine soziale Einbindung in den Regelkindergarten beleuchtet. Die Zusammenfassung der beiden Unterkapitel zeigt, dass die bisherige Praxis der Einzelintegration von Kindern mit Trisomie 21 oft nicht den Ansprüchen einer inklusiven Pädagogik genügt und zu einer Ausgrenzung führen kann, obwohl die Intention oft gut gemeint ist.
Integration von Kindern mit Trisomie 21 als erster Schritt der Inklusion: Dieses Kapitel wird die bereits angesprochenen Aspekte vertiefen und die Frage nach der Eignung der Integration als ersten Schritt zur Inklusion anhand des Beispiels von Kindern mit Trisomie 21 diskutieren. Die Analyse wird die bestehenden Strukturen und ihre Anpassungsfähigkeit an die Bedürfnisse von Kindern mit Trisomie 21 kritisch beleuchten und herausarbeiten, welche Faktoren eine gelingende Integration und den Übergang zur Inklusion unterstützen oder behindern.
Schlüsselwörter
Integration, Inklusion, Trisomie 21, Down-Syndrom, inklusive Pädagogik, Kindertageseinrichtung, Regelkindergarten, Einzelintegration, Behinderung, Sonderpädagogik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Integration von Kindern mit Trisomie 21 in Regelkindergärten
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Unterschied zwischen Integration und Inklusion im frühkindlichen Bereich, insbesondere am Beispiel der Integration von Kindern mit Trisomie 21 in Kindertageseinrichtungen. Das zentrale Ziel ist die Klärung der Frage, ob Integration ein erster Schritt auf dem Weg zur Inklusion darstellt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Abgrenzung der Begriffe „Integration“ und „Inklusion“, die Praxis der Integration von Kindern mit Trisomie 21 in Regelkindergärten, die Herausforderungen und Grenzen der Integration, die Diskussion der Frage, ob Integration ein erster Schritt zur Inklusion sein kann, und die Bewertung der Einzelintegration von Kindern mit Trisomie 21 im Hinblick auf inklusive Pädagogik.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zu Integration und Inklusion (inkl. Definitionen und Abgrenzung), ein Kapitel zu Kindern mit Trisomie 21 als Integrationskinder in Regelkindergärten (inkl. Beschreibung der Trisomie 21 und Folgen der Einzelintegration), ein Kapitel zur Integration von Kindern mit Trisomie 21 als erstem Schritt zur Inklusion und ein Schlusswort. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Was ist der Unterschied zwischen Integration und Inklusion laut der Arbeit?
Die Arbeit verdeutlicht den Unterschied zwischen Integration und Inklusion anhand einer Abbildung: Integration stellt die Eingliederung von Kindern mit Beeinträchtigungen in ein bestehendes System dar, während Inklusion eine Anpassung des Systems an die individuellen Bedürfnisse aller Kinder bedeutet. Integration wird kritisch betrachtet, da sie oft zu einer Sonderbehandlung der „Integrationskinder“ führt und die Ziele der Inklusion verfehlt.
Welche Rolle spielt die Trisomie 21 in der Arbeit?
Kinder mit Trisomie 21 dienen als Beispiel, um die Praxis der Integration und ihre Grenzen im Hinblick auf Inklusion zu beleuchten. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen der individuellen Einzelintegration dieser Kinder und bewertet die gängige Praxis kritisch im Hinblick auf inklusive Pädagogik.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit bezüglich Integration und Inklusion?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob Integration tatsächlich ein erster Schritt zur Inklusion sein kann. Die Analyse der bestehenden Strukturen und ihrer Anpassungsfähigkeit an die Bedürfnisse von Kindern mit Trisomie 21 soll Aufschluss darüber geben, welche Faktoren eine gelingende Integration und den Übergang zur Inklusion unterstützen oder behindern. Die detaillierte Schlussfolgerung wird im Kapitel "Integration von Kindern mit Trisomie 21 als erster Schritt der Inklusion" und dem Schlusswort präsentiert.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit verwendet?
Schlüsselbegriffe sind: Integration, Inklusion, Trisomie 21, Down-Syndrom, inklusive Pädagogik, Kindertageseinrichtung, Regelkindergarten, Einzelintegration, Behinderung, Sonderpädagogik.
- Quote paper
- Sandra Blum (Author), 2014, Integration von Kindern mit Trisomie 21 als erster Schritt auf dem Weg der Inklusion, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/286006