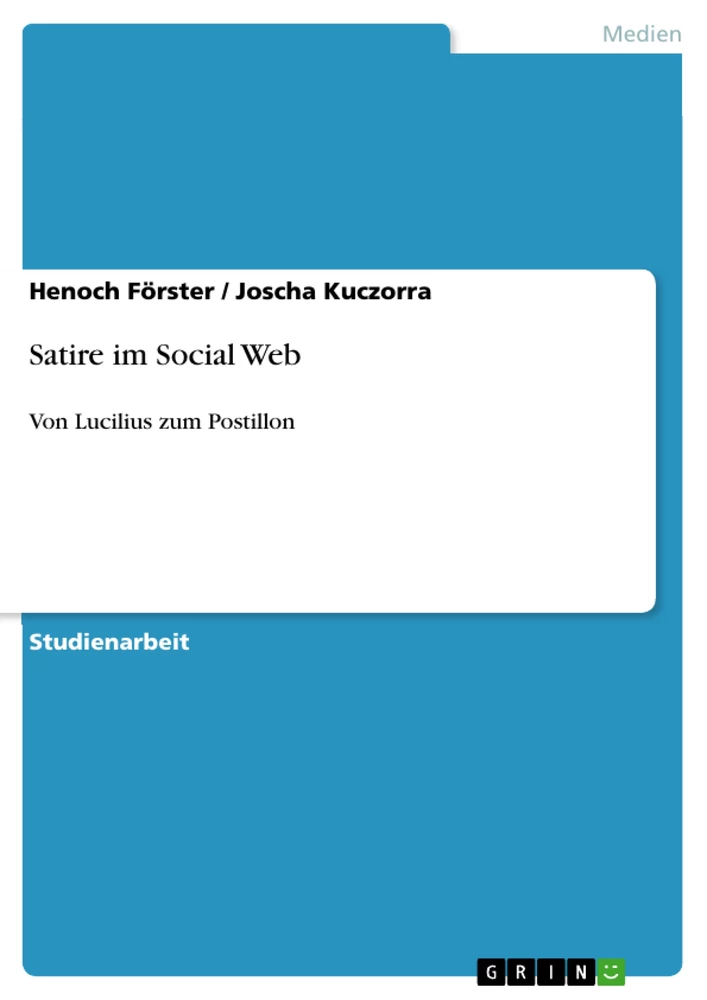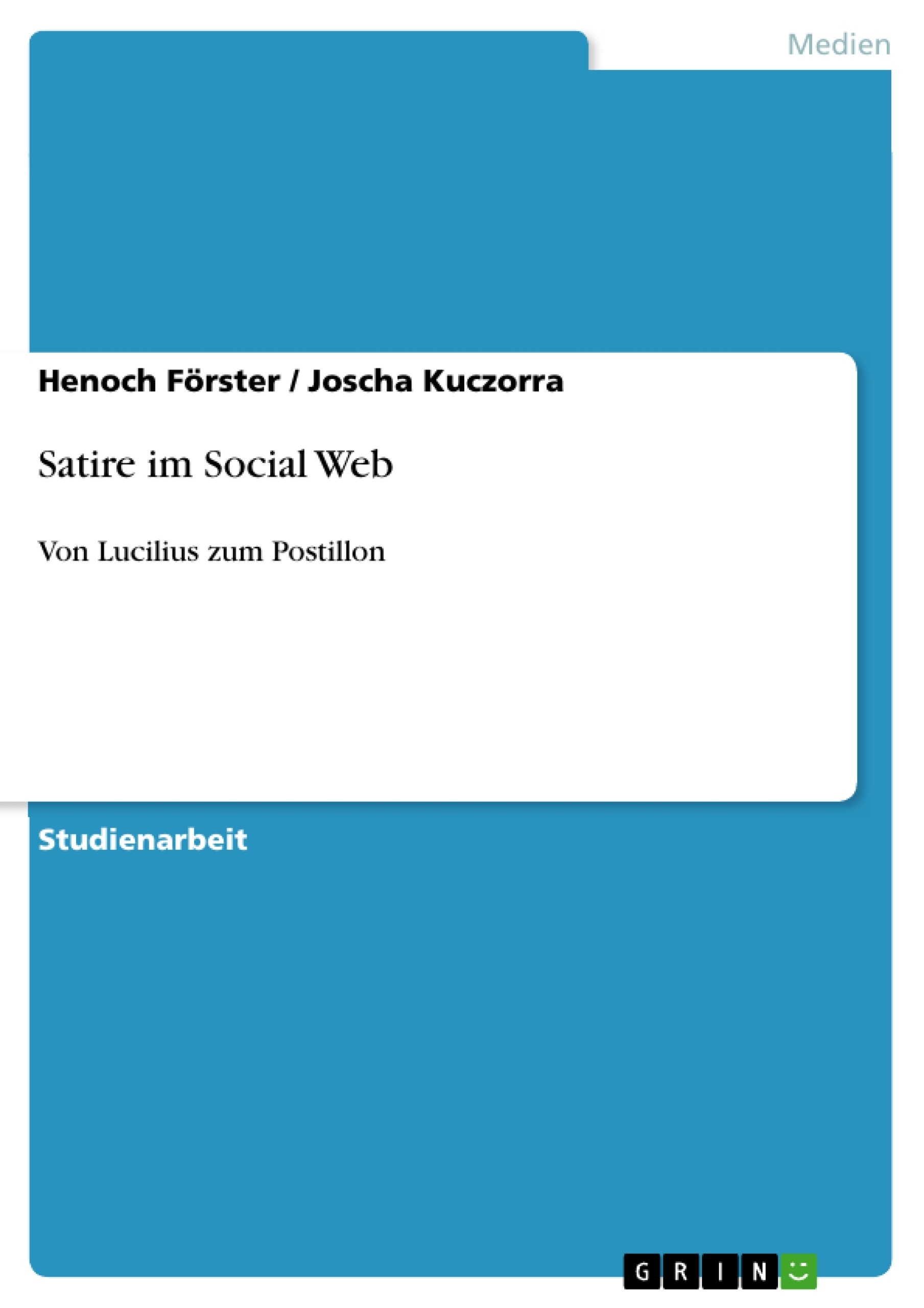Mit dem Start des Internetzeitalters bekam die Satire eine ganz neue Dimension. Der Zugang zu dieser kleinen Gattung der Literatur wurde den Menschen plötzlich leichter gemacht. Man musste nicht mehr unbedingt eine Zeitung kaufen, den Fernseher einschalten oder zum Buch greifen. Mit dem Internet war alles sofort und meist kostenlos abrufbar. Auch Hobby-Satiriker hatten die Möglichkeit, literarische Texte im Netz zu verbreiten. Das schuf neue Möglichkeiten.
Die erfolgreichste Satireseite auf Facebook ist derzeit „Der Postillon – Ehrliche Nachrichten – unabhängig, schnell, seit 1845“. Das Gerüst bildet eine Website, die täglich mehrmals satirische Artikel veröffentlicht. Diese Kurzberichte werden dann auf Facebook gepostet. Der Postillon hat derzeit knapp 1,2 Millionen Fans. Das ist für einen „Zeitungsverlag“, der hier in Anführungszeichen gesetzt werden muss, eine sehr hohe Zahl. Seriöse Nachrichtenportale wie Spiegel, Stern oder die FAZ müssen sich mit weitaus weniger Zuspruch im Netz zufrieden geben.
Satire spaltet die Gesellschaft in ihrer Meinung. Provokante Themen und Texte führen zu großen Diskussionen, die im Social Web unter dem Begriff Shitstorm bekannt sind. Tritt er ein, kommentieren Hunderte oder Tausende User los. Entweder um ihre Empörung zu äußern oder um die Satire zu verteidigen. Die Kommentatoren möchten in der Gruppe diskutieren und herausfinden, ob die Satire gelungen ist oder nicht. Jeder User kann abgegebene Kommentar mit einem Gefällt mir über einen Button markieren. Somit ist es ihm möglich, seinen Zuspruch bekannt zu machen. Doch wer behält am Ende Recht, ob der Autor „alles richtig gemacht“ oder „zu weit gegangen“ ist? Auf den ersten Blick „gewinnt“ jene argumentierende Front, welche den größten Zuspruch an Gefällt mir Angaben hat. Doch so kann das eben nicht entschieden werden. Denn wie weit Satire gehen darf, wird in jedem einzelnen Fall subjektiv und neu definiert. Es ist immer auch abhängig von der persönlichen Betroffenheit sowie von eigenen Wert- und Normvorstellungen. Der eine versteht keinen Spaß bei Religion, dem anderen geht es zu weit, wenn man Satire über seinen Gartenzwerg macht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition
- 3. Geschichte
- 3.1 Antike
- 4. Internet und Zeitschrift
- 5. Satire im Social Web
- 6. Vergleich zwischen Postillon und Titanic
- 7. Wer hat noch nicht, wer will nochmal
- 8. Ein Blick in die Zukunft
- 9. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Entwicklung und den gegenwärtigen Stand der Satire im Social Web. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der Gattung, ihre Definition und ihre Manifestation im digitalen Raum, insbesondere im Vergleich traditioneller Formen mit neuen Online-Ausprägungen. Die Arbeit analysiert auch die Rolle sozialer Medien für die Verbreitung und Rezeption von Satire.
- Definition und historische Entwicklung der Satire
- Die Rolle des Internets und der Zeitschriften für die Satire
- Satire im Social Web: Verbreitung und Wirkung
- Vergleichende Analyse verschiedener satirischer Plattformen
- Zukunftsperspektiven der Satire im digitalen Zeitalter
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Fragestellung nach dem Beliebtheitsgrad der Satire, ihrer aktuellen Lage und zukünftigen Entwicklung. Sie hebt die zunehmende Bedeutung der Satire im Internet und den sozialen Medien hervor, besonders im Hinblick auf die gestiegene Qualität und Rezeption. Die Autoren kündigen einen Einblick in die Geschichte der Satire bis zur Gegenwart an, inklusive einer Zukunftsprognose.
2. Definition: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition des Begriffs „Satire“. Es beleuchtet die etymologische Herkunft des Wortes aus dem Lateinischen ("lanx satura") und diskutiert verschiedene Missverständnisse in der Sprachentwicklung. Die Definition der Satire wird anhand verschiedener Perspektiven erläutert, inklusive der Unterscheidung zwischen der älteren Bedeutung als Spottdichtung und der modernen Auffassung als künstlerisch gestalteter Text, der Personen, Ereignisse oder Zustände verspottet oder anprangert. Die Kapitel beschreibt die verschiedenen Ausdrucksformen und medialen Erscheinungsbilder der Satire.
3. Geschichte: Das Kapitel gibt einen historischen Überblick über die Satire, beginnend mit ihren Ursprüngen in der Antike. Es betont den römischen Ursprung der Gattung und zitiert Quintilian, der die Satire als eine rein römische Schöpfung betrachtet. Das Kapitel beleuchtet die Beziehung zwischen Satire und Rhetorik in der Antike und erwähnt die Verwendung satirischer Ironie in der Forensik.
Schlüsselwörter
Satire, Social Media, Internet, Postillon, Titanic, Geschichte der Satire, Definition Satire, literarische Gattung, Rhetorik, Ironie, Spott, Kritik, Gesellschaftssatire, digitale Medien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Satire im Social Web
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Entwicklung und den gegenwärtigen Stand der Satire im Social Web. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der Gattung, ihre Definition und ihre Manifestation im digitalen Raum, insbesondere im Vergleich traditioneller Formen mit neuen Online-Ausprägungen. Die Arbeit analysiert auch die Rolle sozialer Medien für die Verbreitung und Rezeption von Satire.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und historische Entwicklung der Satire, die Rolle des Internets und der Zeitschriften für die Satire, Satire im Social Web: Verbreitung und Wirkung, eine vergleichende Analyse verschiedener satirischer Plattformen und Zukunftsperspektiven der Satire im digitalen Zeitalter.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in das Thema ein und stellt die zentrale Fragestellung. Kapitel 2 (Definition) befasst sich mit der Definition des Begriffs „Satire“. Kapitel 3 (Geschichte) gibt einen historischen Überblick über die Satire, beginnend mit ihren Ursprüngen in der Antike. Weitere Kapitel befassen sich mit Internet und Zeitschriften im Kontext von Satire, Satire im Social Web, einem Vergleich zwischen Plattformen wie Postillon und Titanic und einem Ausblick in die Zukunft der Satire.
Welche konkreten Beispiele für satirische Plattformen werden untersucht?
Die Arbeit vergleicht unter anderem die satirischen Plattformen Postillon und Titanic.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Satire, Social Media, Internet, Postillon, Titanic, Geschichte der Satire, Definition Satire, literarische Gattung, Rhetorik, Ironie, Spott, Kritik, Gesellschaftssatire, digitale Medien.
Welche Quellen werden verwendet?
Die genauen Quellen sind nicht im bereitgestellten Textfragment aufgeführt. Diese Information würde im vollständigen Text der Seminararbeit zu finden sein.
Für wen ist diese Seminararbeit gedacht?
Die Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum, das sich für die Themen Satire, Social Media und digitale Medien interessiert. Die OCR-Daten sind ausschließlich für die akademische Verwendung vorgesehen.
Wo finde ich das vollständige Inhaltsverzeichnis?
Das Inhaltsverzeichnis ist im bereitgestellten HTML-Code enthalten und umfasst Kapitel von der Einleitung bis zum Fazit, inklusive Unterkapiteln wie "3.1 Antike".
- Quote paper
- Henoch Förster (Author), Joscha Kuczorra (Author), 2014, Satire im Social Web, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/285978