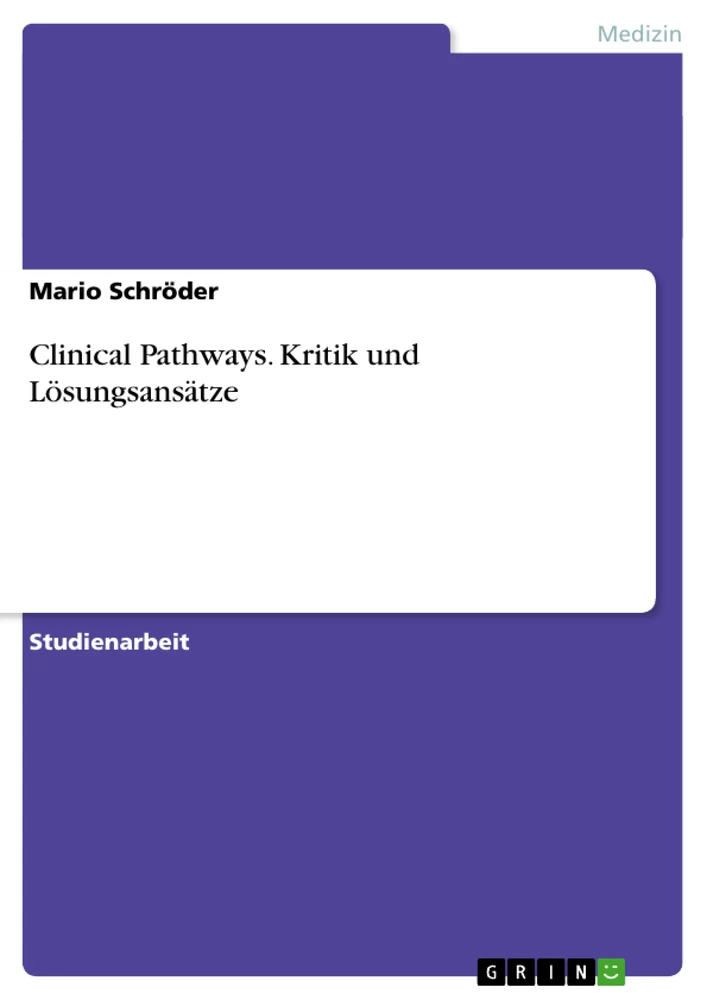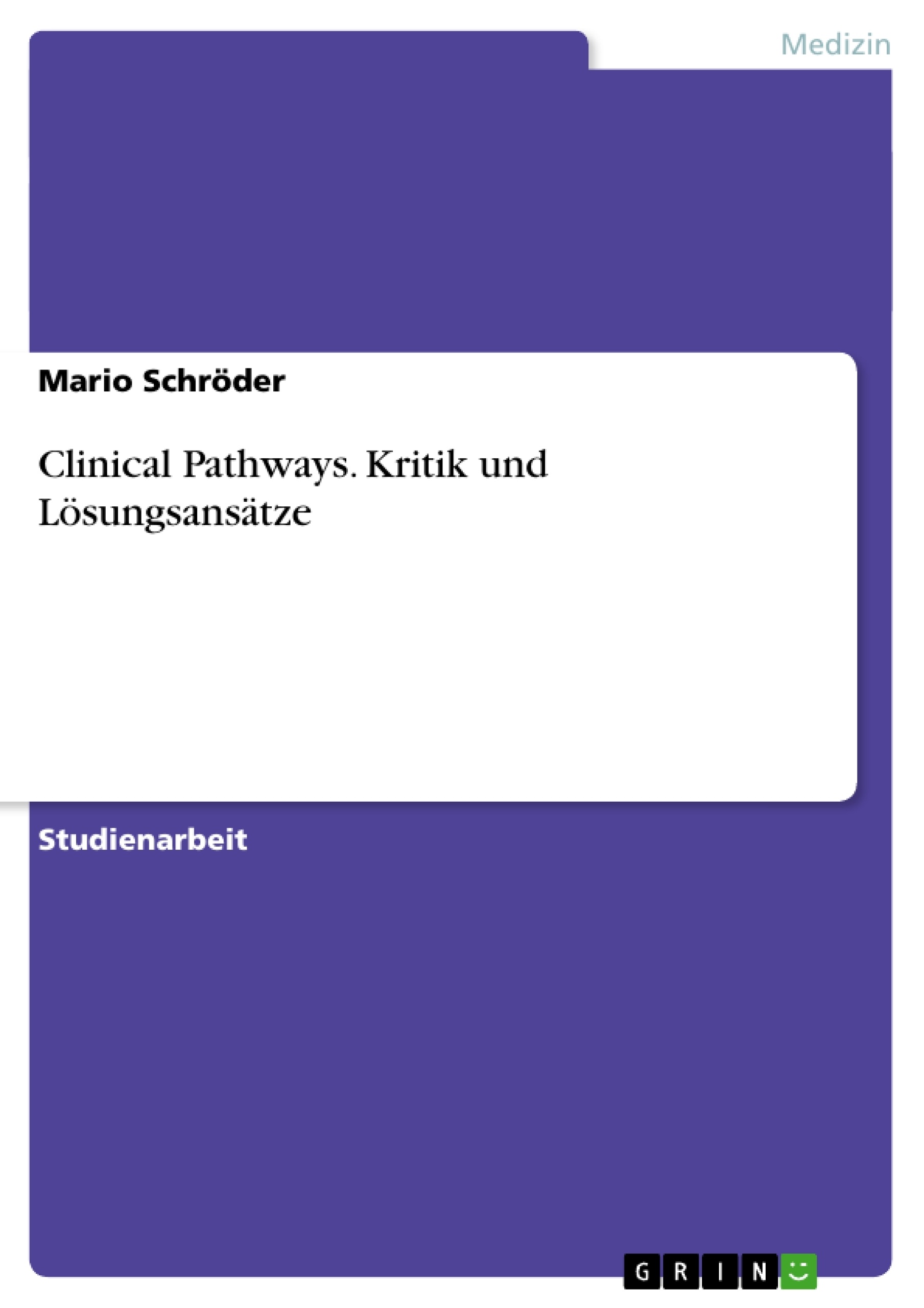Im Rahmen des Seminars „Qualitätsentwicklung pflegerischer Arbeitsprozesse“ wurde sich mit Clinical Pathways bzw. Klinischen Behandlungspfaden auseinandergesetzt.
Wesentliche Grundlage des Referats waren hierbei ein Studienbrief zum Thema „Organisationsmanagement - Reorganisation im Gesundheitswesen“ von Dr. Silke Kühnle aus dem Jahre 2003 sowie des Aufsatzes „Klinische Behandlungspfade: Ein Weg zur Integration von standardisierter Behandlungsplanung und Patientenorientierung?“ von Barbara Hellige und Renate Stammer aus dem Jahre 2005.
Ausgehend von diesen Quellen stellen die Referenten das Instrument „Clinical Pathways“ in vor, betrachten seine Entstehungsgeschichte, seine Grundlagen und die Ziele, welche mit seiner Implementierung verfolgt werden.
Darauf aufbauend erfolgt eine kritische Betrachtung der Behandlungspfade, welche Chancen und Risiken bei der Einführung in Deutschland mit dem besonderen Fokus der Pflege darstellt.
Anschließend erfolgt eine Darstellung des s.g. „Kölner Modells“, welches als Beispiel für eine gelungene Umsetzung der Materie präsentiert wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Clinical Pathways
- Entwicklung
- Motivation
- Grundlagen
- Clinical Pathways in der Praxis
- Kritik
- CP entlehnen sich an Ökonomie und sind fürs Gesundheitssystem nicht geeignet
- Medizin und KKH-Zentrierung
- System
- Zweckrationalität vs. Komm. Verständigung
- Lösungsansätze
- Lösungsansätze der Autoren: Kölner Modell
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Clinical Pathways (CP), auch bekannt als klinische Behandlungspfade. Die Arbeit analysiert die Entwicklung, Grundlagen und praktische Anwendung von CP im deutschen Gesundheitswesen, insbesondere im Kontext der Pflege. Ein Schwerpunkt liegt auf der kritischen Betrachtung der Implementierung von CP und der Herausforderungen, die sich daraus ergeben. Abschließend wird ein Lösungsansatz, das Kölner Modell, vorgestellt.
- Entwicklung und Implementierung von Clinical Pathways
- Kritische Bewertung von CP im deutschen Gesundheitssystem
- Einfluss des DRG-Systems auf die Anwendung von CP
- Herausforderungen bei der interprofessionellen Zusammenarbeit im Kontext von CP
- Lösungsansätze und Best-Practice-Beispiele (Kölner Modell)
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Clinical Pathways (CP) ein und beschreibt den methodischen Ansatz der Arbeit. Sie basiert auf dem Studienbrief von Dr. Silke Kühnle (2003) und dem Aufsatz von Hellige und Stammer (2005). Die Arbeit stellt CP vor, beleuchtet die Entstehungsgeschichte, Grundlagen und Ziele der Implementierung und gibt einen Ausblick auf die kritische Betrachtung sowie die Vorstellung des Kölner Modells als Beispiel für eine erfolgreiche Umsetzung.
Clinical Pathways: Dieses Kapitel definiert Clinical Pathways als einen konsensualen Behandlungsplan, der die bestmögliche Krankenhausbehandlung unter Berücksichtigung von Qualität, Ressourcen und Verantwortlichkeiten festlegt. Es betont den interprofessionellen Konsens und die Bedeutung der kontinuierlichen Evaluation und Verbesserung. Die Definition von Roeder/Müller (2007) wird als Grundlage verwendet, die die institutionsspezifische Ausrichtung von CP hervorhebt.
Entwicklung: Die Entwicklung von CP ist eng mit der Einführung des DRG-Systems verbunden. Die pauschale Abrechnung nach Diagnosen (statt nach Behandlungstagen) schafft Anreize zur Prozessoptimierung und Wirtschaftlichkeitssteigerung. CP werden als attraktive Methode zur Kostenkontrolle und Qualitätssicherung gesehen. Die Arbeit verweist auf die Ursprünge in der industriellen Praxisgestaltung der 1950er Jahre und deren Übertragung in den Gesundheitssektor der 1980er Jahre in den USA und Großbritannien.
Motivation: Die Motivation zur Einführung von CP in Deutschland wird durch das DRG-System und die Notwendigkeit effektiver Kostenkontrolle begründet. Die Komplexität von Krankenhausprozessen, gekennzeichnet durch unübersichtliche Abläufe, unzureichende Kompetenzabgrenzungen, lange Wartezeiten und interprofessionelle Konflikte (Grossmann, 1995, zitiert nach Kühnle, 2003), wird als weiterer wichtiger Faktor genannt. CP sollen Transparenz schaffen und Qualität sowie Kostenkontrolle verbessern.
Grundlagen: Die Entwicklung von CP basiert auf dem Prinzip des Re-Engineerings und der Wertkettenanalyse. Mithilfe einer detaillierten Prozessanalyse werden Aktivitäten in primäre und unterstützende Tätigkeiten unterteilt, um Optimierungspotenziale zu identifizieren. Eine Fehler-Möglichkeit-Einfluss-Analyse (FMEA) dient der Verbesserung der Prozessqualität durch die Identifizierung und Gewichtung von Einflussfaktoren.
Clinical Pathways in der Praxis: Die praktische Umsetzung von CP in Kliniken erfolgt oft in Form von Checklisten, die alle relevanten Stationen des Behandlungsprozesses erfassen.
Schlüsselwörter
Clinical Pathways, Klinische Behandlungspfade, DRG-System, Kostenkontrolle, Qualitätsmanagement, Prozessoptimierung, interprofessionelle Zusammenarbeit, Re-Engineering, Wertkettenanalyse, Fehler-Möglichkeit-Einfluss-Analyse (FMEA), Kölner Modell, Gesundheitswesen, Pflege.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Clinical Pathways im deutschen Gesundheitswesen
Was ist das Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht Clinical Pathways (CP), auch bekannt als klinische Behandlungspfade, im deutschen Gesundheitswesen, insbesondere im Kontext der Pflege. Sie analysiert deren Entwicklung, Grundlagen und praktische Anwendung, kritische Aspekte der Implementierung und präsentiert das Kölner Modell als Lösungsansatz.
Welche Aspekte von Clinical Pathways werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung und Implementierung von CP, ihre kritische Bewertung im deutschen Gesundheitssystem, den Einfluss des DRG-Systems, Herausforderungen bei der interprofessionellen Zusammenarbeit und Lösungsansätze sowie Best-Practice-Beispiele (Kölner Modell). Die Arbeit betrachtet auch die Motivation für die Einführung von CP und deren Grundlagen im Hinblick auf Re-Engineering und Wertkettenanalyse.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zu Clinical Pathways (mit Unterkapiteln zu Entwicklung, Motivation, Grundlagen und Praxis), ein Kapitel zur Kritik an CP, ein Kapitel zu Lösungsansätzen (fokussiert auf das Kölner Modell) und ein Literaturverzeichnis. Sie beinhaltet zudem eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Kritikpunkte an Clinical Pathways werden angesprochen?
Die Kritikpunkte umfassen die ökonomische Ausrichtung von CP, die als ungeeignet für das Gesundheitssystem angesehen wird, die medizinische und KKH-Zentrierung, systemische Probleme und den Konflikt zwischen Zweckrationalität und kommunikativer Verständigung.
Welches Lösungsmodell wird vorgestellt?
Die Hausarbeit präsentiert das Kölner Modell als Lösungsansatz für die Herausforderungen bei der Implementierung von Clinical Pathways.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf dem Studienbrief von Dr. Silke Kühnle (2003), dem Aufsatz von Hellige und Stammer (2005) und der Definition von Roeder/Müller (2007). Zusätzlich wird Grossmann (1995, zitiert nach Kühnle, 2003) erwähnt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Clinical Pathways, Klinische Behandlungspfade, DRG-System, Kostenkontrolle, Qualitätsmanagement, Prozessoptimierung, interprofessionelle Zusammenarbeit, Re-Engineering, Wertkettenanalyse, Fehler-Möglichkeit-Einfluss-Analyse (FMEA), Kölner Modell, Gesundheitswesen, Pflege.
Wie ist der methodische Ansatz der Arbeit?
Die Einleitung beschreibt den methodischen Ansatz der Arbeit, welcher auf den genannten Studienbriefen und Aufsätzen basiert und eine Analyse der Entwicklung, Implementierung, Kritik und Lösungsansätze von Clinical Pathways beinhaltet.
Was ist der Zusammenhang zwischen DRG und Clinical Pathways?
Die Entwicklung von CP ist eng mit der Einführung des DRG-Systems verbunden. Die pauschale Abrechnung nach Diagnosen schafft Anreize zur Prozessoptimierung und Wirtschaftlichkeitssteigerung, wodurch CP als Methode zur Kostenkontrolle und Qualitätssicherung attraktiv werden.
Wie werden Clinical Pathways in der Praxis umgesetzt?
Die praktische Umsetzung erfolgt oft in Form von Checklisten, die alle relevanten Stationen des Behandlungsprozesses erfassen.
- Arbeit zitieren
- Mario Schröder (Autor:in), 2009, Clinical Pathways. Kritik und Lösungsansätze, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/284000