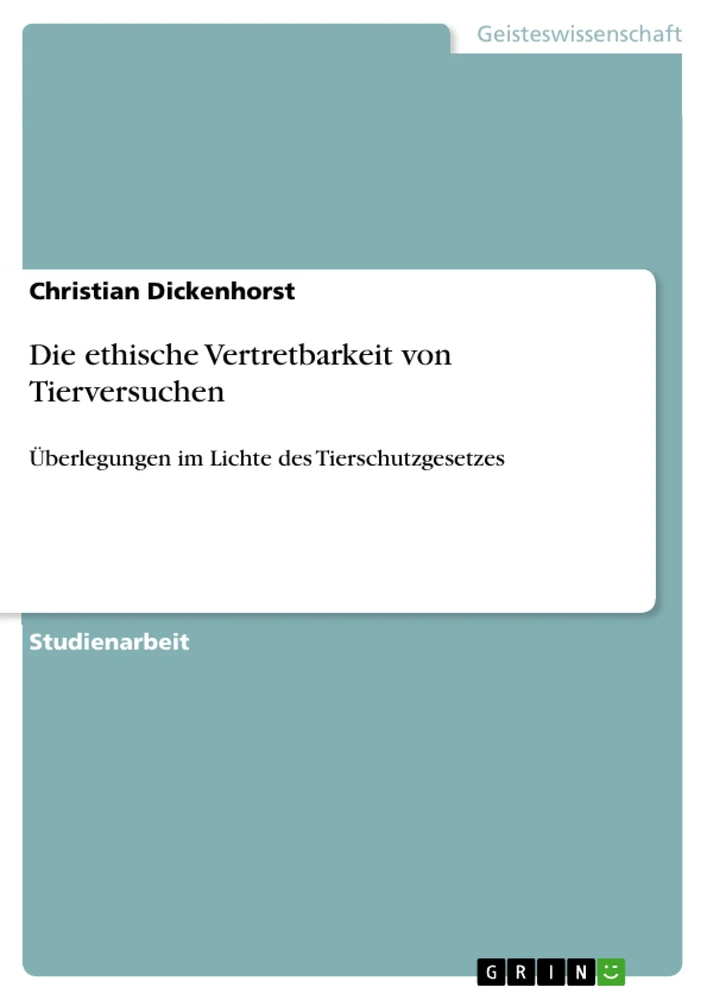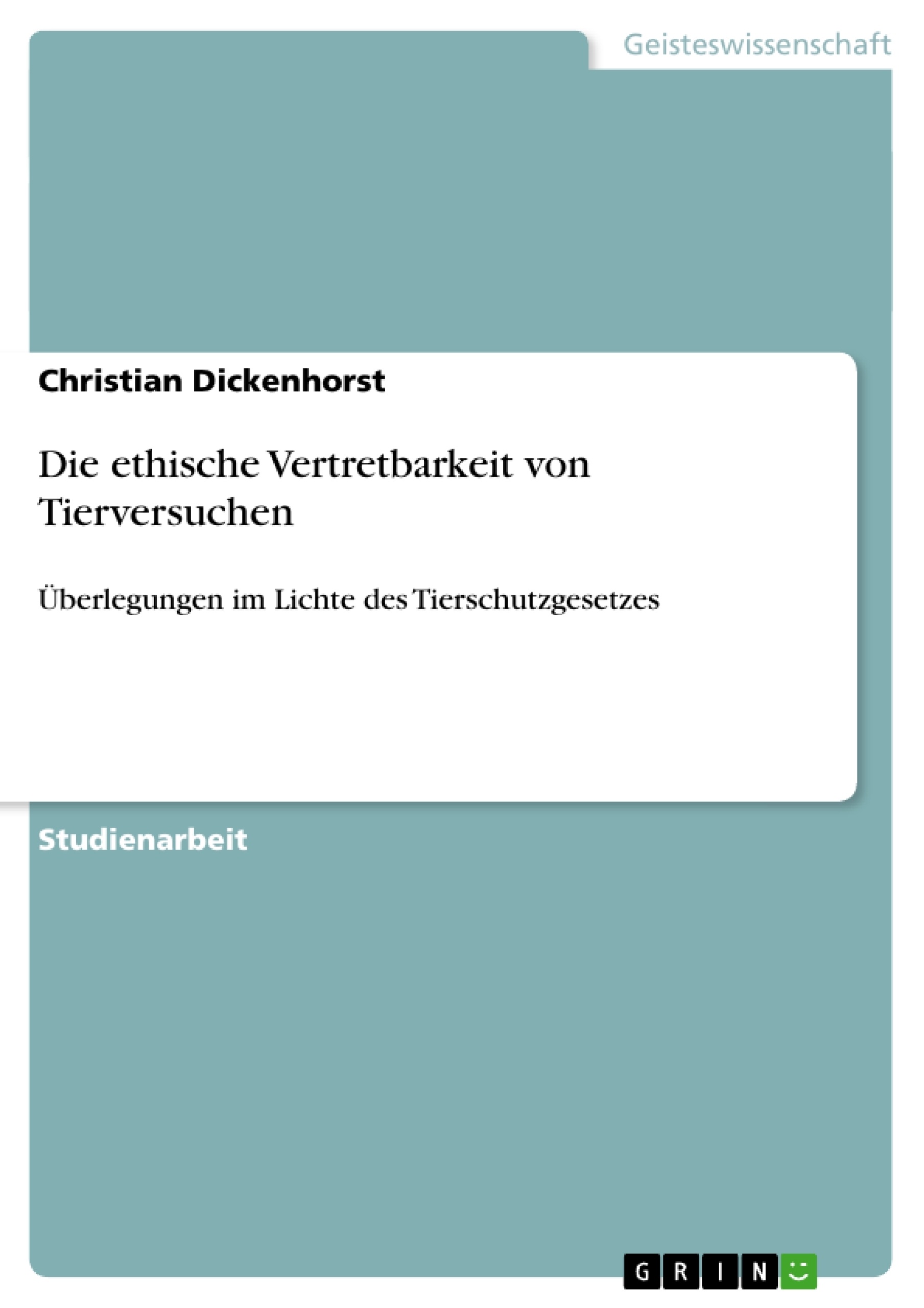Tiere spielen innnerhalb von Wissenschaft und Forschung nicht selten eine zentrale Rolle. Der Russe JURI GARGARIN war bekanntlich der erste Mensch im Weltall; das erste Lebewesen war indes ein Hund (namens „Laika“). Die wenigsten Tiere sind uns namentlich bekannt geworden, auch wenn sie einen großen Beitrag zum Fortschritt in der Wissenschaft geleistet haben. Schätzungen zufolge werden jährlich bis zu 100 Millionen Tiere – zumeist Mäuse, Ratten, Hamster, Meerschweinchen, Kaninchen und Frettchen – weltweit bei Tierversuchen verwendet. Viele von ihnen wurden eigens zum Zweck der Versuchsdurchführung gezüchtet; nur manche von ihnen überleben die Prozedur. Tierschutzorganisationen wie PETA verstehen es immer wieder, mit Hilfe von (schwer zu ertragenden) Bildern Tierversuche in der Öffentlichkeit anzuprangern. In Deutschland hat der Gesetzgeber bereits vor über 80 Jahren Regelungen für die Durchführung von Tierversuchen erlassen; mittlerweile fordert das Gesetz auch, dass die Durchführung der Tierversuche „ethisch vertretbar“ sein muss. Im Rahmen dieser Arbeit soll nun der Frage nachgegangen werden, ob und unter welchen Voraussetzungen Tierversuche mit ethischen Ansprüchen in Einklang gebracht werden können. Dies soll – zumindest, soweit es möglich ist – losgelöst von der Frage geschehen, ob Menschen ein Recht dazu haben, Tiere als Nahrung zu züchten und zu töten. Überschneidungen zur Thematik der Tierversuche gibt es hier gewiss; Massentierhaltung und Tiertransporte seien nur beispielhaft genannt. Die Ausführungen dazu würden den Rahmen dieser Arbeit jedoch bei Weitem sprengen. Vegetarier (und erst Recht Veganer) mögen dies dem Verfasser daher nachsehen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Definition: Tierversuche
- Geschichte des Tierschutzes und der Tierversuche
- Aktuelle gesetzliche Regelungen in Deutschland
- Negative Auswirkungen auf Tiere
- Menschenversuche als Alternative?
- Eid des Hippokrates
- Berechtigung von Tierversuchen
- Ethische Konzepte
- Kant Gesinnungsethik
- Schweitzer Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben
- Bentham / Mill: Erfolgsethik bzw. Utilitarismus
- Singer Speziesismus
- Ethische Analyse und Bewertung
- Legitimität der verfolgten Ziele
- Vertretbarkeit der eingesetzten Mittel
- Hinnehmbarkeit der voraussehbaren Folgen
- Lösungsansätze
- Refinement, Replacement, Reduction
- Ethische Grundsätze für Tierärzte ; Deklaration von Helsinki
- Abwägung; Schweregradtabellen
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die ethische Vertretbarkeit von Tierversuchen in Deutschland. Sie analysiert die aktuelle Gesetzeslage, die Geschichte des Tierschutzes und die verschiedenen ethischen Konzepte, die auf Tierversuche angewendet werden können. Ziel ist es, die Kompatibilität von Tierversuchen mit ethischen Ansprüchen zu erörtern und mögliche Lösungsansätze aufzuzeigen.
- Die Geschichte des Tierschutzes und der Tierversuche in Deutschland
- Die aktuelle Rechtslage und die ethischen Anforderungen an Tierversuche
- Die Anwendung verschiedener ethischer Konzepte auf die Problematik der Tierversuche
- Eine ethische Bewertung der Tierversuche unter Berücksichtigung der Legitimität der Ziele, der eingesetzten Mittel und der Folgen
- Mögliche Lösungsansätze zur Reduktion und zum Ersatz von Tierversuchen
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort führt in die Thematik der Tierversuche ein und hebt die Bedeutung von Tieren in Wissenschaft und Forschung hervor. Es werden die hohen Zahlen an jährlich durchgeführten Tierversuchen erwähnt und der ethische Konflikt angesprochen. Die Arbeit fokussiert sich auf die ethische Vertretbarkeit von Tierversuchen, getrennt von der Frage der Nutztierhaltung.
Definition: Tierversuche: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Tierversuche" (Vivisektion), indem es die historische Definition erläutert und auf die operative wissenschaftliche Experimente an lebenden Tieren hinweist. Es betont, dass auch das Töten von Tieren für den Zweck der Versuche unter diese Definition fällt.
Geschichte des Tierschutzes und der Tierversuche: Die Geschichte des Tierschutzes und der Tierversuche wird dargestellt, wobei hervorgehoben wird, dass sich beide Aspekte historisch kaum voneinander trennen lassen. Das Kapitel beleuchtet die Entwicklung der deutschen Tierschutzgesetzgebung, beginnend mit dem Reichstierschutzgesetz von 1933 und der weiteren Entwicklung bis zum Tierschutzgesetz von 1986, das die "ethische Vertretbarkeit" von Tierversuchen fordert. Die Entwicklung der Anzahl der Tierversuche in Deutschland wird anhand von Zahlen illustriert.
Aktuelle gesetzliche Regelungen in Deutschland: Dieses Kapitel beschreibt die aktuellen gesetzlichen Regelungen zum Tierschutz in Deutschland, insbesondere die Anforderungen an Tierversuche gemäß dem Tierschutzgesetz von 2013. Der Begriff der "Mitgeschöpflichkeit" wird erläutert, und die Bedeutung der dreifachen ethischen Abwägung vor der Genehmigung von Tierversuchen wird hervorgehoben. Das Kapitel referiert die gesetzlichen Vorgaben bezüglich unerlässlicher Tierversuche.
Schlüsselwörter
Tierversuche, Tierschutz, Ethik, Gesetzgebung, Gesinnungsethik, Utilitarismus, Speziesismus, ethische Vertretbarkeit, Refinement, Replacement, Reduction, Deutschland, Mitgeschöpflichkeit.
Häufig gestellte Fragen zu: Ethische Vertretbarkeit von Tierversuchen in Deutschland
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die ethische Vertretbarkeit von Tierversuchen in Deutschland. Sie untersucht die aktuelle Gesetzeslage, die Geschichte des Tierschutzes, verschiedene ethische Konzepte und mögliche Lösungsansätze zur Reduktion und zum Ersatz von Tierversuchen. Der Fokus liegt auf der ethischen Bewertung, getrennt von der Frage der Nutztierhaltung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Geschichte des Tierschutzes und der Tierversuche in Deutschland, die aktuelle Rechtslage und ethischen Anforderungen, die Anwendung verschiedener ethischer Konzepte (Kant, Schweitzer, Bentham/Mill, Singer), eine ethische Bewertung unter Berücksichtigung von Zielen, Mitteln und Folgen, sowie mögliche Lösungsansätze wie Refinement, Replacement und Reduction.
Welche ethischen Konzepte werden angewendet?
Die Arbeit wendet verschiedene ethische Konzepte auf die Problematik der Tierversuche an, darunter die Gesinnungsethik Kants, die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben nach Schweitzer, den Utilitarismus von Bentham und Mill, und den Speziesismus nach Singer.
Wie wird die ethische Bewertung vorgenommen?
Die ethische Bewertung der Tierversuche erfolgt anhand dreier Kriterien: der Legitimität der verfolgten Ziele, der Vertretbarkeit der eingesetzten Mittel und der Hinnehmbarkeit der voraussehbaren Folgen.
Welche Lösungsansätze werden vorgeschlagen?
Die Arbeit diskutiert Lösungsansätze wie die 3R-Strategie (Refinement, Replacement, Reduction), ethische Grundsätze für Tierärzte (z.B. Deklaration von Helsinki) und die Verwendung von Schweregradtabellen zur Abwägung.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist die Erörterung der Kompatibilität von Tierversuchen mit ethischen Ansprüchen und die Aufzeigen möglicher Lösungsansätze zur Verbesserung des Tierschutzes im Kontext wissenschaftlicher Forschung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu einem Vorwort, der Definition von Tierversuchen, der Geschichte des Tierschutzes und der Tierversuche, den aktuellen gesetzlichen Regelungen in Deutschland, den negativen Auswirkungen auf Tiere, Menschenversuchen als Alternative, dem Eid des Hippokrates, der Berechtigung von Tierversuchen, ethischen Konzepten, einer ethischen Analyse und Bewertung, Lösungsansätzen und einem Resümee.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Tierversuche, Tierschutz, Ethik, Gesetzgebung, Gesinnungsethik, Utilitarismus, Speziesismus, ethische Vertretbarkeit, Refinement, Replacement, Reduction, Deutschland, Mitgeschöpflichkeit.
Wie wird der Begriff "Tierversuche" definiert?
Tierversuche (Vivisektion) werden definiert als operative wissenschaftliche Experimente an lebenden Tieren, inklusive des Tötens von Tieren für den Zweck der Versuche.
Welche Rolle spielt die deutsche Gesetzgebung?
Die Arbeit beschreibt die Entwicklung der deutschen Tierschutzgesetzgebung, beginnend mit dem Reichstierschutzgesetz von 1933 bis zum aktuellen Tierschutzgesetz von 2013, das die "ethische Vertretbarkeit" von Tierversuchen fordert und die "Mitgeschöpflichkeit" betont.
- Quote paper
- Dipl.-Jur. Univ. , M.A. , M.Sc. Christian Dickenhorst (Author), 2014, Die ethische Vertretbarkeit von Tierversuchen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/283215