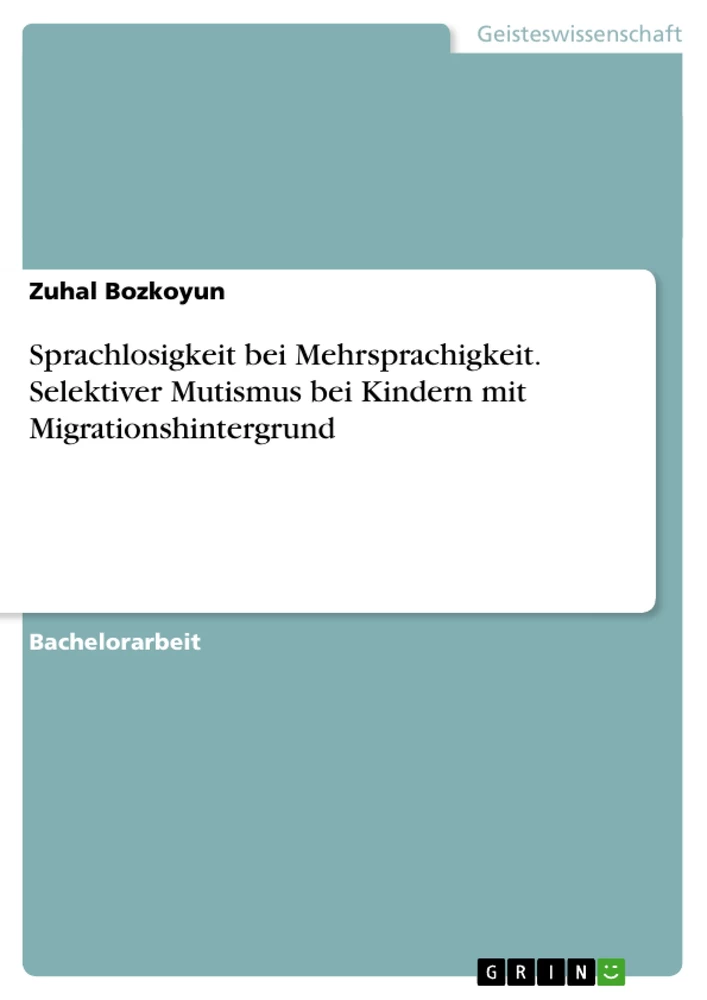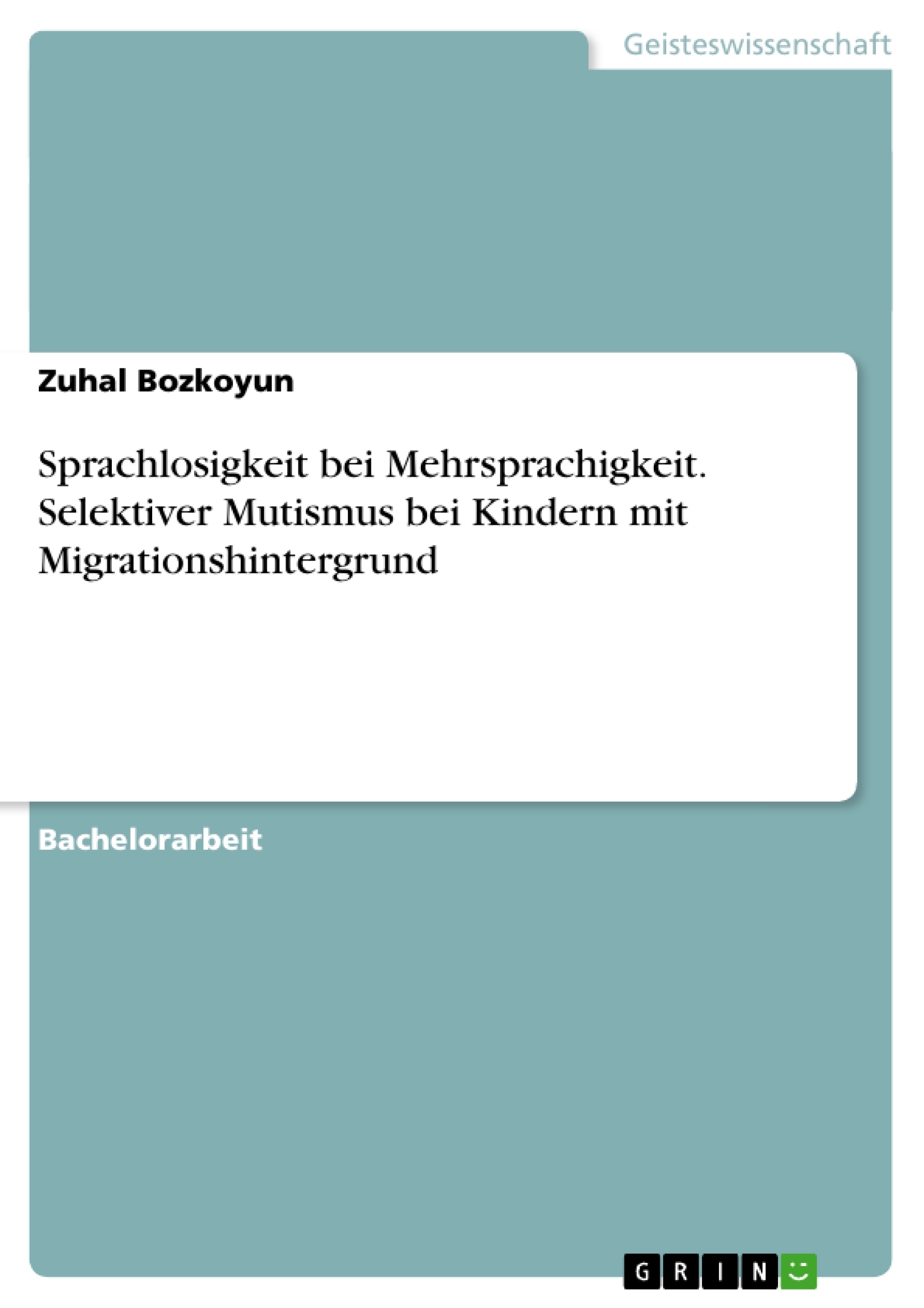Selektiver Mutismus ist ein dauerhaftes Schweigen in bestimmten Situationen, die dem Kind fremd sind, z.B. im Kindergarten, in der Schule und gegenüber bestimmten Personen. Dies betrifft meistens alle Personen, die nicht zum engsten Familienkreis gehören. Das Kind verfügt jedoch über die Fähigkeit mit einigen vertrauten Personen in einem vertrauten Umfeld zu sprechen. Neben einer Behandlung eines Psychotherapeuten und/ oder Sprachtherapeuten bzw. Logopäden kann auch ein adäquater Umgang der anderen pädagogischen Fachkräfte (Schule, Kindergarten etc.) mit dem selektiv mutistischen Kind die Teilhabe am Leben verbessern.
Verschiedene Studien zeigen, dass der Anteil von zwei- und mehrsprachigen Kindern an den selektiv mutistischen Kindern etwa 50% betragen. Die Bewältigung der Mehrsprachigkeit und die Anforderung, das Gefühl der Fremdheit in einer neuen Kultur zu überwinden scheint ein mutistisches Phänomen zu begünstigen. Auch das Leben zwischen zwei Kulturen und zwei Spachen scheint eine starke Stressbedingung zu sein. Diese Faktoren erklären aber nicht allein das Auftreten eines Mutismus. Es ist nicht ganz geklärt welche Faktoren zu einem Selektiven Mutismus führen. Der gegenwärtige Forschungsstand lässt keine lineare, klar abgrenzbare Ätiologie des Selektiven Mutismus zu. Die verschiedenen Fachdisziplinen haben auch unterschiedliche Erklärungen zur Entstehung von Mutismus. Dabei ist zu beachten, dass der Selektive Mutismus von anderen Phänomenen, bei denen ebenfalls geschwiegen wird, abgegrenzt werden sollte. Denn der Selektive Mutismus ist nicht das einzige Phänomen bei denen Kinder schweigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Zielsetzung
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2. Begriff „Selektiver Mutismus“ und „Zweisprachigkeit“
- 3. Definition, Klassifikation und Diagnostik
- 3.1 Klassifikation und Diagnostische Kriterien nach dem ICD-10
- 3.2 Klassifikation und Diagnostische Kriterien nach dem DSM-V
- 3.2.1 Diagnostische Merkmale nach dem DSM-V
- 3.2.2 Zugehörige Merkmale und Störungen
- 3.2.3 Kulturelle diagnostische Merkmale
- 3.2.4 Differentialdiagnose
- 3.3 Diagnostische Erhebung
- 3.3.1 Exploration des Kindes
- 3.3.2 Untersuchungsablauf
- 4. Epidemiologie und Prävalenz
- 5. Mutismusarten
- 6. Komorbidität, Risikofaktoren und Ätiologie
- 6.1 Komorbidität bei Mehrsprachigkeit und Migrationshintergrund
- 6.2 Risikofaktoren und Ätiologie
- 6.2.1 Biologische Prädisposition
- 6.2.2 Sprachliches Überforderungsverhalten
- 6.2.3 Risikofaktor Mehrsprachigkeit und Migrationshintergrund
- 6.2.4 Innerfamiliäre Lernerfahrungen
- 6.2.5 Außerfamiliäre Lernerfahrungen
- 7. Störungsverlauf
- 7.1 Funktionelle Konsequenzen des Selektiven Mutismus
- 7.2 Sprachentwicklung und Sprechverhalten
- 8. Andere Gründe für das Schweigen eines Kindes
- 8.1 Abgrenzung zum Autismus
- 8.2 Abgrenzung zur Sprechangst
- 8.3 Abgrenzung zur ausgeprägten Schüchternheit
- 8.4 Abgrenzung zur Spracherwerbsstörung
- 8.5 Abgrenzung zu Sprachstörungen und Stottern
- 8.6 Abgrenzung zum Schweigen in emotional schwierigen Situationen
- 8.7 Abgrenzung zum Schweigen in der fremden Sprache
- 8.8 Abgrenzung zum Reaktiven Schweigen
- 9. Therapiemöglichkeiten
- 9.1 Kognitiv-behaviorale Mutismustherapie
- 9.2 Therapeutischer Ansatz von Katz-Bernstein
- 9.3 Umgang mit einem selektiv mutistischen Kind im Kindergarten
- 9.4 Umgang mit einem selektiv mutistischen Kind in der Schule
- 10. Soziale Arbeit und Selektiver Mutismus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den selektiven Mutismus bei Kindern mit Migrationshintergrund, insbesondere im Hinblick auf den Einfluss der Mehrsprachigkeit. Die Arbeit zielt darauf ab, die bestehenden Forschungslücken zu diesem Thema zu schließen und die Frage zu klären, ob die Diagnose „Selektiver Mutismus“ bei mehrsprachigen Kindern zu schnell gestellt wird und ob alternative Erklärungen für Sprachlosigkeit in Betracht gezogen werden müssen.
- Selektiver Mutismus bei Kindern mit Migrationshintergrund
- Der Einfluss der Mehrsprachigkeit auf die Entstehung und Diagnose von Selektivem Mutismus
- Differenzialdiagnostik von Selektivem Mutismus und anderen Ursachen für Sprachlosigkeit
- Therapiemöglichkeiten und sozialarbeiterische Interventionen
- Risikofaktoren und Ätiologie des Selektiven Mutismus im Kontext von Mehrsprachigkeit und Migration
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des selektiven Mutismus ein und betont die Bedeutung des Schweigens als Kommunikationsform. Sie beleuchtet die Problematik des beharrlichen Schweigens bei Kindern und skizziert die Forschungsfrage nach möglichen Ursachen, insbesondere bei mehrsprachigen Kindern mit Migrationshintergrund. Die eigene zweisprachige Herkunft der Autorin motiviert die Untersuchung, die auf die mögliche Fehldiagnose von Selektivem Mutismus hinweist, wenn andere Faktoren wie sprachliche Überforderung oder kulturelle Unterschiede nicht berücksichtigt werden.
2. Begriff „Selektiver Mutismus“ und „Zweisprachigkeit“: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe „Selektiver Mutismus“ und „Zweisprachigkeit“ und setzt den Kontext für die weitere Arbeit. Es etabliert die begriffliche Grundlage und differenziert den selektiven Mutismus von anderen Kommunikationsstörungen. Die Definition der Zweisprachigkeit legt den Fokus auf den sprachlichen Kontext der untersuchten Kinder und die Herausforderungen, die Mehrsprachigkeit mit sich bringen kann.
3. Definition, Klassifikation und Diagnostik: Dieses Kapitel beschreibt die Definition, Klassifizierung und Diagnostik des selektiven Mutismus nach ICD-10 und DSM-V. Es detailliert die diagnostischen Kriterien, zugehörige Merkmale und Störungen, sowie kulturelle Aspekte der Diagnose. Der Abschnitt zur differenzialdiagnostischen Abgrenzung von anderen Störungen (z.B. Autismus, Sprechangst) ist von besonderer Bedeutung, um Fehldiagnosen zu vermeiden. Die diagnostische Erhebung wird anhand der Exploration des Kindes und des Untersuchungsablaufs dargelegt.
4. Epidemiologie und Prävalenz: Kapitel 4 befasst sich mit der Verbreitung und Häufigkeit des selektiven Mutismus in der Bevölkerung. Es werden relevante epidemiologische Daten präsentiert und diskutiert, um ein umfassendes Bild der Erkrankungshäufigkeit zu zeichnen und potenzielle Risikogruppen zu identifizieren. Der Fokus liegt wahrscheinlich auf der Prävalenz bei Kindern mit Migrationshintergrund.
5. Mutismusarten: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Arten des Mutismus und differenziert zwischen verschiedenen Ausprägungen und Ursachen. Es schafft ein differenziertes Verständnis der Phänomene und ihrer unterschiedlichen Hintergründe. Die verschiedenen Arten werden im Hinblick auf ihre klinischen Merkmale und die Implikationen für die Diagnose und Behandlung beschrieben.
6. Komorbidität, Risikofaktoren und Ätiologie: Kapitel 6 erörtert die häufigen Begleiterkrankungen (Komorbidität) des selektiven Mutismus bei mehrsprachigen Kindern mit Migrationshintergrund, sowie die Risikofaktoren und die Ursachen (Ätiologie) der Störung. Hier werden biologische Prädispositionen, sprachliche Überforderung, der Einfluss der Mehrsprachigkeit selbst, innerfamiliäre und außerfamiliäre Lernerfahrungen als potenzielle Faktoren analysiert. Der Abschnitt zeigt die komplexen Zusammenhänge und Interaktionen verschiedener Faktoren auf, die zur Entstehung des selektiven Mutismus beitragen können.
7. Störungsverlauf: Kapitel 7 analysiert den Verlauf des selektiven Mutismus, einschließlich der funktionalen Konsequenzen und des Einflusses auf die Sprachentwicklung und das Sprechverhalten. Es wird untersucht, wie sich die Störung im Laufe der Zeit manifestiert und welche langfristigen Auswirkungen sie haben kann. Die Auswirkungen auf den Alltag und die soziale Integration des Kindes werden beleuchtet.
8. Andere Gründe für das Schweigen eines Kindes: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die differenzialdiagnostische Abgrenzung des selektiven Mutismus von anderen Störungen und Verhaltensweisen, die zu Sprachlosigkeit oder reduziertem Sprechen führen können (Autismus, Sprechangst, Schüchternheit, Spracherwerbsstörung, Sprachstörungen, Stottern, Schweigen in emotional schwierigen Situationen, Schweigen in der fremden Sprache, Reaktives Schweigen). Es wird deutlich, wie wichtig eine differenzierte Betrachtungsweise ist, um die richtige Diagnose zu stellen und eine effektive Therapie einzuleiten.
9. Therapiemöglichkeiten: Kapitel 9 stellt verschiedene Therapiemöglichkeiten für selektiven Mutismus vor, einschließlich kognitiv-behavioraler Ansätze und des therapeutischen Ansatzes von Katz-Bernstein. Es werden darüber hinaus Strategien für den Umgang mit selektiv mutistischen Kindern im Kindergarten und in der Schule vorgestellt. Die Auswahl und Anwendung der Therapiemethoden wird im Kontext der individuellen Bedürfnisse des Kindes und seines Umfelds diskutiert.
10. Soziale Arbeit und Selektiver Mutismus: Dieses Kapitel betrachtet die Rolle der Sozialen Arbeit in der Unterstützung von Kindern mit selektivem Mutismus und ihren Familien. Es werden die relevanten Aufgaben und Interventionen sozialer Arbeit im Kontext der Erkrankung dargestellt, um ein ganzheitliches und multiprofessionelles Vorgehen zu ermöglichen.
Schlüsselwörter
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Selektiver Mutismus bei mehrsprachigen Kindern mit Migrationshintergrund
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht den selektiven Mutismus bei Kindern mit Migrationshintergrund, insbesondere den Einfluss der Mehrsprachigkeit auf die Entstehung und Diagnose dieser Störung. Ein Schwerpunkt liegt auf der Frage, ob die Diagnose zu schnell gestellt wird und alternative Erklärungen für Sprachlosigkeit berücksichtigt werden müssen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst eine umfassende Darstellung des selektiven Mutismus, beginnend mit der Definition und Klassifikation nach ICD-10 und DSM-V, über die Epidemiologie und Prävalenz, verschiedene Mutismusarten, Komorbidität, Risikofaktoren und Ätiologie im Kontext von Mehrsprachigkeit und Migration, den Störungsverlauf und dessen funktionale Konsequenzen, bis hin zu einer differenzialdiagnostischen Abgrenzung zu anderen Störungen und verschiedenen Therapiemöglichkeiten sowie der Rolle der Sozialen Arbeit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in zehn Kapitel gegliedert: Einleitung, Definition der zentralen Begriffe, Definition, Klassifikation und Diagnostik, Epidemiologie und Prävalenz, Mutismusarten, Komorbidität, Risikofaktoren und Ätiologie, Störungsverlauf, andere Gründe für das Schweigen eines Kindes, Therapiemöglichkeiten und die Rolle der Sozialen Arbeit. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit basiert auf einer Literaturrecherche und einer systematischen Auswertung relevanter wissenschaftlicher Publikationen. Es wird eine umfassende Darstellung des aktuellen Forschungsstandes zum selektiven Mutismus bei mehrsprachigen Kindern mit Migrationshintergrund geliefert. Die angewandte Methode ist deskriptiv und analytisch.
Welche zentralen Begriffe werden definiert?
Die Arbeit definiert die Begriffe "Selektiver Mutismus" und "Zweisprachigkeit" und setzt diese in den Kontext der weiteren Untersuchung. Es wird klar zwischen selektivem Mutismus und anderen Kommunikationsstörungen unterschieden.
Wie wird die Diagnostik des selektiven Mutismus beschrieben?
Die Arbeit beschreibt die diagnostischen Kriterien nach ICD-10 und DSM-V, inklusive zugehöriger Merkmale, kultureller Aspekte und der wichtigen Differentialdiagnose zu anderen Störungen wie Autismus, Sprechangst oder Spracherwerbsstörungen. Der diagnostische Prozess wird detailliert dargestellt, inklusive der Exploration des Kindes und des Untersuchungsablaufs.
Welche Risikofaktoren und Ursachen für selektiven Mutismus werden diskutiert?
Die Arbeit analysiert biologische Prädispositionen, sprachliche Überforderung, den Einfluss der Mehrsprachigkeit, innerfamiliäre und außerfamiliäre Lernerfahrungen als potenzielle Risikofaktoren und Ursachen. Die komplexen Zusammenhänge und Interaktionen dieser Faktoren werden beleuchtet.
Welche Therapiemöglichkeiten werden vorgestellt?
Die Arbeit stellt verschiedene Therapiemöglichkeiten vor, darunter kognitiv-behaviorale Ansätze und den therapeutischen Ansatz von Katz-Bernstein. Zusätzlich werden Strategien für den Umgang mit selektiv mutistischen Kindern im Kindergarten und in der Schule beschrieben.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit?
Die Arbeit beschreibt die Rolle der Sozialen Arbeit bei der Unterstützung von Kindern mit selektivem Mutismus und ihren Familien, indem sie relevante Aufgaben und Interventionen im Kontext der Erkrankung darstellt.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die Diagnose "Selektiver Mutismus" bei mehrsprachigen Kindern kritisch hinterfragt werden sollte und alternative Erklärungen für Sprachlosigkeit in Betracht gezogen werden müssen. Der Einfluss von Mehrsprachigkeit und Migrationshintergrund auf die Entstehung und den Verlauf des selektiven Mutismus wird betont. Die Notwendigkeit eines ganzheitlichen und multiprofessionellen Vorgehens wird hervorgehoben.
- Quote paper
- Bachelor o.A. Zuhal Bozkoyun (Author), 2014, Sprachlosigkeit bei Mehrsprachigkeit. Selektiver Mutismus bei Kindern mit Migrationshintergrund, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/282769