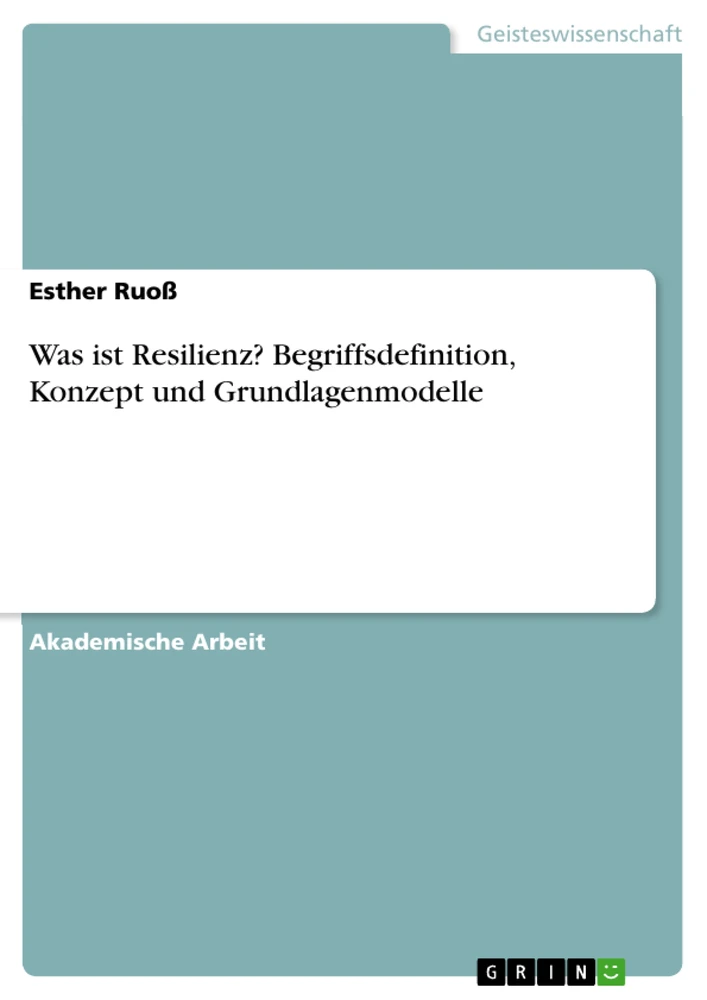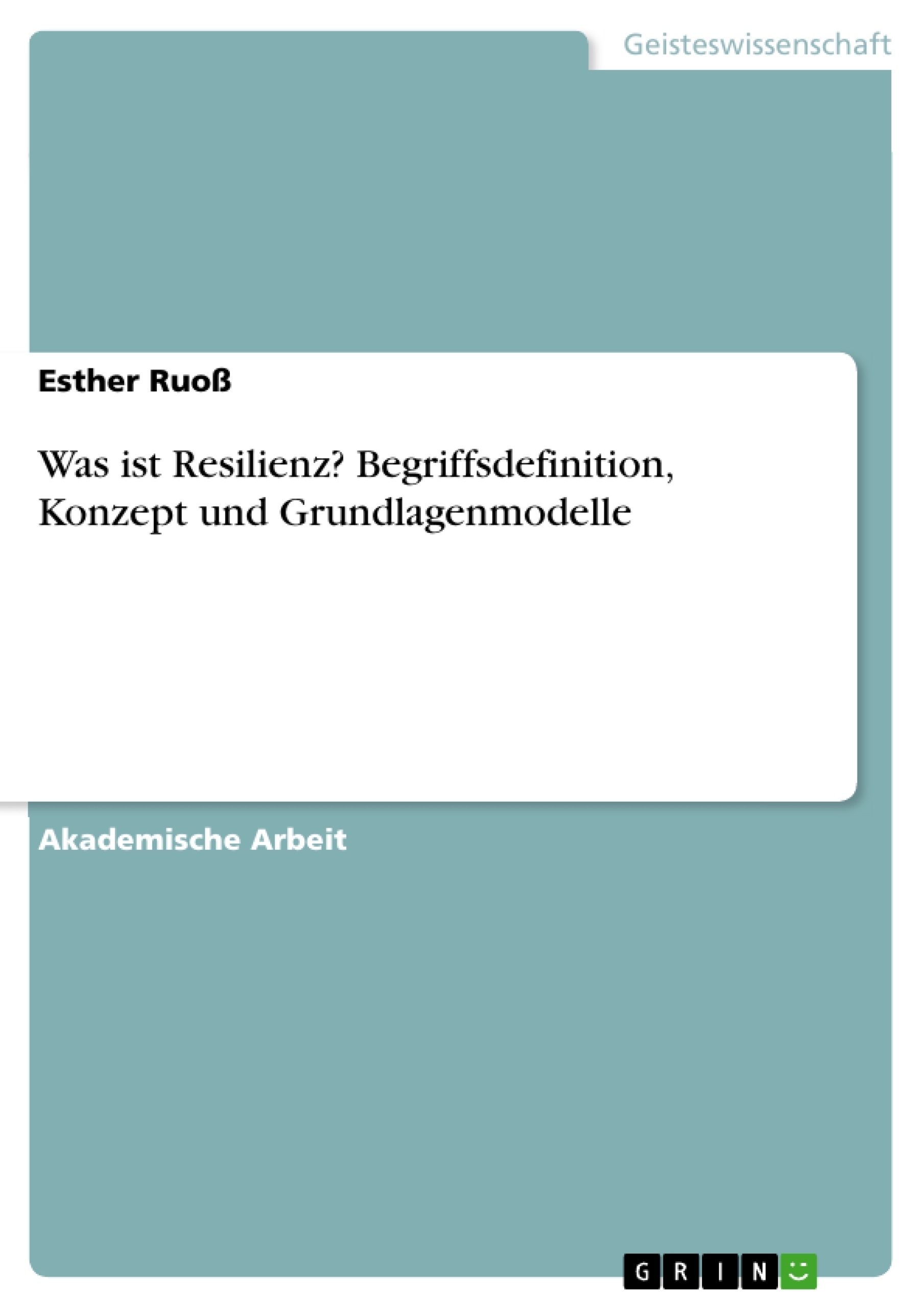Kinder, die früh lernen, mit Schwierigkeiten, Krisen und problematischen Lebensumständen umzugehen, haben trotz schwieriger Ausgangsbedingungen die Chance, alle Widrigkeiten zu meistern und sich positiv zu entwickeln. Vor allem diejenigen Kinder, die vielerlei Problemen ausgesetzt sind, wie z.B. Vernachlässigung, Scheidung der Eltern und Gewalterfahrungen, haben Unterstützung besonders nötig, um sich zu belastbaren Persönlichkeiten zu entwickeln, die unter den Widrigkeiten ihrer Kindheit nicht zerbrechen, sondern gestärkt daraus hervorgehen. Eine solche Widerstandsfähigkeit in vorübergehenden oder lang andauernden Krisen wird in der Wissenschaft als Resilienz bezeichnet.
Aus dem Inhalt:
- Entwicklung des Resilienzkonzeptes
- Risiko- und Schutzfaktorenmodell
- Resilienzmodelle
- Kritik am Modell der Resilienz
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Definition
- Was meint „Resilienz“?
- Wie sieht die Resilienzforschung den Menschen?
- Bezugsmodelle
- Salutogenese
- Vulnerabilität
- Selbstwirksamkeit
- Bindungstheorie
- Entwicklung des Resilienzkonzepts
- Zentrale Kennzeichen des Resilienzparadigmas
- Risiko- und Schutzfaktorenmodell
- Risikofaktorenmodell
- Schutzfaktorenmodell
- Risiko- und Schutzmechanismen
- Risikomechanismen
- Schutzmechanismen
- Resilienzmodelle
- Modell der Kompensation
- Modell der Herausforderung
- Modell der Interaktion
- Modell der Kumulation
- Kritik am Konzept der Resilienz
- Literaturverzeichnis (inklusive weiterführender Literatur)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Konzept der Resilienz. Ziel ist es, den Begriff zu definieren, verschiedene theoretische Modelle vorzustellen und die zentralen Aspekte des Resilienzparadigmas zu erläutern. Die Arbeit analysiert sowohl Risiko- als auch Schutzfaktoren und -mechanismen, die die Entwicklung von Resilienz beeinflussen.
- Definition und Abgrenzung des Resilienzbegriffs
- Theoretische Bezugsmodelle der Resilienzforschung
- Risiko- und Schutzfaktoren im Kontext von Resilienz
- Verschiedene Modelle zur Erklärung von Resilienz
- Kritikpunkte am Resilienzkonzept
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die gängige, aber mittlerweile überholte Sichtweise dar, dass schwierige Kindheitserfahrungen zwangsläufig zu psychischen Problemen im Erwachsenenalter führen. Sie führt die Resilienzforschung als Gegenentwurf ein und erwähnt Studien, die belegen, dass ein erheblicher Teil von Kindern, die unter schwierigen Bedingungen aufwuchsen, dennoch ein glückliches und erfolgreiches Leben führen. Dies unterstreicht die Bedeutung des Konzepts der Resilienz und die Notwendigkeit seiner weiteren Erforschung.
Definition: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Resilienz“, abgeleitet vom englischen Wort „resilience“, als Widerstandsfähigkeit und Fähigkeit, nach belastenden Erfahrungen wieder ins Gleichgewicht zurückzufinden. Es werden verschiedene Definitionen aus der pädagogischen und psychologischen Literatur vorgestellt, die den Begriff im Kontext von Bewältigungsstrategien und psychischer Gesundheit trotz hoher Risikobelastung einordnen. Der Fokus liegt auf der Fähigkeit, mit Schwierigkeiten positiv umzugehen und nicht daran zu zerbrechen.
Bezugsmodelle: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Bezugsmodelle, die das Verständnis von Resilienz erweitern. Es werden Konzepte wie Salutogenese (Gesundheitsorientierung), Vulnerabilität (Verwundbarkeit), Selbstwirksamkeit und Bindungstheorie diskutiert. Diese Modelle beleuchten unterschiedliche Aspekte, die zur Entwicklung von Resilienz beitragen oder diese beeinträchtigen können, und stellen somit ein breites Spektrum an Einflussfaktoren vor.
Entwicklung des Resilienzkonzepts: Hier wird die historische Entwicklung des Resilienzkonzepts nachgezeichnet, beginnend von frühen Annahmen über den prägenden Einfluss der Kindheit bis hin zur aktuellen Forschung. Es wird vermutlich auf die Entstehung und Weiterentwicklung des Forschungsfeldes eingegangen und der Wandel der Perspektiven auf Resilienz erläutert.
Zentrale Kennzeichen des Resilienzparadigmas: Dieses Kapitel beleuchtet die zentralen Merkmale des Resilienzparadigmas. Es wird vermutlich auf die wichtigsten Eigenschaften resilienten Verhaltens und die damit verbundenen Prozesse eingegangen. Wahrscheinlich werden sowohl individuelle als auch soziale Faktoren betont, die die Entwicklung und Aufrechterhaltung von Resilienz fördern.
Risiko- und Schutzfaktorenmodell: Dieses Kapitel unterscheidet zwischen Risikofaktoren, die die Wahrscheinlichkeit für negative Entwicklungen erhöhen, und Schutzfaktoren, die diese Wahrscheinlichkeit verringern. Es werden verschiedene Beispiele für beide Faktoren diskutiert und deren Zusammenspiel im Kontext der Resilienzentwicklung analysiert.
Risiko- und Schutzmechanismen: Hier wird vermutlich ein tieferer Einblick in die Mechanismen gegeben, die hinter Risiko- und Schutzfaktoren stehen. Es werden wahrscheinlich die Prozesse und Strategien beschrieben, durch die Risikofaktoren zu negativen Ergebnissen und Schutzfaktoren zu positiven Ergebnissen führen. Das Kapitel wird vermutlich individuelles Coping und soziale Unterstützung beleuchten.
Resilienzmodelle: Dieses Kapitel stellt verschiedene Modelle vor, die versuchen, das Phänomen der Resilienz zu erklären. Es wird sich wahrscheinlich mit unterschiedlichen theoretischen Ansätzen beschäftigen und die jeweiligen Stärken und Schwächen beleuchten. Die Modelle könnten beispielsweise die Kompensation, Herausforderung, Interaktion oder Kumulation von Faktoren betonen.
Schlüsselwörter
Resilienz, Widerstandsfähigkeit, psychische Gesundheit, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, Bewältigungsmechanismen, Entwicklung, Bindung, Selbstwirksamkeit, Salutogenese, Vulnerabilität, Resilienzmodelle, Kindheit, Krisenbewältigung.
Häufig gestellte Fragen zu "Resilienz: Ein umfassender Überblick"
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über das Konzept der Resilienz. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Glossar mit Schlüsselbegriffen. Der Fokus liegt auf der Definition von Resilienz, der Vorstellung verschiedener theoretischer Modelle, der Analyse von Risiko- und Schutzfaktoren sowie der kritischen Auseinandersetzung mit dem Konzept.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung des Resilienzbegriffs, theoretische Bezugsmodelle (Salutogenese, Vulnerabilität, Selbstwirksamkeit, Bindungstheorie), die Entwicklung des Resilienzkonzepts, zentrale Kennzeichen des Resilienzparadigmas, Risiko- und Schutzfaktoren/-mechanismen, verschiedene Resilienzmodelle (Kompensation, Herausforderung, Interaktion, Kumulation) und Kritikpunkte am Resilienzkonzept.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text ist in Kapitel unterteilt, die jeweils durch eine Zusammenfassung erläutert werden. Die Kapitel behandeln die Definition von Resilienz, relevante Bezugsmodelle, die historische Entwicklung des Konzepts, Risiko- und Schutzfaktoren, verschiedene Erklärungsmodelle und kritische Anmerkungen. Zusätzlich enthält der Text ein Inhaltsverzeichnis, eine Einleitung mit Zielsetzung und Themenschwerpunkten sowie ein Glossar mit Schlüsselbegriffen.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Text erläutert?
Schlüsselbegriffe des Textes sind: Resilienz, Widerstandsfähigkeit, psychische Gesundheit, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, Bewältigungsmechanismen, Entwicklung, Bindung, Selbstwirksamkeit, Salutogenese, Vulnerabilität, Resilienzmodelle, Kindheit und Krisenbewältigung.
Welche Modelle zur Erklärung von Resilienz werden vorgestellt?
Der Text stellt verschiedene Modelle zur Erklärung von Resilienz vor, darunter das Modell der Kompensation, das Modell der Herausforderung, das Modell der Interaktion und das Modell der Kumulation. Diese Modelle betrachten unterschiedliche Aspekte und Mechanismen, die zur Entwicklung und Aufrechterhaltung von Resilienz beitragen.
Welche Kritikpunkte am Resilienzkonzept werden angesprochen?
Der Text erwähnt, dass auch kritische Anmerkungen zum Resilienzkonzept behandelt werden. Die genauen Kritikpunkte werden in der Zusammenfassung des entsprechenden Kapitels jedoch nicht im Detail aufgeführt.
Für wen ist dieser Text geeignet?
Dieser Text ist für Leser geeignet, die sich umfassend über das Konzept der Resilienz informieren möchten, einschließlich der theoretischen Grundlagen, der empirischen Forschung und der kritischen Diskussion. Der Text eignet sich für Studierende, Wissenschaftler und alle anderen, die sich für dieses Thema interessieren.
Wo finde ich weitere Informationen?
Der Text enthält ein Literaturverzeichnis, welches weiterführende Literatur zum Thema Resilienz auflistet. Dieses Literaturverzeichnis ermöglicht es den Lesern, sich tiefergehend mit einzelnen Aspekten des Konzepts auseinanderzusetzen.
- Quote paper
- Diplom-Sozialarbeiterin / Sozialpädagogin Esther Ruoß (Author), 2007, Was ist Resilienz? Begriffsdefinition, Konzept und Grundlagenmodelle, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/282499