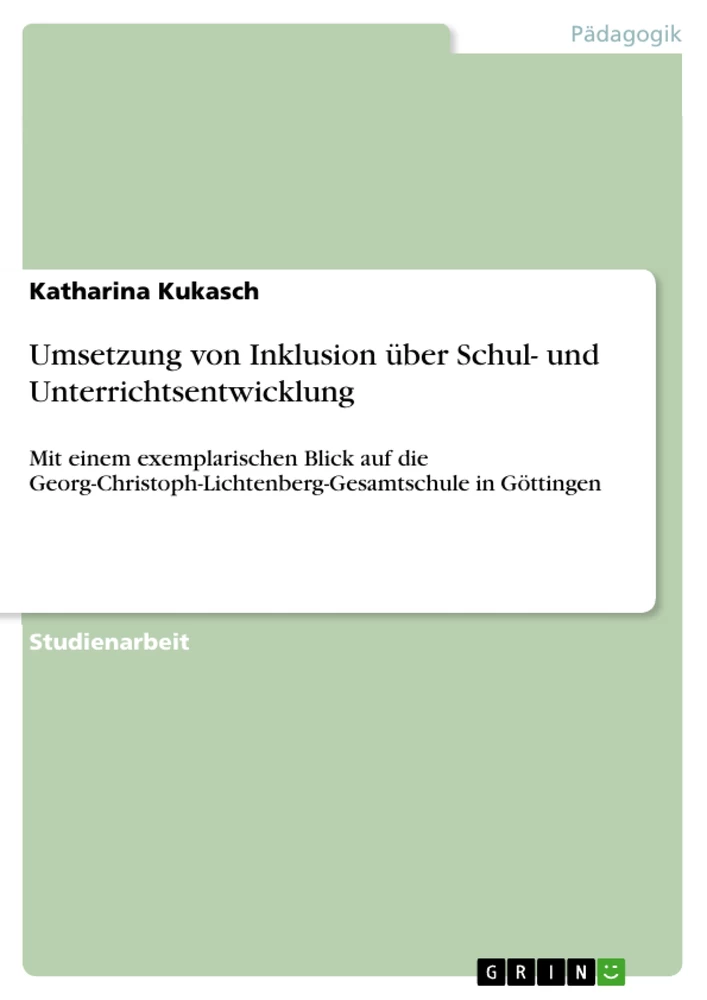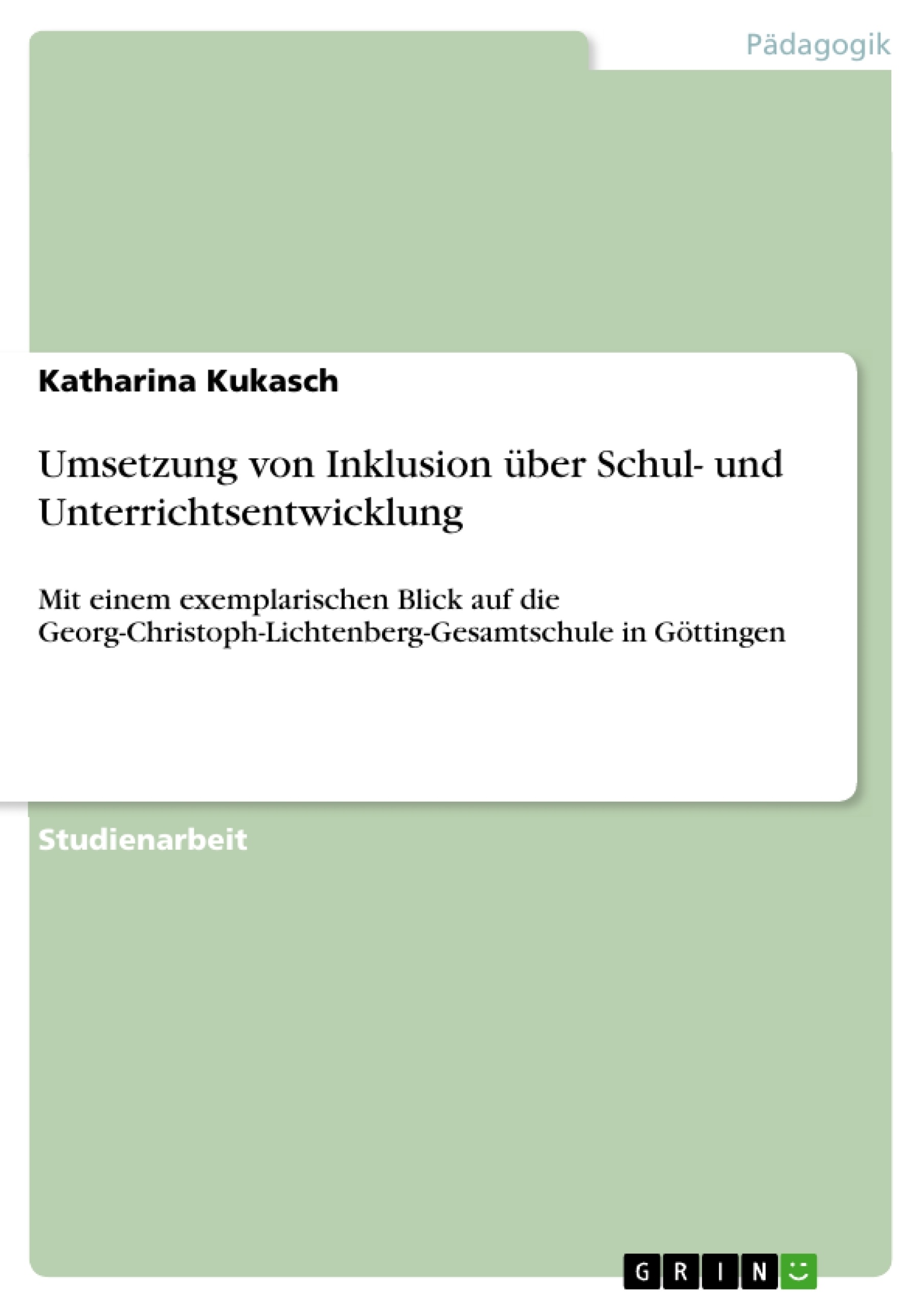Schon seit Menschenbeginn ist es eine existente Tatsache, dass Gesellschaften geprägt sind von Heterogenität ihrer einzelnen Mitglieder. Ein adäquater Umgang damit, vor allem in bildungspolitischer Hinsicht, gerät jedoch erst seit verhältnismäßig kurzer Zeit in den Fokus der Diskussion und hat auch im Jahr 2014 noch keine zufriedenstellende Vollendung erreicht. Das Ziel dieser Arbeit ist es, einen Teilaspekt der in vielerlei Hinsicht von Heterogenität geprägten Gesellschaft in Deutschland, nämlich die gemeinsame Schulbildung behinderter und nicht behinderter Kinder, mit dem Fokus auf den weiterführenden Schulen, genauer zu betrachten – und zwar im Zuge der Inklusion. Diese Arbeit wird die Inklusion in Deutschland sowohl vor dem Hintergrund der Schul- als auch vor dem Hintergrund der Unterrichtsentwicklung betrachten. Welche Voraussetzungen müssen geschaffen und welche Maßnahmen ergriffen werden, damit die Inklusion im deutschen Bildungswesen gelingen kann? Da es bereits Beispiele von Schulen gibt, die Inklusion schon über einen langen Zeitraum betreiben, besteht diese Arbeit aus einem theoretischen und einem an einem konkreten Beispiel orientierten Teil.
Im theoretischen Teil wird zunächst der Begriff der Inklusion definiert und bestimmt, um eine fundierte, wissenschaftlich begründete begriffliche Basis der Ausführungen zu schaffen, dann wird die historische Entwicklung der Inklusion nachgezeichnet, um anschließend den Blick auf die notwendigen strukturellen und organisatorischen Veränderungen der Schulentwicklung und der Unterrichtsentwicklung zu richten, die erforderlich sind, damit eine Schule sich in eine inklusive Richtung bewegen kann. (...)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund
- Definition und Ansprüche von Inklusion
- Historische Entwicklung – Von der Separation zur Inklusion
- Notwendige Veränderungen auf struktureller Ebene der Schulentwicklung
- Barrierefreies Lernen
- Personelle Ausstattung - notwendige Veränderungen in der Lehreraus- und Lehrerweiterbildung
- Der Index für Inklusion
- Notwendige Veränderungen auf Ebene der Unterrichtsentwicklung
- Organisatorische Aspekte des Unterrichts
- Didaktische Aspekte des Unterrichts
- Die Lernumgebung
- Die Rolle der Lehrperson(en)
- Die praktische Umsetzung am Beispiel der Georg-Christoph Lichtenberg-Gesamtschule in Göttingen
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Inklusion im deutschen Bildungswesen, insbesondere im Kontext der weiterführenden Schulen. Sie analysiert die notwendigen Veränderungen auf Ebene der Schul- und Unterrichtsentwicklung, um eine inklusive Schulkultur zu ermöglichen. Die Arbeit betrachtet die Inklusion sowohl aus theoretischer Perspektive als auch anhand eines konkreten Beispiels, der Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule in Göttingen.
- Definition und Ansprüche von Inklusion
- Historische Entwicklung der Inklusion
- Notwendige Veränderungen in der Schulentwicklung
- Notwendige Veränderungen in der Unterrichtsentwicklung
- Praxisbeispiel der Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule in Göttingen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Inklusion ein und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Sie stellt die Relevanz des Themas im Kontext der Heterogenität der Gesellschaft dar und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Der theoretische Hintergrund beleuchtet den Begriff der Inklusion und seine Ansprüche. Er zeichnet die historische Entwicklung der Inklusion nach und analysiert die notwendigen Veränderungen auf Ebene der Schul- und Unterrichtsentwicklung. Im Fokus stehen dabei die strukturellen und organisatorischen Veränderungen, die erforderlich sind, um eine inklusive Schulkultur zu ermöglichen. Die Kapitel behandeln Themen wie Barrierefreies Lernen, Personelle Ausstattung, den Index für Inklusion, organisatorische und didaktische Aspekte des Unterrichts, die Lernumgebung und die Rolle der Lehrperson(en).
Der praktische Teil der Arbeit widmet sich der Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule in Göttingen als Beispielschule für Inklusion. Er analysiert die konkreten Maßnahmen und Voraussetzungen, die die Schule geschaffen hat, um eine inklusive Schulkultur zu etablieren. Die Analyse betrachtet sowohl die Ebene der Schulentwicklung als auch die Ebene der Unterrichtsentwicklung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Inklusion, Schulentwicklung, Unterrichtsentwicklung, Heterogenität, Barrierefreies Lernen, Personelle Ausstattung, Index für Inklusion, Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule Göttingen, inklusive Schulkultur, gemeinsames Lernen, sonderpädagogischer Förderbedarf.
- Arbeit zitieren
- B.A. Katharina Kukasch (Autor:in), 2014, Umsetzung von Inklusion über Schul- und Unterrichtsentwicklung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/282450