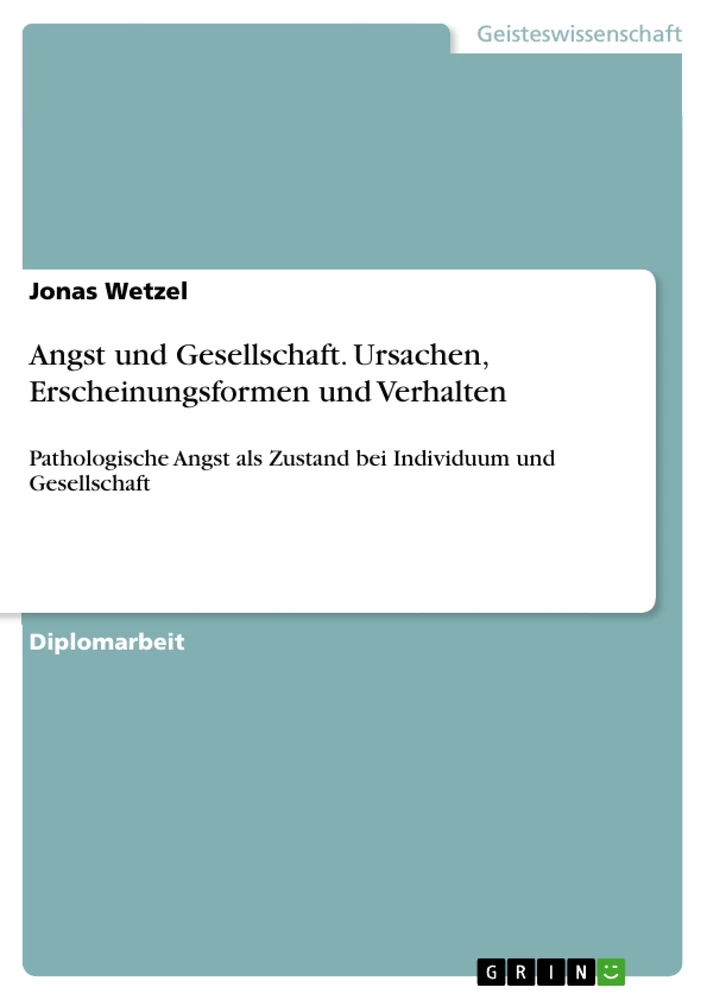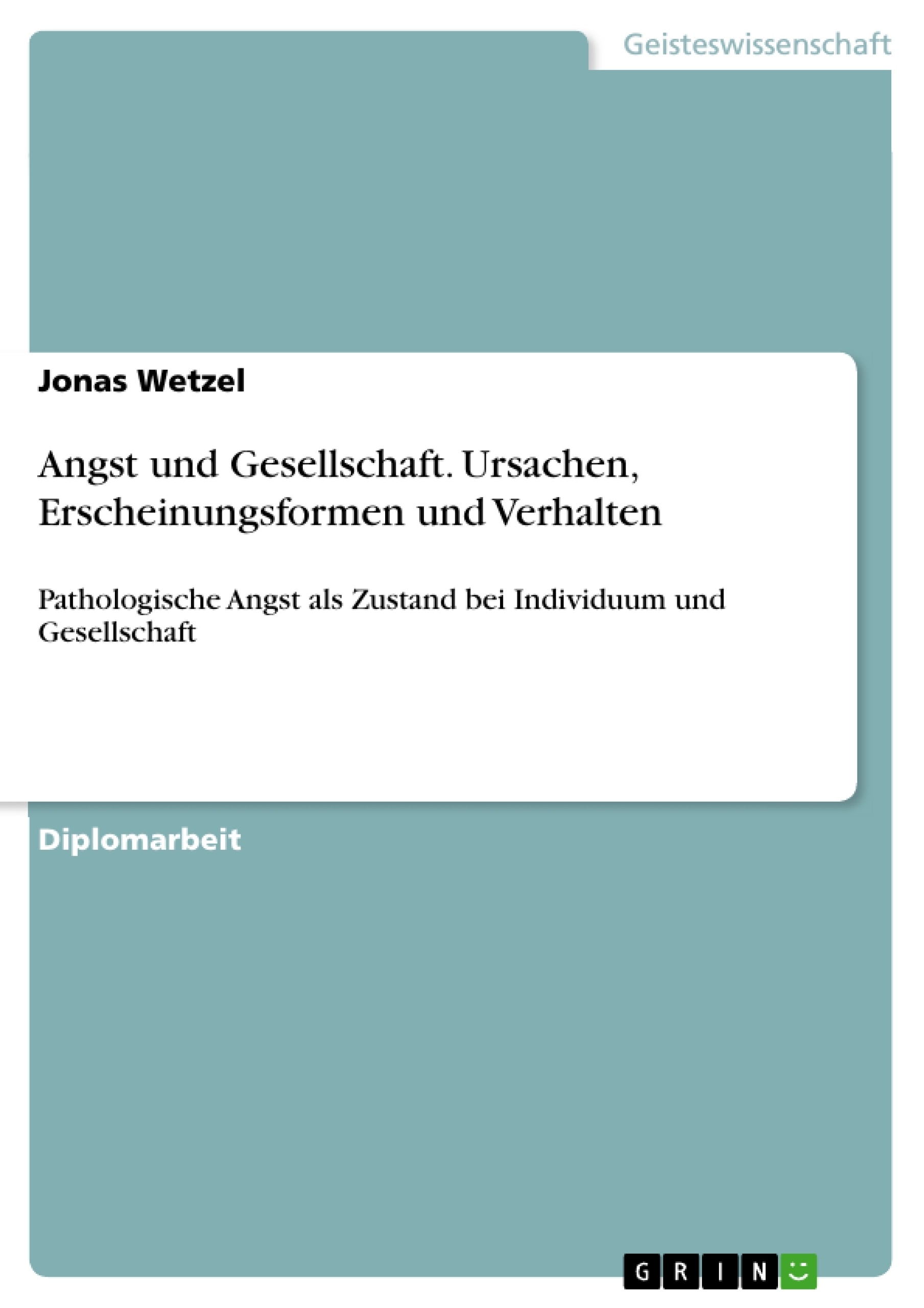Angst, diese „urmenschliche“ Emotion, die sich von „Enge“ ableitet, beschreibt einen beklemmenden, bedrückenden Zustand, der dem Menschen wohl von jeher zu eigen ist. Oft ist nicht klar, worauf sich die Angst eigentlich bezieht, denn im Gegensatz zum Begriff der Furcht ist sie oft diffus und kann bei häufigem und gesteigertem Auftreten in Störungen und Krankheiten münden. Das immanente Risiko, das in der Freiheit, im Möglichen, liegt, birgt die Gefahr, die Angst aufzuwerten und überlebensgroß zu machen und die Flucht vor derselben zur Standardreaktion werden zu lassen. Die „Angst vor der Angst“ als eine häufige Kettenreaktion bei jenen Menschen, die besonders danach streben, die negativen Begleiterscheinungen des physischen und psychischen Erlebens zu verhindern, ist bezeichnend für das Dilemma. Die erlebte Intensität und die Häufigkeit von Angstgefühlen zeugen von bestimmten Unzulänglichkeiten, die oft ähnlich einer Depression, Menschen von ihrer Umwelt abspalten. Besonderes Gewicht in der Frage der Angstdominanz innerhalb der individuellen, als auch kollektiven Wahrnehmung liegt in der kulturellen Situation. So sind viele Ängste gekoppelt an vorherrschende Werte und Normen, an gesellschaftliche Bedingungen, die z.B. durch Entfremdungsprozesse (Konsumorientierung, technische Entwicklungen, Bürokratisierung etc.) den Einzelnen der ihm eigenen Problemlösungskompetenz berauben und die Ohnmächtigkeit fördern. Hier offenbaren sich zentrale Probleme unserer modernen Leistungsgesellschaft, die sich ebenfalls in der eng verwandten Stress-Problematik äussern. Der Angst muß deshalb auf kollektiver, gesellschaftlicher Ebene mit passenden Maßnahmen (etwa Integration fördern statt Ausgrenzung) begegnet, als auch im individuellen Erleben widerstanden werden. In der Befähigung, sich der Angst zu stellen und in deren Überwindung liegt die Chance einer Begegnung mit der „positiven“ Freiheit. Der Umgang mit der Angst ist und bleibt eine der schwierigsten Entwicklungsaufgaben des menschlichen Selbsts.
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG
- 2 ZUM BEGRIFF DER ANGST
- 2.1 Angst: Ein menschliches Phänomen des Seins
- 2.2 Angst bei Kierkegaard
- 2.3 Angst im neurobiologischen, neuropsychologischen und lerntheoretischen Kontext
- 2.4 Angst als biologische Erscheinung
- 3 ANGST ALS KRANKHEIT - ANGST IM ÜBERMAẞ
- 3.1 Normale und abnormale? - reale und krankhafte Angst
- 3.2 Die (klinischen) Angststörungen
- 3.2.1 Die neurotische Angst
- 3.2.2 Phobische Ängste
- 3.2.3 Agoraphobie
- 3.2.4 Soziale Phobie
- 3.2.5 Panikstörungen
- 3.2.6 Zwangskrankheiten
- 3.2.7 (Post)Traumatische Belastungsstörungen
- 3.3 Angst und Depression
- 4 WAHRNEHMUNG UND ERLEBEN VON ÄNGSTEN
- 4.1 Ängste als Belastung und Problem
- 4.1.1 Das Leiden an der Angst
- 4.1.2 Die Dimensionen von Ängsten
- 4.2 Angst und Persönlichkeit
- 4.2.1 Individuelle Disposition und Grundängste
- 4.2.2 Angstneigung : Angst und Ängstlichkeit
- 4.3 Angst als (anthropologische) Konstante
- 4.4 Angstentwicklung in der Lebensspanne
- 4.5 Angsterleben im Kontext von Kultur und Gesellschaft
- 4.5.1 Angst und Furcht im Mittelalter
- 4.5.2 Angst im Abendland
- 5 ANGSTZUSTAND BEI INDIVIDUUM UND GESELLSCHAFT
- 5.1 Angst als Problem
- 5.1.1 Das Zeitalter der Angst? -kurzer Abriss der Situation
- 5.2 Angst als Abbild gesellschaftlicher Zustände – Gesellschaftliche Probleme mit und durch die Angst
- 5.3 „Der neurotische Mensch unserer Zeit“ - Neurosen als kulturelles Abbild
- 5.4 Typische Ängste unserer Tage
- 5.4.1 Existenzängste
- 5.4.2 Leistungsangst, Versagensängste und Angst vor Misserfolg
- 5.4.3 Diffusität und neue Abhängigkeiten- Angstquellen und Technikdominanz (Angst, Technik und Konsum)
- 5.5 Strukturelle Ursachensuche - belastende Bedingungen
- 5.5.1 Stress und Angst
- 5.5.2 Kapitalismus und Angst: Anpassung und Entfremdung
- 5.5.3 Furcht vor der Freiheit
- 6 ZUM UMGANG MIT DER ANGST
- 6.1 Exkurs: Der Mensch in der pathologischen Gesellschaft (nach Erich Fromm)
- 6.2 Angst und der „Gesellschafts-Charakter“
- 6.2.1 Der „,sozial-typische“ Charakter der (vergesellschafteten) Menschen
- 6.2.2 Angstumgang und der Gesellschaftscharakter
- 6.3 Strategien der Angstbewältigung
- 6.4 Umgang mit Angst lernen? - Chancen und Möglichkeiten
- 7 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit dem Phänomen der Angst und ihrer Rolle in der Gesellschaft. Sie untersucht die verschiedenen Ursachen, Erscheinungsformen und das Verhalten im Zusammenhang mit pathologischer Angst bei Individuum und Gesellschaft. Die Arbeit analysiert die Bedeutung der Angst in verschiedenen Kontexten, von der persönlichen Ebene bis hin zu gesellschaftlichen Strukturen.
- Die vielschichtigen Aspekte der Angst: von biologischen Grundlagen bis hin zu kulturellen und gesellschaftlichen Einflüssen
- Die Unterscheidung zwischen normaler und krankhafter Angst sowie die verschiedenen Formen von Angststörungen
- Die Bedeutung der Angst als Abbild gesellschaftlicher Zustände und die Herausforderungen, die sie für Individuum und Gesellschaft mit sich bringt
- Mögliche Strategien der Angstbewältigung und die Rolle der Gesellschaft im Umgang mit Angst
- Die Auswirkungen von Stress, Kapitalismus und der "Furcht vor der Freiheit" auf die Angstentwicklung in unserer Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
- Kapitel 2: Zum Begriff der Angst
- Kapitel 3: Angst als Krankheit - Angst im Übermaß
- Kapitel 4: Wahrnehmung und Erleben von Ängsten
- Kapitel 5: Angstzustand bei Individuum und Gesellschaft
- Kapitel 6: Zum Umgang mit der Angst
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Angst in der heutigen Gesellschaft dar und hebt die vielschichtigen Aspekte der Angst hervor. Sie skizziert die Herangehensweise der Arbeit und die wichtigsten Themenbereiche.
Dieses Kapitel widmet sich der Definition und Analyse des Begriffs "Angst". Es beleuchtet die Angst als menschliches Phänomen, die Rolle der Angst in der Philosophie (Kierkegaard), sowie die neurobiologischen, neuropsychologischen und lerntheoretischen Aspekte der Angst.
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Unterscheidung zwischen normaler und krankhafter Angst. Es werden verschiedene (klinische) Angststörungen wie neurotische Angst, phobische Ängste, Agoraphobie, soziale Phobie, Panikstörungen, Zwangskrankheiten und (Post)Traumatische Belastungsstörungen vorgestellt.
In diesem Kapitel wird die Belastung und das Leiden durch Ängste untersucht. Es werden verschiedene Dimensionen von Ängsten beleuchtet und der Zusammenhang zwischen Angst und Persönlichkeit, sowie die Entwicklung von Angst im Laufe der Lebensspanne betrachtet. Das Kapitel analysiert auch den Einfluss von Kultur und Gesellschaft auf das Angsterleben.
Dieses Kapitel untersucht die Angst als Problem in der Gesellschaft. Es beleuchtet die typischen Ängste unserer Zeit wie Existenzängste, Leistungsangst und die Angst vor Misserfolg. Weiterhin werden strukturelle Ursachen für die steigende Angst in der Gesellschaft wie Stress, Kapitalismus und die "Furcht vor der Freiheit" analysiert.
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit verschiedenen Strategien der Angstbewältigung. Es beleuchtet den "Gesellschafts-Charakter" nach Erich Fromm und untersucht den Einfluss der Gesellschaft auf den Umgang mit Angst.
Schlüsselwörter
Angst, Gesellschaft, pathologische Angst, Angststörungen, Existenzängste, Leistungsangst, Versagensangst, Stress, Kapitalismus, "Gesellschafts-Charakter", Angstbewältigung, Therapie, Kultur, Individuum
- Quote paper
- Jonas Wetzel (Author), 2002, Angst und Gesellschaft. Ursachen, Erscheinungsformen und Verhalten , Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/28241