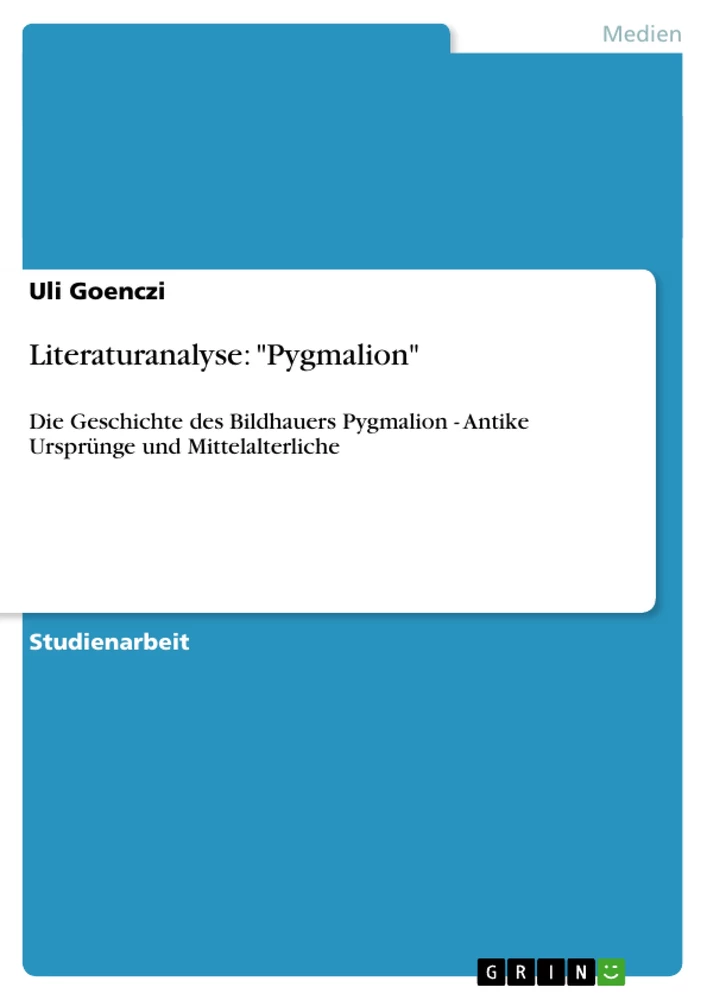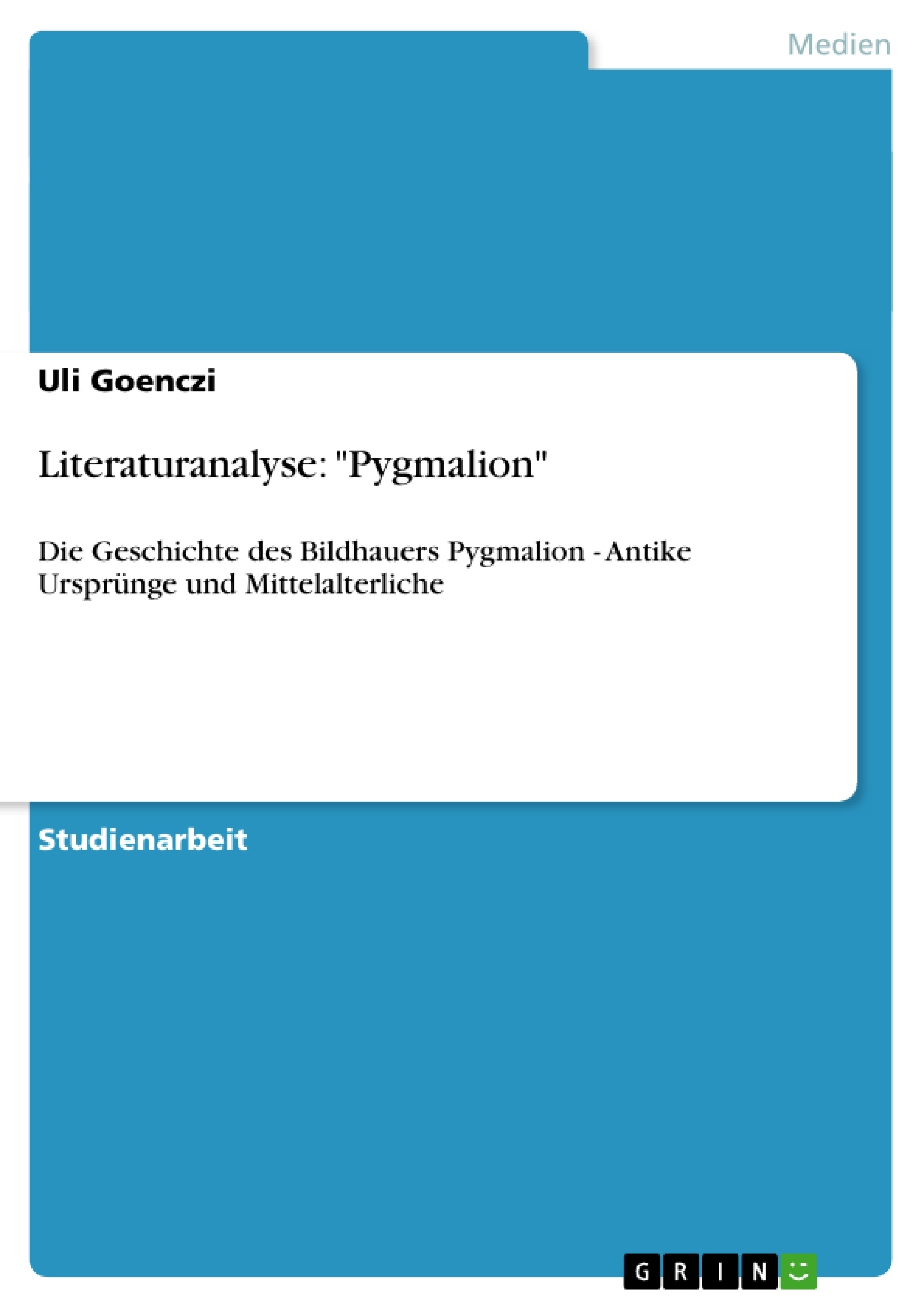Thema dieser Arbeit soll die Fabel Pygmalion sein.
Wie wir sehen werden, ist die Figur des Bildhauers Pygmalion zum großen Teil eine eigenständige Erfindung Ovids. Auf Ovids mögliche Quellen und ältere Versionen dieser Geschichte möchte ich im ersten Teil der Arbeit eingehen, mich jedoch dabei sehr stark auf den literarischen Aspekt beschränken. Andere sicherlich auch sehr interessante Gesichtspunkte wie z. B. ethymologische, kulturgeschichtliche und religionswissenschaftliche, werde ich außer Acht lassen.
Im zweiten, dem Mittelalter-Teil, wende ich mich den Behandlungen zu, die diese pagane Fabel aus Ovids „Heidenbibel“ durch christliche Autoren erfahren hat. Dabei möchte ich keine langen Nacherzählungen ihrer Pygmalion-Versionen liefern, sondern nur die Besonderheiten ihrer Interpretation und - soweit vorhanden - ihr moralisches Urteil herausstreichen.
Am Ende dieser Arbeit ist noch ein Abschnitt über die Abbildungen Pygmalions in der Buchmalerei vor 1500 n. Chr. und ein knapper Ausblick seiner explosiven Entwicklung in der Neuzeit beigefügt.
Da ich Abbildungen aus dem Pygmalion-Kreis vor 1500 hauptsächlich aus dem Roman de la Rose von Jean Molinet für diese Arbeit gefunden habe, wollte ich das Kapitel 2. 3. Pygmalion in der Poesie der Vollständigkeit halber nicht auslassen, auch wenn es nicht unbedingt zu den primären Anforderungen an diese Arbeit gehört.
In diesem Punkt werde ich nur sporadisch auf einige Beispiele des Nachlebens Pygmalions in der poetischen Literatur eingehen und die im Seminar gezogene zeitliche Grenze von 1500 genau einhalten. Es ist sehr wahrscheinlich, daß in diesem Kapitel einige Behandlungen Pygmalions übersehen wurden, aber eine genauere Beachtung würde den Rahmen dieser Arbeit bei weitem sprengen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- ,,Pygmalion“
- P. Ovidius Naso
- Altertum
- Inhalt
- Variationen zu diesem Thema
- Der Name „Pygmalion“
- Abbildungen aus der Antike
- ,,Pseudo-Lactantius“
- Das Mittelalter
- Lateinische Überlieferungen
- Arnulf von Orléans
- John of Garland
- John de Vergilio
- ,,Ovidius moralizatus“ (Petrus Berchorius)
- Übersetzungen in Landessprache
- ,,Ovide moralisé“
- ,,Morales de Ovidio“ (Pierre Berçuire)
- Albrecht von Halberstadt
- Pygmalion in der Poesie
- Buch Illustrationen vor 1500
- Fortleben der Pygmalion-Thematik in der Neuzeit
- Nachwort
- Bibliographie
- Der literarische Aspekt der Pygmalion-Figur in Ovids Metamorphosen
- Die Entwicklung der Pygmalion-Thematik im Mittelalter
- Die Interpretation der Fabel durch christliche Autoren
- Die visuelle Darstellung des Pygmalion-Motivs in der Buchmalerei vor 1500
- Das Nachleben der Pygmalion-Thematik in der Neuzeit
- Vorwort: Dieses Kapitel stellt die Thematik der Arbeit und den Fokus auf den literarischen Aspekt der Pygmalion-Figur vor. Es wird auf den Verzicht auf andere, interessante Aspekte wie die ethymologische, kulturgeschichtliche und religionswissenschaftliche Betrachtung hingewiesen.
- ,,Pygmalion“: Hier wird die Fabel des Pygmalion als Teil des Orpheus-Zyklus in Ovids Metamorphosen vorgestellt. Es werden der Kontext im 10. Buch der Metamorphosen und die erzählte Geschichte des Pygmalion, der sich in seine eigene Statue verliebt, zusammengefasst.
- P. Ovidius Naso: In diesem Kapitel wird ein kurzer Lebenslauf Ovids vorgestellt, der seine Werke, den Prozess seiner Verbannung und den Zeitpunkt seines Todes beschreibt.
- Altertum: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Inhalt der Pygmalion-Geschichte und stellt die darin enthaltenen Metamorphosen und die Geschichte der Propoeteiden dar. Es wird erläutert, wie Pygmalion sich in seine Statue verliebt und wie er diese durch die Intervention der Göttin Venus zum Leben erweckt. Weiterhin werden Variationen zu diesem Thema in der Antike betrachtet, wobei der Name Pygmalions in der Bibliotheka von Apollodorus erwähnt wird.
- Das Mittelalter: Dieses Kapitel widmet sich der Behandlung des Pygmalion-Stoffes durch christliche Autoren im Mittelalter. Es werden lateinische Überlieferungen und Übersetzungen in Landessprache sowie das Werk von Albrecht von Halberstadt, der die Pygmalion-Thematik in seiner Poesie verarbeitet hat, zusammengefasst.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Fabel des Bildhauers Pygmalion, die in Ovids Metamorphosen ihren Ursprung findet. Die Arbeit fokussiert sich auf den literarischen Aspekt der Figur des Pygmalion, beleuchtet Ovids mögliche Quellen und ältere Versionen der Geschichte und betrachtet im zweiten Teil die Behandlungen der Fabel durch christliche Autoren im Mittelalter.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter für diese Arbeit sind: Ovid, Metamorphosen, Pygmalion, Fabel, Mythologie, Antike, Mittelalter, christliche Interpretation, Buchmalerei, Poesie, Neuzeit.
- Quote paper
- Uli Goenczi (Author), 1998, Literaturanalyse: "Pygmalion", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/28086