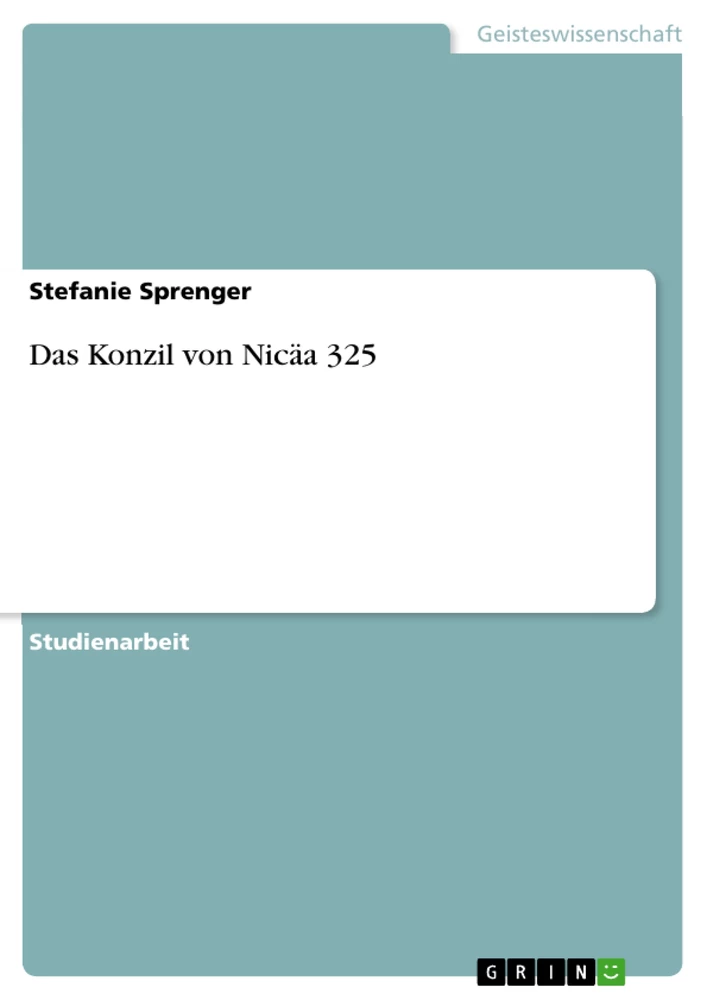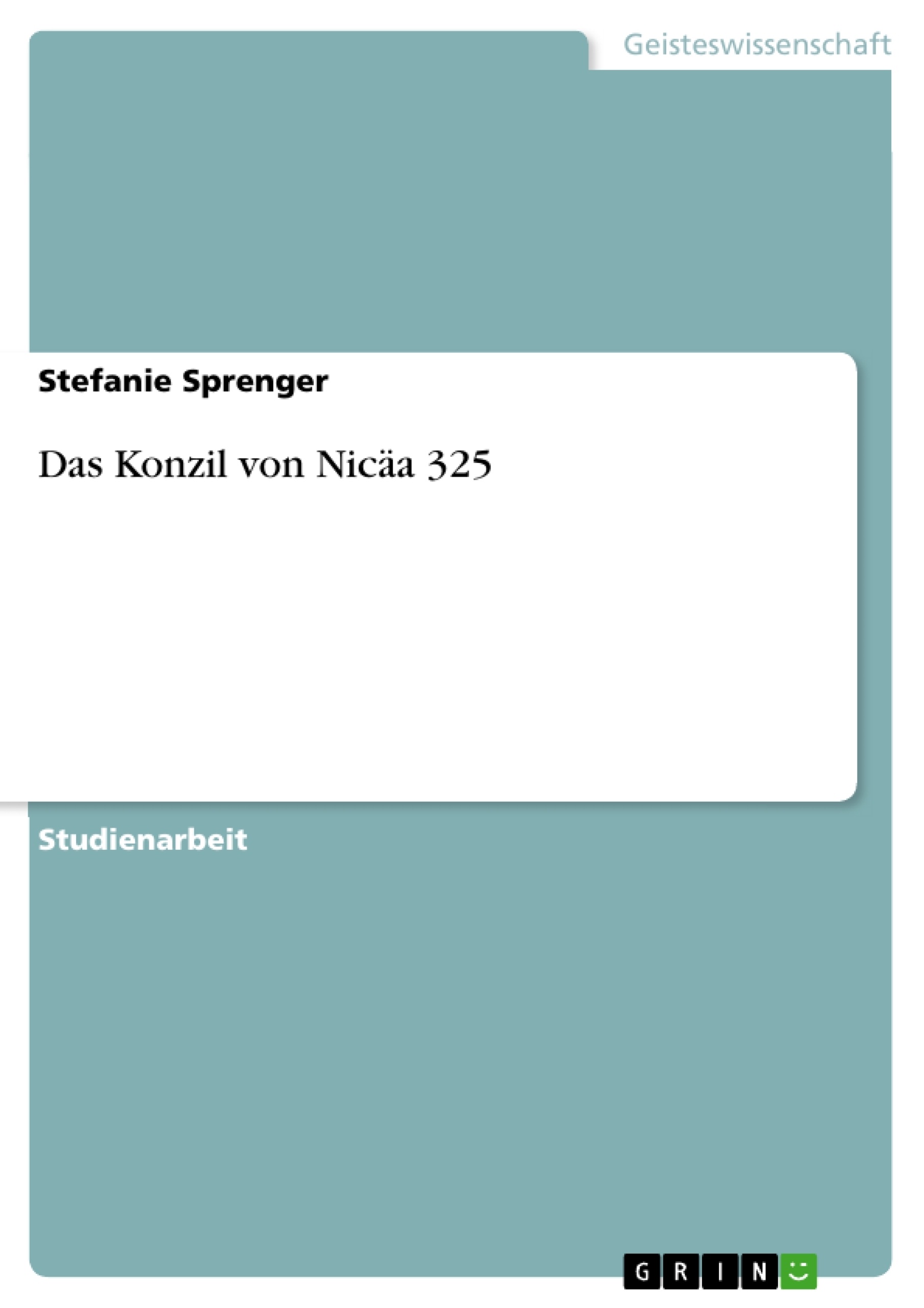Die vorliegende Hausarbeit handelt vom Konzil von Nicäa im Jahr 325. Kaiser Konstantin siegt im Jahr 324 über Licinius und wird Alleinherrscher des römischen Reiches. Seinen Sieg führt er auf Gottes Einfluss zurück und begünstigt von nun an verstärkt das Christentum in seiner Religionspolitik. Doch zu diesem Zeitpunkt ist der Kaiser selbst noch gar nicht getauft, die Taufe erfolgt erst im Jahr 337 auf dem Sterbebett.
Der Schwerpunkt liegt bei der Untersuchung der Wesensgleichheit, besser bekannt als „homoousios", die seit Jahrhunderten Diskussionsgrundlagen in der christlichen Theologie bietet. Es geht darum, wie das Wesen Jesu überhaupt zu verstehen ist. Dabei ist zu erläutern, wie es überhaupt zu den Streitigkeiten kommt, die das römische Reich zu spalten drohen. Dazu sind die verschiedenen Lehren des Presbyter Arius und seinem Bischof Alexander von Alexandrien näher zu erläutern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Konzil von Nicäa (325)
- Die historische Einordnung
- Der arianische Streit und das religiöse Umfeld
- Die Teilnehmer des Konzils unter besonderer Berücksichtigung Kaiser Konstantins
- Der Verlauf des Konzils
- Ergebnisse des Konzils und das Nizänische Glaubensbekenntnis
- Schlussbetrachtung und Folgen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Konzil von Nicäa im Jahr 325, das durch den Sieg Kaiser Konstantins über Licinius und die damit verbundene Förderung des Christentums in der römischen Religionspolitik einberufen wurde. Die Arbeit untersucht insbesondere die Frage der Wesensgleichheit Christi, bekannt als "homoousios", und die damit verbundenen Streitigkeiten, die das römische Reich zu spalten drohten.
- Die historische Einordnung des Konzils im Kontext der römischen Religionspolitik
- Der arianische Streit und die unterschiedlichen Lehren von Arius und Bischof Alexander von Alexandria
- Die Rolle Kaiser Konstantins bei der Einberufung und Leitung des Konzils
- Die Bedeutung des Konzils für die Formulierung eines einheitlichen Glaubensbekenntnisses
- Die Folgen des Konzils für die weitere christliche Kirchengeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den historischen Kontext des Konzils von Nicäa vor und skizziert die Bedeutung der Wesensgleichheit Christi für die christliche Theologie. Kapitel 2.1 beleuchtet die historische Einordnung des Konzils im Kontext der römischen Religionspolitik, die durch den Sieg Kaiser Konstantins über Licinius geprägt war. Kapitel 2.2 befasst sich mit dem arianischen Streit und den unterschiedlichen Lehren von Arius und Bischof Alexander von Alexandria. Kapitel 2.3 analysiert die Rolle Kaiser Konstantins bei der Einberufung und Leitung des Konzils. Kapitel 2.4 beschreibt den Verlauf des Konzils und seine Ergebnisse, insbesondere die Formulierung des Nizänischen Glaubensbekenntnisses.
Schlüsselwörter
Konzil von Nicäa, Kaiser Konstantin, arianischer Streit, Wesensgleichheit, homoousios, Nizänisches Glaubensbekenntnis, christliche Kirchengeschichte, Religionspolitik, römisches Reich, Dogmatik.
- Quote paper
- Stefanie Sprenger (Author), 2014, Das Konzil von Nicäa 325, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/279822